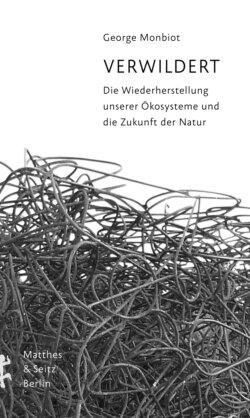Читать книгу Verwildert - George Monbiot - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4)Durchbrennen
ОглавлениеMein Freund, Blut schießt mir ins Herz ein,
Das nicht geheure Wagnis im Moment der Hingabe,
Den ein Lebtag des An-sich-Haltens nie zurücknimmt,
Dem, dem allein danken wir ein Dasein.
T. S. Eliot, Das wüste Land1
Ich drehte mich weg, versuchte mein Schmunzeln zu verbergen. Endlich und eher durch Zufall war ich auf etwas gestoßen, das ihm Angst machte.
»George, bitte, rühr das Ding nicht an.«
»Es ist harmlos.«
»Nein! Äußerst gefährlich. Giftig.«
Kopfschüttelnd trat er etwas zurück. Sechs Monate war es her, seit wir uns das erste Mal begegnet sind, sechs Monate, in denen sich sein sanfter Humor durch nichts und niemanden hatte aus der Ruhe bringen lassen, in denen sein Wagemut mich – der ich mich brüstete, mich Kopf voran in die Gefahr zu stürzen – wie ein Hühnchen hatte aussehen lassen. Mit einem grausamen Gefühl des Triumphs steckte ich meine Hand in den Busch.
»George, ich bitte dich …«
Das Chamäleon schwenkte sein Drehkuppelauge, um meine Hand zu mustern, und verfärbte sich in ein leichtes Rostrot. Sachte schob ich einen Finger unter eine seiner Greifhände und es umschloss ihn mit seinen Zangenzehen. Ich schob die übrige Hand unter das Tier. Es klammerte sich fest, und ich holte es langsam aus dem Busch. Seine Farbe wechselte in ein blasses Ziegelrot.
Toronkei war inzwischen fünf Schritte zurückgewichen. Auf seiner Stirn stand der Schweiß. Seine Lippen arbeiteten, gaben aber keinen Laut von sich.
»Siehst du, es ist ganz harmlos. Alles nur ein Mythos.«
Er schob sich nach vorne. Diesmal war sein Stolz verletzt. Das Chamäleon saß ruhig auf meiner Hand und drehte seine Augen. Es schlang seinen Schwanz um meinen kleinen Finger.
»Du kannst es anfassen, wenn du möchtest. Es tut nichts.«
Toronkei umklammerte seinen Speer so heftig, dass seine Knöchel glänzten. Er kam noch ein Stückchen näher, mit geöffnetem Mund. Zitternd vor Selbstbeherrschung streckte er seine Hand aus und schob seine Fingerspitze nach vorne, bis er das Chamäleon an der Flanke berührte. Es bäumte sich auf, öffnete sein rosafarbenes Maul und zischelte. Er machte einen Satz zurück, stolperte, fiel beinahe. Nun war es an mir, Selbstbeherrschung zu zeigen. Ich wendete mich ab und setzte das Chamäleon wieder in den Busch, verzweifelt bemüht, nicht zu lachen. Ich tat so, als beobachtete ich es, wie es wieder Fuß fasste, und nutzte den Moment, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu bekommen. Dann drehte ich mich um. Toronkei starrte mich mit einem Ausdruck an, den ich gerne als neu erworbenen Respekt interpretierte. Wahrscheinlich aber spiegelte sich in ihm die Überzeugung, dass ich verrückt geworden sei.
Wir waren in der Morgendämmerung aufgebrochen und bereits 30 Kilometer gerannt und gelaufen und hatten dabei eine weite Schleife durch Kajiando County im nördlichen Teil des Massai-Territoriums beschrieben. Gegen Mittag hatten wir an dem Haus seines Onkels haltgemacht, um Milch zu trinken, und zwei Stunden im Schatten gesessen, geredet und Fliegen verscheucht. Nun waren wir auf dem Heimweg zu Toronkeis manyatta. Fünfundzwanzig Kilometer lagen noch vor uns. Wir standen auf einer niedrigen Abbruchkante und sahen über die mit Büschen und Schirmakazien gefleckte Ebene, die sich von graugrün über grau und blau bis zu einem unsichtbaren Kilimandscharo hinzog und wie so häufig von Wolken oder einem grauen Himmel verhangen war. Durch den Hitzeschleier unter uns waberten Herden gefleckter Rinder, falbfarbener Elenantilopen, Impalas.
Wie üblich hatte mich Toronkei abgehängt, aber oft genug war er stehengeblieben und hatte vorgegeben, die Gegend abzusuchen, damit ich aufschließen konnte. Er nahm mehr Rücksicht auf meine Gefühle als ich auf seine. Wir hatten nichts Bestimmtes vorgehabt, außer seinen Onkel zu besuchen. Über die Savanne zu laufen, erfüllte an sich schon seinen Zweck. Toronkei und die anderen moran spornten sich gegenseitig zu Heldentaten an, etwa ihr Vieh in drei Tagen, ohne zu essen, zu trinken oder zu schlafen, über 200 Kilometer weit zu treiben. Ab und zu stahlen sie, obwohl sie mittlerweile, falls man sie erwischt, von der kenianischen Polizei schwer bestraft werden, auch Vieh von den Kikuyu, die in den benachbarten Landstrichen zu Hause waren, und entkamen mitunter nur in einem Kugelhagel. Unterhielt ich mich mit Toronkei und den anderen Kriegern, verblüffte es mich zu hören, dass die Flucht unter einem Kugelhagel ebenso Zweck der Übung war wie der Viehdiebstahl. Indem die moran ihr weites Land durchquerten und durchwanderten, lernten sie es so gut kennen wie wir unsere Vorstädte.
Ich hatte Toronkei durch die entscheidenden Phasen seines Lebens begleitet. Sechs Jahre, bevor ich ihn kennengelernt hatte, ist er beschnitten worden. Während der Operation musste er ruhig dasitzen und durfte sich nicht bewegen und nicht mit der Wimper zucken. Die, die es schafften, erhielten Rinder; die, die zusammenzuckten, wurden geächtet. Die Krieger übten sich darin, Schmerzen auszuhalten: Toronkei hatte eine kreisförmige Narbe auf jedem Oberschenkel, dort hatte er sich glühende Holzstücke auf die Haut gedrückt.
Jetzt, mit neunzehn, hatte er begonnen, den langen Weg der Initiationszeremonien als Krieger zu durchlaufen, an dessen Ende er den Status eines Junior-Ältesten erhält, heiraten und sein eigenes Haus errichten darf. Ich habe ihn über mehrere Monate mit den anderen morani tanzen, zechen und umherreisen sehen. Ich hatte zugesehen, wie sie einen Opferochsen bei den Hörnern und am Schwanz packten – er wirbelte sie durch das manyatta, bis sie ihn niederrangen –, ihn gezwungen hatten, einen Kürbis voll Bier zu trinken, ihn dann erstickt und sein Blut getrunken hatten. Ich hatte die starken Liebesbande zwischen den Kriegern mitbekommen, aber auch, dass ihre Messer unter ihren Umhängen aufblitzten, sobald ein Streit aufflammte.
Sie hatten – was ich nicht gesehen habe – einen Löwen getötet, und zwar wie von der Tradition vorgeschrieben: Erst trieben sie ihn in die Enge, dann packte einer seinen Schwanz, während die anderen versuchten, ihn mit ihren Speeren zu töten. Nichts schien die morani zu beunruhigen, außer Chamäleons. Gefahr war für sie etwas Delikates, das ausfindig gemacht und ausgekostet werden musste. Sie waren sprunghaft, leidenschaftlich, ungestüm und offen für alles. Ich fand es leichter, mich auf sie einzulassen als auf die indigenen Völker, mit denen ich in West-Papua und Brasilien gearbeitet hatte – vielleicht weil sie als Nomaden mit so vielen Kulturen in Berührung kamen. Sie akzeptierten mich, wie sie alles, was ihnen über den Weg lief, akzeptierten; nichts durfte ihren Erfahrungen im Weg stehen. Obwohl ich elf Jahre älter war als Toronkei, wurden wir, was anderswo unmöglich gewesen wäre, Freunde.
Nur wenige Wochen, nachdem wir zu dem Haus von Toronkeis Onkel gelaufen waren, war ich wieder in seinem manyatta, um der letzten Zeremonie beizuwohnen. Die morani tanzten langsam und traurig, mit einem sanften Gemurmel, das dem Wind in den Bäumen glich. Die Jahre der wilden Abenteuer gingen zu Ende. Ein junger Mann schritt mit dem langen leicht gewundenen Horn eines Großen Kudu in der Hand an den Rand der Gruppe. Er setzte seine Lippen an ein Loch in dem Horn und blies vier laute Trompetenstöße, die so tief waren, dass ich sie durch meinen Körper vibrieren fühlte. Schreiend und johlend liefen die Tänzer auseinander und stießen mich um. Vier oder fünf Krieger brachen zusammen und lagen unter Zuckungen und Ächzen auf dem Boden. Man versuchte sie auf die Beine zu stellen, aber sie schienen bewusstlos zu sein. Sie knurrten, sabberten und prusteten. Ihre Fersen schlugen auf den Boden. Das Horn wurde nur während der letzten Tage der Initiation geblasen, und immer wenn die Krieger es hörten, wurden sie von Trauer übermannt.
Ich folgte Toronkei in die Initiationshütte, die seine Mutter für ihn gebaut hatte – eine kleine Schachtel aus mit Kuhdung verkleidetem Weidengeflecht –, und hockte eine Weile unter der niedrigen Decke, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Als ich etwas sehen konnte, bemerkte ich eine unbekannte Frau, die auf einer Pritsche aus Kuhfell saß. Sie war sehr dunkel, mit starken Augenbrauen, einer glatten runden Stirn und einem kühlen, fast spöttischen Aussehen. Ich stellte mich vor. Mit einem komischen, fast verschämten Lächeln drehte sie sich weg. Verdutzt sah ich Toronkei an und war überrascht, dass er lachte.
»Dies«, sagte er, »ist meine Frau.«
Drei Tage, bevor ich im manyatta eintraf, war er 50 Kilometer gelaufen, um einen Freund zu besuchen. Als er sich dessen Dorf näherte, begegnete er einer jungen Frau, die den gleichen Weg nahm, und änderte seinen Plan. Die beiden verbrachten den Tag miteinander und als es Abend wurde, hatte er sie überzeugt, mit ihm durchzubrennen. Sie warteten, bis alle in ihrem Dorf schliefen, stahlen sich aus der Umfriedung und rannten los. Die Hunde wachten auf und die Brüder des Mädchens nahmen die Verfolgung auf. Das Liebespaar hetzte durch den Busch, aber kurz nach Mitternacht hatten die Brüder es gestellt. Das Mädchen weigerte sich, nach Hause zurückzukehren. Sie sagte ihren Brüdern, falls sie mit ihr sprechen wollten, müssten sie schon in Toronkeis Dorf kommen. Die Brüder kehrten in ihre Ansiedlung zurück, und bei Morgengrauen erreichten Toronkei und seine Verlobte das manyatta. Ihr Vater schäumte vor Wut, aber er konnte nur wenig ausrichten: Seine Tochter ließ sich nicht umstimmen. Toronkei hatte um Verhandlungen gebeten: Der Vater hatte einen Brautpreis von fünf Kühen und 10 000 Schilling gefordert. Toronkeis Eltern versuchten ihn herunterzuhandeln. Das Mädchen kam aus einer reichen Familie, es war ein hartes Geschäft.
Als ich die Geschichte hörte, die stolzen, konspirativen Blicke sah, die er mit seiner Braut austauschte, und mitbekam, wie er von den anderen morani als Held gefeiert wurde, stieg in mir – und dies nicht zum ersten Mal in meiner Freundschaft mit Toronkei – ein Gefühl der Eifersucht auf. Ich saß in der Hütte, trank Milch und begrüßte die Prozession junger Männer, die vorbeischauten, um ihm Respekt zu zollen, und haderte mit meiner Unzulänglichkeit. Als ich die jungen Krieger anschaute, die Hand in Hand auf der Pritsche saßen, und die junge Frau, die ihrem Ehemann zärtliche Blicke zuwarf, wurde ich von einem Gedanken eingeholt, der so klar und laut war wie eine direkt an meinem Ohr erschallende Glocke. Wäre ich als Embryo vor der Wahl gestanden zwischen meinem Leben und dem seinen – wohl wissend, dass ich mich dem einen wie dem anderen angepasst und mich in ihm eingerichtet hätte –, hätte ich das seine gewählt.
Trotz sechs an Abenteuern reichen Jahren in den Tropen, erschien mir mein Leben jetzt klein und behäbig. Ich dachte daran, was mich erwartete, wenn ich in ein paar Monaten nach Hause zurückkehren würde. Ich hatte den Plan, mein Buch zu Ende zu schreiben, Arbeit zu finden, wieder an alte Freundschaften anzuknüpfen und vielleicht eine Anzahlung auf ein Haus zu leisten. Nach zwei Hirnmalaria-Attacken, bei steigenden Ausgaben und schrumpfenden Ersparnissen, der Läuse, Moskitos, kaputten Straßen und des verdorbenen Wassers müde, erschien dies reizvoll. Jetzt aber dachte ich an die Unterhaltungen, die sich auf die drei Rs beschränkten: Renovierungen, Rezepte, Reiseziele. Ich dachte an Geländer und Staketenzäune. Ich dachte an Spaziergänge in der englischen Provinz, wo einen die Leute, sobald man sich abseits der Fußwege bewegt, anpöbeln. Nicht das erste Mal in meinem Leben kam mir plötzlich alles so sinnlos vor.
Benjamin Franklin beklagte sich 1753 in einem Brief an den englischen Botaniker Peter Collinson wie folgt:
Wenn ein Indianerkind unter uns aufgewachsen ist, unsere Sprache erlernt und sich an unsere Gebräuche gewöhnt hat, und wenn es loszieht, um seine Verwandtschaft zu besuchen und einen indianischen Wanderzug mit ihnen zu unternehmen, kann man es nicht mehr zur Rückkehr bewegen, und dass dies nicht bloß natürlich für sie als Indianer, sondern als Menschen ist, wird daraus ersichtlich, dass wenn Weiße gleich welchen Geschlechts von den Indianern gefangen worden sind und eine Zeit unter ihnen gelebt haben, und wenn sie dann von ihren Freunden ausgelöst und mit aller nur erdenklichen Zärtlichkeit behandelt werden, damit sie mit den Engländern zu bleiben bewogen werden, werden sie doch innerhalb kurzer Zeit unserer Lebensart und der zu ihrer Aufrechterhaltung nötigen Sorgen und Mühen überdrüssig und ergreifen die erste gute Gelegenheit, wieder in die Wälder zu entkommen, von wo man sie nicht mehr zurückholen kann.2
Für die kolonialen Autoritäten bedeutete das Überlaufen zu den Ureinwohnern eine schwere Bedrohung in ihrem Bestreben, die neue Welt zu unterjochen. Als junge Männer 1612 begannen, aus Jamestown, der ersten dauerhaften englischen Siedlung in Nordamerika, wegzulaufen, ließ ihnen der Vizegoverneur Thomas Dale nachstellen. Laut einem zeitgenössischen Bericht »wurden manche der Gestellten gehängt. Manche verbrannt. Manche gerädert, andere gepfählt und manche erschossen.«3
Die strengen Sanktionen belegen die Anziehungskraft. Trotz der Strafen liefen Europäer weiterhin über oder blieben, im Krieg gefangen, bei den Ureinwohnern. Das ging so lange, bis die Indianer derart geschwächt und gebrochen waren, dass es kein Leben mehr gab, zu dem man sich hingezogen fühlen konnte. 1785 berichtete Jean de Crèvecœur von europäischen Kindern, die, wenn ihre Eltern in Friedenszeiten kamen, um sie zu holen, sich fest entschlossen zeigten, in den indianischen Gemeinschaften zu bleiben, von denen sie gekidnappt worden waren:
[…] die, deren fortgeschritteneres Alter ihnen erlaubt hätte, sich ihrer Väter und Mütter zu erinnern, weigerten sich standhaft, ihnen zu folgen und liefen zu ihren angenommenen Eltern, um sich vor den überschwänglichen Liebesbezeugungen ihrer Eltern zu schützen! So unglaublich dies scheinen mag, mir ist es bei tausend Gelegenheiten zu Ohr gekommen, aus dem Munde glaubwürdiger Personen. In dem Dorf von …, in das ich mich zu begeben vorhabe, lebten vor etwa fünfzehn Jahren ein Engländer und ein Schwede …
Sie waren schon erwachsene Männer, als sie gefangen genommen wurden; glücklich entkamen sie den schweren Strafen für Kriegsgefangene und wurden gezwungen, die Squaws zu ehelichen, die ihr Leben durch Adoption gerettet hatten. Durch die Macht der Gewohnheit hatten sie sich schließlich vollständig diese wilde Lebensführung zu eigen gemacht. Ich war dabei, als sie von ihren Freunden eine beträchtliche Summe geschickt bekamen, um sich selbst auszulösen. Die Indianer, ihre alten Herren, ließen ihnen die Wahl … Sie entschieden sich zu bleiben; und die Gründe, die sie mir gegenüber anführten, dürften Sie gehörig überraschen: die vollkommenste Freiheit, die Leichtigkeit des Lebens, die Abwesenheit jener Sorgen und zersetzenden Kümmernisse, die so häufig Oberhand über uns gewinnen. … Tausende Europäer sind Indianer und wir haben kein einziges Beispiel von einem Ureinwohner, der aus freier Wahl Europäer geworden wäre.4
Der Zusammenstoß von alten und neuen Welten war von Enteignung, Unterdrückung und Massakern gekennzeichnet, aber an manchen Orten gab es Phasen freundschaftlicher Verbindung. Bei Crèvecœur ist dokumentiert, dass amerikanische Ureinwohner gelegentlich als Gleichgestellte in europäische Haushalte aufgenommen wurden; und in vielen Fällen war es für Europäer möglich, sich in ähnlicher Weise indianischen Gemeinschaften anzuschließen. Man könnte dies wie ein soziales Experiment auffassen. In beiden Fällen hatten die Menschen die Wahl zwischen dem relativ sicheren, doch eingehegten, ortsfesten und regulierten Leben der Europäer und dem mobilen, freien und unsicheren Leben der amerikanischen Ureinwohner. Am Ergebnis gibt es nichts zu deuteln. In jedem einzelnen Fall, so berichten Crèvecœur und Franklin, entschieden sich die Europäer, bei den Indianern zu bleiben, und die Indianer kehrten bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu ihren Gemeinschaften zurück. Das sagt mehr über unser Leben aus, als einem lieb sein kann.
Warum also bin ich nicht zu Toronkeis Gemeinschaft übergelaufen? Eine Frage, die mich noch immer beschäftigt.
Ich war, wie ich nach und nach entdeckte, zu weich für sein Leben. Ich konnte schon physisch gesehen nicht richtig mithalten. Wichtiger noch, ich war außerstande, mit der Unsicherheit zurechtzukommen: Mit der Unstetigkeit, nicht zu wissen, ob ich heute zu essen hätte oder erst morgen, ob ich mich im kommenden Monat ernähren könnte – oder gar noch am Leben wäre. Die Massai begegneten den wilden Schwankungen ihres Glücks mit Gleichmut. War in einem Jahr die Ebene schwarz von ihren Rindern, konnte im nächsten die Dürre zuschlagen und sie hatten nichts mehr. Zu wissen, was als Nächstes geschieht, war womöglich das alles beherrschende Ziel materiell komplexer Gesellschaften gewesen. In dem Augenblick jedoch, als wir es erreicht hatten, oder nahezu erreicht hatten, wurden wir mit einem neuen Reigen unbefriedigter Bedürfnisse belohnt. Wir haben die Sicherheit der Erfahrung vorgezogen, haben damit viel gewonnen, aber auch viel verloren. Vor allem aber war mir wohl auch bewusst, dass das alte Leben vorbei war. Die kenianische Regierung zerschlug das Land der Massai in kleine Einheiten. Mächtige Stammesälteste haben sich so viel unter den Nagel gerissen, wie sie zu fassen bekamen, und die anderen rangelten darum, noch etwas für sich zu bekommen. Die Gemeinschaft war im Begriff zusammenzubrechen; öffentliches Land, auf dem manyattas gebaut und Zeremonien abgehalten werden konnten, stand keines mehr zur Verfügung. Mit der Veränderung der Machtstrukturen wurden die Altersgruppen, um die das Leben der Massai ausgerichtet war, zu einem Anachronismus. Die Generation, der Toronkei angehörte, war wohl die letzte gewesen, die den Initiationsprozess innerhalb der Gemeinschaft durchlaufen hatte. Die Menschen haben angefangen, sich niederzulassen, in die Städte zu ziehen, die Freiheiten aufzugeben, in denen sie sich von uns unterschieden.
Doch selbst wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte, wäre das wilde Leben der morani nur mit Einschränkungen zu leben gewesen. Die Löwenjagd ist, da die Löwen immer seltener werden, durch die kenianischen Behörden unter strenge Strafe gestellt worden. Universalistische Prinzipien halten auch in Kenia, wo die Politik die Menschen immer noch nach Stammeslinien einteilt, nach und nach Einzug. Und ich habe meine Zweifel, dass die Kikuyu es je begrüßten, wenn die Massai ihre Rinder entführten und ihre Krieger mit Speeren bedrohten. Da mittlerweile Gruppen, die anders sind als wir, ihre Bedürfnisse und Rechte uns gegenüber geltend machen können, weil wir ihr Menschsein anerkennen, können wir ihr Leben nicht länger unseren Wünschen unterordnen, unsere Welt nicht mehr einfach der ihren überlagern. Die Freiheiten, die die Massai auf Kosten anderer genossen, sind – so reizvoll sie auch sein mochten – zu Recht beschnitten worden. Womöglich existiert einfach kein moralischer Raum mehr, in dem man seinen körperlichen Mut üben könnte. Wo auch immer man seine Faust schwingen möchte, wird stets die Nase eines anderen im Weg sein.
Auch wenn Jez Butterworths Theaterstück Jerusalem anfänglich auf den geteilten Zuspruch des Publikums stieß, wird es heute doch fast überall bewundert. Nach der Aufführung, die ich in der letzten Woche ihrer ersten strahlenden West-End-Inszenierung gesehen hatte, applaudierte die Hälfte des Publikums stehend, der Rest drängte mit finsterer Miene ätzend und tuschelnd zum Ausgang. Johnny Byron, packend dargeboten von Mark Rylance, ist der letzte Mohikaner. Er ist sinnlich, leichtfertig, ein Wüstling, wild und frei. Ein charismatischer, aber unedler Wilder, der in einem Wohnmobil in den Wäldern lebt, irre, schlimm und eine gefährliche Bekanntschaft, der letzte Mensch in England, der noch in Kontakt mit den alten Göttern ist. Seine totemistische Kreatur – sein Avatar – ist der Riese, dem er angeblich begegnet ist und den aufwecken zu können er beharrlich behauptet: das uneingeschränkte ursprüngliche Wesen, das keinen Regeln oder sozialen Zwängen unterworfen ist, der nicht mehr einer Welt angehört, in der neue Eigenheime die Wälder zersiedeln und Ordnungsbeamte in gelben Jacken mit ihren Klemmbrettern auf Patrouille gehen.
»Nehmt so viel ihr wollt«, sagt uns Byron. »Kein Mann wurde je ins Grab gelegt, der sich gewünscht hätte, auch nur eine Frau weniger geliebt zu haben. Hört auf nichts und niemanden, außer, was euch das Herz gebietet. Lügt. Betrügt. Stehlt. Kämpft auf Leben und Tod.«
Er lebt seine Überzeugung, der Bürokratie ein Dorn im Auge, ein Fluch der anständigen, sesshaften Leute, die ihn hassen und beneiden, ein Drogendealer, Schläger, Verführer, einstiger Draufgänger, Großsprecher, ein Magnet für aufmüpfige Teenager, ein schäbiger, vollgepisster, betrunkener Orgienfürst, ein Meister der letzten wilden Jagd. Er liegt im Clinch mit Wesley, einem Freund aus Kindertagen, jetzt Wirt des örtlichen Pubs (in dem Johnny natürlich Hausverbot hat), der von den Auflagen der Brauerei, durch Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, durch sein eintöniges, verantwortungsvolles Leben und die hygienische, sterile Welt, die er sich geschaffen hat, aufgerieben wird. »… diese blöden fieseligen Teebeutel, diese blöden kaputten Handtuchspender, diese idiotisch beschissenen T-Shirts. Ich komme erst ins Bett, wenn auch der letzte Mistkerl nach Hause gegangen ist. Ich lege mich neben meine Alte und kann nicht atmen … Erste Regel, arbeite dein ganzes Leben. Zweite Regel, sei nett zu den Leuten …«
In unserer überfüllten, biederen Welt gibt es für Johnny Byron keinen Platz. Er kommt einem bestimmten Bedürfnis entgegen – das sich in den jungen Leuten zeigt, die zu ihm strömen –, doch es ist kein Bedürfnis, für das die Gesellschaft Raum böte. Die Tragödie des Stücks besteht darin, dass die Welt ihm keinen Platz einräumen kann, so wie sie für die Diebeszüge und Löwenjagden der morani keinen Platz mehr hat. So sehr wir uns nach einem Leben wie dem seinen sehnen mögen, so sehr uns der Tod des ungehobelten Geistes, der ihn antreibt, verarmen lässt, er ist zu groß für die Zwänge, innerhalb derer zu leben wir moralisch verpflichtet sind, für die Einschränkungen, die, wie Wesley feststellen muss, uns den Atem nehmen.
Ich könnte auf verschiedenen Wegen zu zeigen versuchen, dass wir den Verlust des wilderen Lebens spüren, das zu führen wir angelegt sind. Ich könnte den Drang einzukaufen als Ausdruck des Instinkts anführen, der uns auf Nahrungssuche gehen lässt; Fußball als eine sublimierte Jagd; Gewaltfilme als Abhilfe für nicht ausgetragene Konflikte; das Ausüben immer extremerer Sportarten als Reaktion auf das Fehlen gefährlicher Wildtiere; den Kult um den Fünfsternekoch als den Versuch, sich aufs Neue mit dem, was Land und Meer hergibt, zu verbinden. In all diesen Fällen erscheinen die Verbindungen plausibel, kaum zu belegen und banal. Ich glaube jedoch, ich bin auf eine interessantere Beweisführung gestoßen.