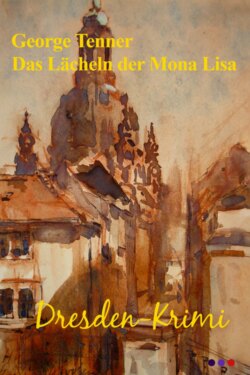Читать книгу Das Lächeln der Mona Lisa - George Tenner - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel
ОглавлениеAm Dienstag, dem 6. September, kurz nach zehn klopfte Thomas Lenz an die Tür zu Kerns Büro. Er steckte den Kopf herein und fragte:
»Hast du das Tagesbulletin von gestern gelesen, Barny? Wir haben eine neue Entwicklung im Fall des Malers Helmut Müller-Karsten.«
»Komm rein.«
Lenz setzte sich auf den Besucherstuhl, der vor dem großen Schreibtisch Kerns stand, und schob den Bericht vom Vortag über den Tisch, der von der Pressestelle der Polizei täglich her-ausgegeben wird. Er hatte die Stelle mit einem roten Markerstift gekennzeichnet.
»Sieh da. Am Wochenende wurde also in der Galerie Falconettis eingebrochen.« Kern las den kurzen Bericht durch.
»Falconettis wird in einem dieser wunderschönen Bürgerhäuser der Jahrhundertwende geführt.«
»Das ist man ja schließlich seinem Ruf schuldig.«
»Das Haus ist in der Pohlandstraße, und die Pohlandstraße ist eine Parallelstraße der Tzschimmerstraße, in der dieser Hild wohnt.«
Kern ließ seinen Kugelschreiber auf den Tisch fallen und stieß einen leisen Pfiff aus. »Etwas zu viele Zufälle, meinst du nicht auch?« Lenz hob die Schultern und machte ein vielsagendes Gesicht. Kern wählte die Nummer seines Kollegen Günter Moebus, der als Hauptkommissar die Leitung des Einbruchsdezernats hatte, erreichte aber nur eine Mitarbeiterin, die ihm sagte, dass Moebus sich im Verhörzimmer befinde, um einen mutmaßlichen Einbrecher zu befragen.
»Moebus ist im Verhörzimmer. Ich gehe mal runter«, sagte Kern zu Thomas Lenz. Auf dem Weg traf er auf Fritz Leistner, einen Mitarbeiter von Moebus, der offensichtlich den gleichen Weg hatte wie er. Kern sprach ihn an. »Was ist mit dem Einbruch bei Falconettis?«
»Der Hauptkommissar verhört gerade einen Mann in dieser Sache.”
»Thomas Vester?«
»Ja.«
Sie gingen beide zur Rückseite des eigentlichen Verhörzimmers und betraten den Raum, der ihnen die Sicht durch die Spiegelscheibe auf das Geschehen im Verhörzimmer freigab. Carmen Jacobi, eine Kollegin von Leistner, stand vor der Scheibe und beobachtete das Verhör. Sie schaute nur kurz auf. Moebus war allein mit Vester. »Sie können also bestätigen, dass es sich bei dem zerstörten Bild um eine Arbeit Ihres Stiefvaters handelt?«, fragte Moebus.
»Es ist eine Lithografie, die wir beide zusammen aus der Taufe gehoben haben, ja.«
»Was zeigt das Bild?«
»Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Die Lithografie stellt ein Jugendbildnis meiner verstorbenen Mutter dar.«
»Richtig. Handelt es sich um das gleiche Motiv, das im Atelier Helmut Müller-Karstens zerstört wurde?«
»Ja.«
»Wieso kommt es, dass sich jemand gerade für dieses Motiv interessiert?«
»Woher soll ich das wissen?« Vester machte nicht den Eindruck, dass ihn die Fragen von Moebus sonderlich beeinflussten. Er wirkte keinesfalls nervös, vielmehr ausgeglichen. Wie einer, der mit sich zufrieden sein konnte.
»Hatte Ihre Mutter Feinde?«
»Wieso meine Mutter? Vielleicht hatte ja Helmut Feinde.«
»Nannten Sie Helmut Müller-Karsten immer beim Vornamen? Schließlich war er Ihr Stiefvater.«
»Das war er. Aber es war eine ausgemachte Sache, dass ich ihn nicht Vater nannte. Schließlich war er nicht mein Erzeuger. Was also sollte ich Ihrer Meinung nach zu ihm sagen? Onkel?”
»Hatte Helmut Müller-Karsten Feinde?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Ich frage Sie noch einmal. Ihre Mutter, hatte die Feinde?«
»Nein.«
»Wieso glauben Sie das?«
»Weil die beiden ganz zurückgezogen lebten. Helmut Müller-Karsten kommunizierte ganz selten einmal mit Malerkollegen. Josef Hegenbarth war einer von ihnen, Albert Wiegand ein anderer. Mit Wiegand verband ihn eine ganz besondere Freundschaft. Er mochte die Art, wie der malte. Die Gemälde, Zeichnungen und Collagen Albert Wiegands verbreiten immer einen Hauch von Frankreich. Wiegand war Autodidakt wie ich. Wiegand war kein Epigone.«
»Epigone?«
»Nachahmer. Die Lust an der Kunst, sagte Helmut immer, wenn er über Wiegand sprach, habe dessen französische Großmutter geweckt.«
»Was ist mit Ihrem richtigen Vater?«
»Meinem Erzeuger, wollten Sie wohl sagen?«
»Hatte er einen Grund, auf Helmut Müller-Karsten wütend zu sein?«
Vester hob die Schultern. »Kaum. Soviel ich weiß, lebten meine Mutter, Helmut und er eine Zeit lang in einer ménage à trois, als er aus der Gefangenschaft kam und Helmut Müller-Karsten seinen Platz im Bett meiner Mutter eingenommen hatte.«
»Könnte er Rachegefühle haben?«
»Es wurde kaum darüber gesprochen. Mein Großvater hatte das verboten. Aber ich quälte meine Großmutter so lange mit meinen Fragen nach meinem richtigen Vater, bis sie mir gestand, dass der, nachdem eine Entscheidung zu seinen Gunsten nicht getroffen wurde, nach dem Westen ging, noch bevor die Währungsreform kam und die Grenzen endgültig dichtgemacht wurden. Er hat sich niemals mehr gemeldet.«
»Dann haben Sie Ihren Vater nicht einmal kennengelernt?«
»Nein. Und ich glaube auch nicht, dass er Rachegefühle hatte. Für ihn war das Thema Ehe mit meiner Mutter abgehakt. Ein Kollateralschaden des Zweiten Weltkriegs.«
»Das ist bitter für ein Kind, seinen Vater nicht zu kennen.« Als Vester nichts sagte, legte Moebus nach: »Haben Sie darunter gelitten?«
»Es heißt ja, jedes Kind würde unter der Trennung der Eltern leiden. Ich wurde 1945 geboren. Als mein Vater aus der Gefangenschaft kam, war ich drei Jahre alt. Glauben Sie wirklich, dass ein Dreijähriger, dem schon das Gesicht des anderen Mannes vertraut ist, einen Mann vermisst, den er zum ersten Mal gesehen hat?«
Moebus beschloss, zu dem Einbruch bei Falconettis zurückzukommen. »Es war das vierte von fünfundzwanzig Exemplaren.«
Thomas Vester schaute auf das Foto, das Moebus ihm über den Tisch schob. »Ja, das steht hier. Das vierte von fünfundzwanzig Exemplaren.«
»Sie waren doch mit dem Verkauf der Bilder betraut. Wo sind die anderen einundzwanzig Bilder geblieben?«
»Woher soll ich das wissen? Ich verteilte einige auf Galerien in Leipzig, Berlin und Dresden. Ein oder zwei Exemplare verschenkte Helmut. Vielleicht auch mehr.«
»Gibt es noch Bilder davon bei Ihnen zu Hause?«
»Ja.«
»Wie viele?«
Thomas Vester hob die Schultern, sagte aber nichts.
»Wollen Sie einen Kaffee?«
»Gerne.«
Moebus drückte auf den Klingelknopf, und als einer der Bereitschaftspolizisten den Kopf zur Tür hereinsteckte, bestellte er zwei Tassen Kaffee. Die Luft im Raum war drückend geworden.
»Sie wollen mir nicht erzählen, Sie hätten nicht nachgesehen, wie viele Exemplare noch da waren, als Sie sahen, dass der Stein zur Herstellung der Lithografie zerstört war und auch eines der Bilder, das das Gesicht Ihrer Mutter zeigte.”
»So wichtig war das für mich nicht.«
»Also, wenn ich eine solche Möglichkeit hätte, ein Bildnis meiner Mutter als Lithografie zu haben, und mir würde dann so etwas passieren, würde mich das ganz schön verärgern.«
Er versucht immer wieder, ihn auf die psychologische Art zu packen, dachte Barnaby Kern. Aber Vester ist viel zu gerissen, um ihm da auf den Leim zu gehen. Er betrachtete den Mann. Er sah schmuddelig aus. Seine Fingernägel waren sicher ebenso schmutzig wie bei der Befragung durch ihn selbst. Er drehte sich zu Fritz Leistner und sagte: »Vielleicht sollten Sie Ihrem Chef den Kaffee bringen und ihn für einen Augenblick ablösen. Er sieht aus, als könne er eine kleine Atempause gebrauchen. Eine Pause, die Vester nicht gegönnt werden sollte.«
»Sie haben recht.« Leistner ging zur Tür.
»Sie hatten den Mann doch auch schon in der Mangel«, sagte Carmen Jacobi. »Was haben Sie für einen Eindruck gewonnen, Herr Hauptkommissar?«
»Schwer zu sagen.«
»War er es? Hat er den Einbruch begangen und die Bilder beschädigt?«
»Wenn Ihre Abteilung keine Erkenntnisse dazu hat, wird er nur allein wissen, wie es war. Alles andere ist Spekulation.«
Die Frau ärgerte sich, Barnaby Kern gefragt zu haben. Eine Belehrung war das letzte, was sie gebrauchen konnte. Kern merkte, dass sie beleidigt war, und sagte versöhnlich: »Wir lernen immer noch dazu. Ich habe auch schon manchmal gedacht, einen Täter dingfest gemacht zu haben, und dann musste ich feststellen, dass ich mich geirrt hatte.«
Die Tür zum Vernehmungsraum ging auf, und Leistner jonglierte das Tablett in den Raum. Moebus schaute ihn erstaunt an, und sie sahen, wie er ihm mit den Augen ein Zeichen zum Spiegel gab. »Trinken Sie in Ruhe«, sagte Moebus. »Ich bin gleich zurück. Dann machen wir weiter.«
Als Moebus in den Raum hinter der Spiegelscheibe kam und Kern entdeckte, sagte er: »Du hörst wohl das Gras wachsen, Barnaby. Oder hat dich einer meiner Mitarbeiter alarmiert?« Sie gaben sich die Hand.
»Das Tagesbulletin ist schuld, Günter, und mein Lenz, der es gelesen hat und mich aufmerksam machte.«
»Und? Was hältst du von dem Kerl?«
»Deine Kollegin hat mich schon danach gefragt. Mein Bauchgefühl sagt, dass er etwas damit zu tun haben muss. Mein Verstand sagt, dass wir derzeit nichts gegen diesen schmierigen Kerl in der Hand haben. Es sei denn …«
»… Ich bekomme noch etwas aus ihm heraus. Aber das ist sehr zweifelhaft.«
»Wo hat er denn das Wochenende verbracht?«
»Am Sonnabend beim Billardspiel. Am Sonntag in Schiebock.« Moebus benutzte den Spitznamen Schiebock. Wer in der Oberlausitz »Schiebock« sagt, meint Bischofswerda. Ein Schiebock ist zunächst einmal ein schubkarrenähnliches einrädriges Gefährt, mit dem einst Bauern und Handwerker Ende des acht-zehnten Jahrhunderts ihre Waren von Ort zu Ort fuhren. Sinn-vollerweise wurden an Markttagen die Waren auch meist gleich direkt vom Schiebock verkauft. Eine praktische Angelegenheit, die eigentlich auch heute noch genutzt wird. Allerdings werden die Waren nicht mehr mit dem Schiebock auf die Märkte gefahren – das Auto hat dem handlichen Karren längst den Rang ab-gelaufen: Bäcker, Fleischer, Fischhändler usw. verkaufen ihre Waren vom Auto aus, mit dem sie sie vorher auf den Markt gekarrt haben.
Für die jüngeren Bischofswerdaer hat dieser Name nicht mehr den negativen Beigeschmack, den die Älteren vielleicht aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern noch empfinden. Mittlerweile ist der Name »Schiebock« mit Bischofswerda fest verbunden, und das Gefährt Schiebock stellt ein symbolisches Wahrzeichen der Stadt dar.
»Wo hat er Billard gespielt?«
»In Blasewitz.«
»Blasewitz und Striesen liegen direkt nebeneinander.«
»Ja.«
»Und am Sonntag war er in Bischofswerda?«
»Das behauptet er.«
»Stelle fest, wann man ihn dort gesehen hat. Ich muss wieder hoch in meine Abteilung.«
»Warte noch einen Augenblick. Vielleicht kriegen wir ihn ja jetzt.« Er wartete die Antwort Kerns nicht ab, sondern verließ den Raum.
Als er wieder vor Thomas Vester saß, fragte er: »Wie war das am Sonnabend, Sie haben Billard gespielt.«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich war in der Krone in der Heinrich-Schütz-Straße, wo wir uns ab und zu treffen, um ein Spielchen zu machen.«
»Da haben Sie sicher eine Menge Zeugen.«
»Natürlich. Einen Rechtsanwalt …«
»Name?«
»Blaschke. Egon Blaschke. Und Heinz Scholz. Scholz ist Drechsler. Er hat seinen Betrieb nahe dem Schillerplatz in der Tolkewitzer Straße. Und der Wirt. Der kann auch bezeugen, dass ich dort war.«
Moebus schrieb sich das auf. »Und Sonntag?«
»Gegen acht hat mich mein Freund Hild mit seinem Auto ab-geholt, und wir sind in meinen Garten nach Bischofswerda gefahren. Und dafür gibt es sicher eine Menge Zeugen, denn wir hatten eine Auseinandersetzung mit einem anderen Autobesitzer, der unverschämterweise die Einfahrt zu meinem Grundstück blockierte und auch noch glaubte, er sei im Recht. Das haben einige Nachbarn mitbekommen.«
Ich werde das Gefühl nicht los, dachte Barnaby Kern, dass der Bursche die ganze Sache gut durchgeplant hat. Jedermann sollte sich daran erinnern, dass er zu dieser Zeit an diesem Ort war. Moebus würde eine Menge Nachprüfungen anstellen müssen. Kern spürte, dass er eine Zeit zum Nachdenken brauchte, die er in seiner Abteilung im Präsidium nicht haben würde. Er sagte Inka Löbl Bescheid, die das Büro besetzt hielt, während die anderen Mitglieder der Gruppe zum Essen gegangen waren, dass er ein oder zwei Stunden unterwegs sein würde, und fuhr nach Blasewitz. Vor der Gaststätte Krone blieb er einen Augenblick sitzen und schloss die Augen. Es war nicht eben die feine Gegend wie auf dem Weißen Hirsch, und auch Striesen mit seinen großen Stadtvillen war eine andere Liga. Hier war es anders. Jenseits der Tolkewitzer Straße zur Elbe hin standen einige Einfamilienhäuser. Die Heinrich-Schütz-Straße hatte in Mehrzahl die langen Häuserzeilen mit den relativ kleinen Wohnungen, die in den zwanziger und Dreißigerjahren gebaut wurden. Es war das, was man eine Arbeitergegend nannte. Direkt hinter der Krone lag ein großer Straßenbahnhof, der auch als Ausbesserungswerk galt. Barnaby Kern stieg aus. Die Gastwirtschaft war seit einer Stunde geöffnet. Nur wenige Leute saßen bei einem Bier oder ließen sich ein Essen bringen. Es war die typische Hausmacherkost, die hier angeboten wurde. Kern ging zum Wirt, der hinter dem Tresen Bier zapfte, und fragte: »Kennen Sie einen Blaske?«
»Blaschke! Schschsch … Wer will denn das überhaupt wissen?«, fragte der Mann in breitem sächsischen Dialekt.
Kern hielt dem Wirt seinen Ausweis hin, sagte aber nichts, um die Aufmerksamkeit der Leute nicht auf sich zu ziehen. »Fahren Sie die Straße zurück, über die Tolkewitzer in die Verlängerung der Heinrich-Schütz-Straße. Auf der linken Seite ist ein Einfamilienhaus im Bauhausstil, ein Kasten von Gropius oder Mies van der Rohe. Es ist das einzige dieser Art, also können Sie es nicht verfehlen.« Barnaby Kern bedankte sich für die präzise Auskunft.
Der Wirt hatte recht. Das Haus lag keine zweihundert Meter von der Kneipe entfernt. Er sah den Kasten schon von der Ecke aus. Als er die Tolkewitzer Straße überquert hatte, lag die Elbe direkt vor ihm. Er fuhr die wenigen Meter bis hinunter zum Wasser und sah, wie sich der Fluss mit seinem schmutzig grau-braunen Wasser dahinwalzte. Er wendete und stellte seinen Wagen direkt vor dem Eingang des Hauses ab. Auf sein Klingeln wurde eine Gardine zurückgezogen. Als man festgestellt hatte, dass tatsächlich jemand vor der Tür stand, kam ein älterer Mann zum Zaun. Interessiert schaute er Kern an. »Ja, bitte?«
Kern zog wieder seinen Ausweis und fragte: »Sind Sie der Anwalt Blaschke?«
»Die Polizei! Ja, der bin ich. Allerdings im Ruhestand.« »Ich hätte ein paar Fragen an Sie.«
»Wollen Sie nicht reinkommen?« Der Mann öffnete die Pforte und ging mit Kern zum Haus.
»Eigentlich ist das gar nicht nötig. Ich brauche nur eine Auskunft von Ihnen.«
Im Eingang begegneten sie kurz der Ehefrau des Mannes. Sie gingen ins Wohnzimmer, und Blaschke bot Barnaby Kern einen Platz an.
»Sie gehen hin und wieder in die Krone, um mit Freunden Billard zu spielen«, begann Kern.
»Nicht nur Billard. Manchmal dreschen wir auch einen zünftigen Skat. Aber es wird immer seltener. Früher war es alle zwei Wochen. Heute maximal einmal im Monat, wenn überhaupt. Meist telefonieren wir uns kurzfristig zusammen.«
Die Frau steckte den Kopf herein und fragte, ob sie einen Tee bringen könne.
»Sie waren am Wochenende dort zum Spielen verabredet?«
»Ja. Am Sonnabend habe ich mich mit einem Bekannten zum Billardspielen verabredet.«
»Mit einem Bekannten?«
»Mit einem sehr langjährigen Bekannten. Heinz Scholz ist Drechsler. Er stellt auch die Queues her, mit denen die Kugeln gestoßen werden. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit.«
»Spielen Sie beide allein?«
Die Frau kam zur Tür herein. Sie trug ein Tablett mit zwei Tassen, einer Kanne und einer Zuckerdose, die sie vor den Männern auf den Tisch stellte. »Kann ich sonst noch etwas bringen?«
»Nein danke, Ruth.« Sie ging wieder hinaus, und der Mann goss umständlich den Tee in die Tassen. Barnaby Kern bedankte sich und nahm zwei Stücke des braunen Kandiszuckers, die er vorsichtig in seine Tasse gleiten ließ.
»Sie fragten, ob wir allein spielten?«
»Ja.«
»Es ist so, dass wir natürlich über die Jahre einige Leute ken-nen gelernt haben, die das eine oder andere Mal mitspielen wollten.«
»Wie war es am Sonnabend. Haben Sie da allein gespielt?«
Blaschke dachte einige Sekunden nach. Dann sagte er: »Am Sonnabend haben wir relativ lange gespielt. Ich bin erst nachts um zwölf dort weggegangen. Die Spieler haben mehrfach gewechselt.«
»Hat ein Thomas Vester mit Ihnen gespielt?«
»Thomas Vester? Ja, der war eine ganze Zeit da und hat auch mit uns gespielt.«
»Woher kennen Sie den Mann?«
»Es war Zufall. Er kam einige Male in die Krone zum Spielen. Irgendwann fragte er, ob er mit uns spielen könne, und wir hatten nichts dagegen. Dann kamen wir ins Gespräch, und er erzählte, dass er im Künstlerhaus in Loschwitz wohne.« Blaschke machte eine kleine Pause, nahm einen Schluck Tee, bevor er fortfuhr: »Als ich erfuhr, dass er in diesem Haus wohnte, wurde ich neugierig.«
»Was hat Sie denn so daran interessiert?«
»In diesem Haus wohnt ein Onkel von mir. Er war mit der Schwester meiner Mutter verheiratet. Die Ehe ging in den Nachkriegswirren auseinander, und wir verloren uns aus den Augen, obwohl wir nur einige Kilometer voneinander entfernt wohnten. Offensichtlich ist er nicht der Mensch, der einer angeheirateten Familie nachtrauert.«
»Und Vester kannte diesen Onkel«, sagte Kern.
Blaschke lachte. »Schlimmer, er ist der Sohn seiner zweiten Frau.«
»Helmut Müller-Karsten.”
»Genau. Wie kommen Sie darauf, Herr Hauptkommissar?«
»Müller-Karsten ist verstorben.«
»Das ist der Lauf der Dinge. Er war ja auch schon über siebzig Jahre alt. Und was hat Thomas Vester mit dem Tod seines Stiefvaters zu tun?«
»Um es gleich vorwegzusagen: Helmut Müller-Karsten ist eines natürlichen Todes gestorben. In seinem Atelier allerdings hat irgendwer gewütet.«
»Ein Einbruch?«
Kern schüttelte den Kopf. »Kein Einbruch. Die Spurensicherung hat keinen Hinweis darauf gefunden.«
»Sie haben Thomas in Verdacht?«
»Na ja, wir können das nicht ausschließen. Ein Bild wurde zerstört und ein Druckstein.«
»Ich weiß nicht. Warum sollte er das tun? Wenn Helmut Müller-Karsten verstorben ist, wird er ohnehin einen gewissen Teil erben. Schließlich leben sie seit Jahren schon zusammen.«
»Einen Teil?«
»Na ja, der Sohn meiner Tante ist in jedem Fall auch erbberechtigt.«
»Ich weiß. Das geht alles seinen Gang. Der ist verständigt. Wie lange war Vester denn am Sonnabend mit Ihnen zusammen?«
»Ich weiß das nicht genau. Er kam mit Martin.«
»Sie kennen Martin Hild?«
»Kennen ist zu viel gesagt. Eine Kneipenbekanntschaft, und über die ging es nicht hinaus. Das trifft übrigens für Thomas Vester natürlich auch zu.«
»Denken Sie bitte noch einmal nach!«
»Ich würde sagen, er kam gegen neun und ging kurz vor mir.«
Barnaby Kern machte sich ein paar Notizen. Den Einbruch bei Falconettis ließ er unerwähnt. Dann bedankte er sich für den Tee und die Auskünfte, übergab Blaschke noch eine Visitenkarte von sich mit der Bitte, ihn anzurufen, wenn ihm noch etwas einfallen sollte, und verabschiedete sich.
Auf dem Weg zurück zum Präsidium in die Schießgasse über-fiel ihn wieder dieses mörderische Sodbrennen, und er verfluchte, sich so schamlos an dem braunen Kandis bedient zu haben. Zu viel Fett, zu viel Zucker und zu viel Kaffee. Der Magen rebellierte. Kleine Sünden, dachte er, bestraft der liebe Gott eben sofort.
Im Präsidium suchte er sofort Lenz auf und berichtete ihm, was er in Erfahrung gebracht hatte. »Du kannst denken, was du willst. Ich habe das Gefühl, dass uns dieser kleine, schmierige Fünfziger mächtig an der Nase her anführt«, sagte Kern.
»Wirst du Moebus sagen, dass du mit diesem Blaschke gesprochen hast und in der Gaststätte Krone warst? Schließlich mischst du dich in seinen Fall ein. Das könnte Ärger geben.«
»Ja, das könnte es.« Barnaby Kern stand auf. »Ich werde es gleich machen, damit es nicht von hinten an ihn herangetragen wird.«
Er traf Hauptkommissar Günter Moebus in seinem Dienstzimmer in einer Besprechung mit den Kommissaren Leistner und Carmen Jacobi. »Ich will dich nicht stören, Günter, aber ich habe mit dir etwas zu besprechen.«
»Komm doch rein!«
»Nein, nein. Unter vier Augen.«
Moebus erhob sich demonstrativ und sagte: »Wir sind ohnehin fertig.« Carmen Jacobi und Fritz Leistner standen auf. Die Frau nickte Kern noch einmal zu und lächelte. Dann gingen sie aus dem Zimmer.
»Hast du ihn geknackt?«, fragte Barnaby Kern, als die beiden Kommissare gegangen waren.
»Nein. Ich musste ihn laufen lassen. Das Alibi scheint wasserdicht zu sein. Wir prüfen noch.«
»Ich will mich nicht in deinen Fall einmischen, Günter«, sagte Kern. »Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit diesem Kerl etwas nicht stimmt. Er ist schmierig in seinem Aussehen und aalglatt in seinen Antworten. Er versucht, mit uns zu spielen.«
»Das tut er wohl. Und er ist recht erfolgreich.”
»Ich war vorhin draußen bei der Kneipe in Blasewitz, die Vester genannt hat, und habe anschließend mit einem ehemaligen Anwalt gesprochen, der ganz in der Nähe wohnt.«
Moebus atmete schwer durch. Es war ihm anzumerken, dass ihm das nicht passte. Er kannte Kern schon seit vielen Jahren. Sie waren zwar nicht befreundet, schätzten sich aber gegenseitig. Deshalb sagte er wohl nichts.
»Ich sage dir das, weil ich keinen Streit zwischen uns will. Andererseits möchte ich mir doch gern ein Bild von dem Mann machen.«
»Warum?«
»Weil man immer etwas dazulernen kann. Ich habe schon allerlei erlebt und dachte, es könne mich nichts mehr überraschen. Betrüger, Päderasten, Mörder, Zuhälter und Geldwäscher. Alle haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen. Und keinem ist es letztlich gelungen. Thomas Vester ist von einer Schmierigkeit, die ich sonst nur bei Politikern kennengelernt habe.«
»Na, na …«
»Dass du ihn laufen lassen musstest, ist der beste Beweis da-für.«
Als sie sich trennten, war für Kern klar, dass er sich künftig aus den Ermittlungen zu Vester heraushalten würde. Auf dem Weg erinnerte er sich an den Rat eines jüngeren Kollegen. Sie hatten sich vor zwei Jahren in Berlin getroffen, wo Barnaby Kern Gastvorlesungen an der Freien Universität gab. Lasse Larsson war Mitglied der siebten der acht Berliner Mordkommissionen, und der gab ihm bei einem Arbeitsessen einen Geheimtipp. »Ich lege für jeden Fall ein Piktogramm an. Andere nehmen eine große Tafel, auf der sie Verbindungen anlegen. Der Vorteil von den Piktogrammen ist, dass du erst einmal in aller Ruhe die Verbindungen der einzelnen Personen des Falles anlegen kannst, und mit jedem weiteren Tag, mit jeder weiteren Person kannst du das Piktogramm erweitern. Wenn du die Verbindungen mit Linien herstellst, bilden sich schnell die Handlungsabläufe heraus.«
Zuerst hatte Kern diesen Vorschlag belächelt. Jetzt aber legte er das Piktogramm an. Rechts fügte er Männchen ein, die er mit den Namen der Polizisten versah, links die Personen, die auch nur im Mindesten im Dunstkreis des Verbrechens angesiedelt waren. In der Mitte die Personen, die möglicherweise zur Aufklärung beitragen konnten. Als es bereits achtzehn Uhr war, schloss er das Piktogramm, gab dem ganzen Ordner ein Passwort, damit sich niemand über seine Gedanken zu diesem Fall lustig machen konnte, und begab sich auf den Heimweg. Während er zu seinem Wagen ging, dachte er an die Frau, mit der er seit einiger Zeit zusammenlebte.
Andrea Kappelhoff war alleinerziehende Mutter einer sechsjährigen Tochter. Sarah war wiederum ein verwöhntes Mädchen, der lange Zeit der Vater gefehlt hatte, den Kern jetzt ersetzte. Andrea arbeitete als Lektorin für einen westdeutschen Verlag von zu Hause aus. In Zeiten der elektronischen Möglichkeiten war das gar keine schlechte Sache. So konnte sie sich ihre Arbeitszeit frei einteilen und hatte entsprechend Zeit fair ihr Kind.
Barnaby Kern wohnte bei ihr außerhalb Dresdens in Weißig in einer nach der politischen Wende erbauten Siedlung in einer Doppelhaushälfte. Andrea meinte, sie wolle ihre Tochter nicht in der Stadt aufziehen. Sie hatte das Kind mit sechsundzwanzig bekommen, war jetzt zweiunddreißig. Das aber war der Punkt, der Barnaby Kern Sorgen machte. Er war zweiundfünfzig, und die zwanzig Jahre Unterschied gemahnten ihn zur Vorsicht. Das äußerte sich darin, dass er seine kleine Wohnung in der Kesselsdorfer Straße am entgegengesetzten Ende der Stadt behalten hatte. Andrea Kappelhoff hatte das als puren Unsinn bezeichnet.
Kern malte sich aus, wie es wäre, wenn er im Alter allein wäre. Doch dann verdrängte er schnell diesen Gedanken.