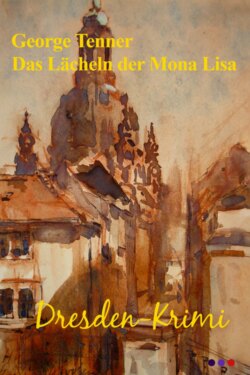Читать книгу Das Lächeln der Mona Lisa - George Tenner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеDer neue Tag schien Barnaby Kern Recht zu geben, die Ermittlungsgruppe des LKA nicht alarmiert zu haben. Zuerst brachte Hauptkommissar Maximilian Slupinski den Bericht der Spurensicherung. Obwohl der Anblick in den Arbeitsräumen des Malers grauenvoll schien und er im ersten Augenblick geneigt war, an eine Verwüstungsorgie zu glauben, musste er sich revidieren. Die Schäden hielten sich in Grenzen. Die Bilder hätten zwar wild durcheinander auf dem Boden gelegen, aber nur ein einziges davon sei vorsätzlich zerstört worden. Slupinski legte ein Foto vor. Es zeigte eine zerstörte Lithografie. Auf ihr war das Bildnis einer Frau sichtbar, deren Gesicht herzartig unter einem Hut hervorlugte. »Es sind zwei Dinge zerstört worden, die unmittelbar miteinander zu tun haben«, sagte Slupinski, »diese Lithografie und«, er legte ein zweites Foto auf den Tisch, »diese Druckplatte.« Als Barnaby Kern fragend die Schulter hob, ergänzte er: »Die Druckplatte diente zur Herstellung genau dieser Lithografie.«
»Und so eine Platte kann man so einfach zerbrechen?«
»Sie ist nicht aus Metall, Barny. Das Wort Lithografie kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Steinschrift. Die Technik wurde von Senefelder 1798 erfunden. Das Bild wird mit fetthaltiger Farbe auf den Lithografiestein aufgetragen, die Partien des Steins, die keine Zeichnung enthalten, werden so präpariert, dass sie keine Farbe annehmen. Meister der Lithografie waren Goya oder Géricault mit seinen imposanten Pferdebildern, Eugéne Delacroix, Daumier, der bekannte Impressionist Manet, Toulouse-Lautrec …«
»Das ist der mit den Cancan-Mädchen?«
»Richtig Barny, genau der. Bonnard und der Norweger Edward Munch – um nur die bekanntesten von ihnen zu nennen.”
»Wie lässt sich denn ein Stein so einfach zerbrechen?«
»In der Regel besteht dieser Stein aus kohlensaurem Kalk-schiefer. Wird er kräftig über eine Kante geschlagen, bricht er leicht auseinander. Es kommt auf die Stärke des Steins an.«
»Schön. Aber was schließt du daraus?«
»Nachdem ich alles analysiert habe, sämtliche Schäden, die rote Farbe an den Wänden, die so aufgebracht war, dass nicht wirklich etwas zerstört wurde, das Gesamtbild und die Tatsache, dass eine Briefbörse mit einer erheblichen Summe unangetastet blieb, obwohl diese nicht zu übersehen war, glaube ich, dass hier etwas vorgetäuscht werden sollte. Ich weiß nur nicht, was.«
»Wie viel war in dem Portemonnaie?«
»Achthundertzweiunddreißig Mark und vierundvierzig Pfennige. Und einige Münzen aus Polen«, sagte Slupinski, nachdem er in seine Unterlagen geschaut hatte.
»Vortäuschung einer Straftat.« Kern rieb sich das Kinn. »Wer kommt da infrage? Zum Beispiel der Stiefsohn des Malers, dieser Vester, der wie vom Erdboden verschwunden scheint?«
Kurz nachdem Slupinski wieder gegangen war, wählte Kern die Nummer der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und ließ sich mit Rechtsmediziner Dr. Johannes Bahrmann verbinden. Von ihm erfuhr er, dass Helmut Müller-Karsten eines natürlichen Todes gestorben war. Seine Diagnose lautete Tod durch Entkräftung. Allerdings habe der Mann aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches wahrscheinlich einige Tage ohne Hilfe auf dem Erdboden verbracht. Unfähig, sich fortzubewegen, war er praktisch verdurstet. Nur diese Tatsache wäre untersuchungswürdig.
Barnaby Kern war sich klar darüber, dass er bei Thomas Vester ansetzen musste. Das war der Schlüssel, um Klarheit über den Zustand des Fundortes zu erlangen. Mord schien nach erstem Augenschein ausgeschlossen. Nur wenn man dem Mann nachweisen könnte, dass er Müller-Karsten mit Absicht dort liegen gelassen hatte, ohne ihn zu versorgen, wäre das eine Straftat,
vielleicht sogar vorsätzlicher Mord. Und was die Unordnung, die Zerstörung des Bildes und des Drucksteins anging, daraus ließ sich keine Straftat konstruieren, die mit einem nicht stattgefundenen Mord in Verbindung gebracht werden konnte. Aber wenn Thomas Vester diese Unordnung herbeigeführt hatte, wenn er voraussetzte, dass diese Unordnung von der Polizei in Augenschein genommen würde, dann wollte er eine Spur legen. Die Frage war, ob Vester, von dem die Putzfrau behauptete, er sei ein Trinker, intellektuell überhaupt in der Lage war, eine solche Tat zu begehen.
Mit diesem Gedanken verbrachte er an diesem Vormittag mehr Zeit als mit dem dringend notwendigen Papierkram, der sich beängstigend auf seinem Schreibtisch staute. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Und Luft brauche ich. Barnaby Kern beschloss, für einige Zeit hinunter zur Elbe zu gehen. Zehn Minuten später stand er auf der Brühlschen Terrasse. Der Wind wehte nur ganz schwach. Der blaue Himmel zeigte kaum ein Wölkchen. Hitze hatte sich schon breitgemacht.
Unterhalb der Brühlschen Terrasse waren die Liegestellen der Fahrgastschiffe. Die Dresden hatte gerade abgelegt und fuhr flussabwärts. Zischend fuhr der Dampf aus der Signalpfeife, gab einen krächzenden Ton von sich, der langsam klarer wurde. Der Dampf entwich in einer kleinen Wolke, bevor er sich ins Nichts auflöste. Das Schiff war in den Zwanzigerjahren gebaut worden und immer noch sehr schön. Kern liebte die historischen Dampfer mehr als die neuen, riesigen Schiffe, die aus anderen Ländern zum Besuch der Stadt für kurze Zeit hier anlegten. Einer dieser Riesenkästen lag direkt vor ihm. Die Swiss Coral zeigte die Flagge der Schweiz, Heimathafen Basel. Sicher war eine solche Flussfahrt interessant, und man konnte eine Menge sehen. Aber ebenso sicher war, dass diese Reisen verdammt teuer waren. Ein Hauptkommissar müsste eine ganze Zeit sparen, um sich einen solchen Luxus leisten zu können. Der kleine Luxus aber, die Fahrt mit einem der historischen Schiffe nach Wehten zum Schloss Pillnitz oder Rathen, war für jedermann erschwinglich.
Die Gedanken an den Kunstmaler, die Eindrücke und Fakten, die er gesammelt hatte, holten Barnaby Kern wieder ein. Eigentlich müsste er den Fall abgeben. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass Helmut Müller-Karsten eines natürlichen Todes gestorben war, gab es keinen zwingenden Grund für ihn, weiter zu ermitteln. Ein anderes Kommissariat wäre nunmehr für die Ermittlungen zuständig. Aber irgendetwas hielt ihn zurück, den Fall so schnell abzugeben. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Wenn dieser Thomas Vester tatsächlich ein trunksüchtiger Mann war, der nie Geld hatte, wieso fand sich dann bei der Durchsuchung ein Betrag von über achthundert Mark an? Wem gehörte das gefundene Geld? Dem Maler? Wenn der tatsächlich diesen Vester in seinem Atelier wohnen ließ, weil der Sohn seiner verstorbenen Frau nie über Geld verfügte, dann doch wohl kaum, indem er ihm noch eine Geldreserve in aller Heimlichkeit zuschob. Und selbst wenn er das gemacht hätte, wann hatte er das Geld im Atelier deponiert? Nach dem Sturz war das ja wohl kaum möglich. Und vor dem Sturz? Hätte es da Vester nicht mit auf die Reise genommen? Also hätte er es dem Vester möglicherweise oben in der Wohnung gegeben. Gut, vielleicht war es ja so. Aber warum lag es dann in diesem verwüsteten Raum?
Ein Mann auf einem Jetski fuhr schnell elbaufwärts, wendete vor der Carolabrücke und raste mit dem laut brummenden Gerät an der Anlegestelle der sächsischen Dampfschifffahrt vorbei bis zur Augustusbrücke, um dann abermals zurückzukommen. Offensichtlich interessierte er sich für die lange und für die Elbe mächtige Swiss Coral. Diese kleinen einsitzigen Dinger wären vor der Wende undenkbar gewesen. Aber es war schon erstaunlich, was die politische Veränderung alles in Gang gesetzt hatte.
Kerns Handy machte sich bemerkbar. Es war Thomas Lenz. »Einer der Bewohner des Künstlerhauses hat angerufen«, sagte er. »Thomas Vester ist nach Hause gekommen. Der Mann habe zufällig aus dem Fenster geschaut, als Vester aus einem Auto stieg.«
»Schick einen Streifenwagen hin, und lass den Mann holen.«
»Schon geschehen.”
Barnaby Kern unterbrach die Verbindung, warf noch einen langen Blick auf das herrliche Elbflorenz-Panorama und machte sich auf den Rückweg zur Schießgasse. Es war kurz vor Mittag. Er ging zur Kantine. Wenn ich jetzt nicht auf die Schnelle einen Happen zu mir nehme, kann es sein, dass ich überhaupt nicht mehr zum Essen komme. Er war glücklich, dass er in der Schlange seine Kollegin Silke Fritsche aus seinem Kommissariat ausmachen konnte. Er ging zu ihr, bat sie, ihm etwas leicht Verdauliches mitzubringen. Sie wusste um seinen nervösen Magen und deutete auf den Reis mit Hühnerfrikassee. Kern nickte und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz.
»Da haben Sie wieder einmal Glück gehabt, Hauptkommissar, dass Sie jemanden gefunden haben, der Sie bedient.« Sie lächelte ihn freundlich an und stellte das Tablett mit dem Hühnerfrikassee vor ihm ab.
»Auf die Frauen in meiner Truppe ist doch immer Verlass«, konterte Barnaby Kern. Lustlos begann er, in dem Essen herum zu stochern.
»Schon gehört, Thomas lässt diesen Vester gerade holen. Ich habe den Computer noch einmal strapaziert. Es gab mal eine Anzeige wegen Betrugs gegen den Mann.«
»Haben Sie den Vorgang ausgedruckt?« Barnaby Kerns Interesse war augenblicklich geweckt.
»Ja. Aber Sie werden enttäuscht sein. Ein Mann hatte ihn an-gezeigt, er habe etwas über hundert Ostmark unterschlagen, die sie gemeinsam vertrunken hätten. Auf Befragung sagte der Beklagte, er könne sich nicht mehr an einen solchen Vorgang erinnern. Schließlich hätten sie über Stunden den Geburtstag des Klägers gefeiert. So stand Aussage gegen Aussage. Und die Summe schien dem Gericht zu unbedeutend, um eine große Sache daraus zu machen. Vester sollte dem Kläger die Hälfte des Geldes, also fünfzig Mark, zurückzahlen.«
»Peanuts«, sagte Barnaby Kern enttäuscht. »Sonst nichts?«
»Da war irgendetwas mit Hehlerei. Aber auch da konnte ihm nichts nachgewiesen werden.”
»Peanuts, alles Peanuts.« Er schob angewidert seinen Teller weg. »Ich muss jetzt«, sagte er, legte einen Fünfmarkschein auf den Tisch, lächelte der Frau noch einmal zu und ging, noch ehe er den Protest bezüglich der Überzahlung des Essens entgegennehmen konnte.
Als er in das Büro der Kommissare kam, empfing ihn Thomas Lenz mit den Worten: »Der Vester ist gerade eingetroffen. Ich habe ihn in den Vernehmungsraum bringen lassen.«
»Lass ihn noch einen Augenblick schmoren. Silke hat mir gesagt, es gäbe etwas über den Mann in den Akten.«
Lenz schob Barnaby Kern eine Handakte hin. »Das ist alles, was über den Mann aktenkundig ist.«
Der Hauptkommissar las, was Silke Fritsche ihm schon berichtet hatte und auch über die Hehlerei einer Musikanlage, die ihm aber letztlich nicht nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus gab es eine Notiz des Ministeriums für Staatssicherheit über die Einbindung des Mannes als informeller Mitarbeiter. Thomas Vester hatte eine dahin gehende Verpflichtung unterschrieben.
»Na endlich«, sagte Kern. »Endlich mal ein brauchbarer Hin-weis.«
Als Silke Fritsche in den Raum kam, sagte Barnaby Kern: »Das Wichtigste haben Sie mir unterschlagen, Frau Kommissarin, die Verpflichtung Vesters als IM bei der Staatssicherheit.«
Die Frau zwinkerte ihm zu und sagte: »Sie lassen einen ja nicht einmal zu Wort kommen, Herr Hauptkommissar. Als ich es Ihnen sagen wollte, waren Sie schon wieder auf dem Weg ins Büro. Offensichtlich haben Sie Angst, etwas zu verpassen, und das Essen haben Sie auch stehengelassen.« Sie kam zu ihm und gab ihm den Rest des nicht verbrauchten Essengeldes.
Wenig später standen sie hinter der durchsichtigen Scheibe zum Vernehmungsraum. Der Mann, der an dem Tisch saß, rauchte, und so wie er rauchte, wirkte er nervös. Er war relativ klein, dunkelhaarig und ungepflegt. »Was hältst du von der Person, Thomas?«
Lenz hob die Schultern. »Ich sehe, was du siehst, Barny. Und das lässt sich nur mit einem eingedeutschten Wort beschreiben: Loser!«
Die beiden Kommissare gingen in den Vernehmungsraum. Während sich Thomas Lenz an die Seite neben den Beamten stellte, der auf Vester aufzupassen hatte, setzte sich Barnaby Kern an den Vernehmertisch und schaltete das Diktafon ein.
»Machen Sie bitte die Zigarette aus. Hier wird nicht geraucht.« Kern wendete sich zu dem Obermeister des Fachdienstes Gewahrsam und rügte, dass er das Rauchen gestattet hatte. Dann drehte er sich dem Mann zu, der dabei war, die Glut der Zigarette zwischen den Fingern auszudrücken und den Stummel mangels eines Aschenbechers in die Tasche steckte.
»Freitag, der 15. Juli 1994«, sagte Barnaby Kern. »Vernehmung des Thomas Vester in der Angelegenheit des Ablebens des Kunstmalers Helmut Müller-Karsten und des mutmaßlichen Einbruchs in dessen Atelier.«
»Ihr Name?«
»Vester, Thomas.«
»Sie wohnen?«
»Pillnitzer Landstraße 57 bis 59.«
»Ist es ein besonderes Haus?«
»Sie wissen doch, dass es das Künstlerhaus ist.«
»Ah, Sie sind Künstler.«
Als Vester nichts sagte, fragte Barnaby Kern: »Was ist Ihre Tätigkeit?«
»Ich bin Lithograf.«
»Lithograf? Also Steindrucker? Das ist, soviel ich weiß, ein Ausbildungsberuf.«
Thomas Vester hob die Schultern und machte ein verblüfftes Gesicht.
»Ein Ausbildungsberuf ist ein Beruf, dessen Ausbildungsinhalt und -dauer gesetzlich geregelt sind. Die Ausbildung oder die
Lehre besteht in der Regel entweder aus praktischer Ausbildung im Betrieb, ergänzt durch Unterricht an einer Berufsschule, oder findet an Berufsfachschulen statt. Welche der unterschiedlichen Möglichkeiten trifft für Sie zu?«
»Keine.«
»Keine? Ich verstehe Sie nicht.«
»Ich bin Autodidakt«, sagte Thomas Vester.
»So, Autodidakt. Also Laie.«
»Ich ziehe den Begriff Selfmademan vor.«
»Selfmademan.« Genüsslich langsam ließ der Hauptkommissar dieses Wort auf der Zunge zergehen, während er daran dachte, dass dieser Loser versuchen würde, seine Tätigkeit so aufzuwerten, dass seine Kenntnisse und die damit verbundenen Tätigkeiten glaubhaft erschienen.
»Sie brauchen es nicht ins Lächerliche zu ziehen. Ein Autodidakt ist jemand, der außerhalb des üblichen Studienganges durch eigene Bemühung Bildung erworben hat, Kommissar.«
Barnaby Kern blätterte in dem Dossier über Vester, das Silke Fritsche aus dem Polizeicomputer gezogen hatte, und stellte fest: »Auch ein Selfmademan muss sich seine Erkenntnisse, die ihm die Befähigung zur Ausübung des Berufes geben, ja irgendwo herholen.«
Vester nickte. »So ist es.«
Kern schaute Thomas Lenz fordernd an und lächelte, als er Vester fragte: »Haben Sie Ihre Erkenntnisse bei den Saufgelagen mit Martin Hild erhalten, der Sie wegen Betrugs anzeigte?«
Vester schien seine Ruhe wiedergefunden zu haben, als er antwortete: »Sie wissen genau, Kommissar, dass das Verfahren wegen fehlender Beweislage eingestellt wurde. Wir hatten zusammen Geburtstag gefeiert, und es ist nun einmal üblich, dass ein Geburtstagskind einlädt. Wer die Einladung ausgesprochen hat, zahlt. Und dass wir ein wenig über den Durst getrunken hatten … Na ja, ist Ihnen das noch nicht passiert?«
»Nun ist es aber so, dass das Gericht Sie dazu verdonnert hat, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Also war es kein astreiner Freispruch, sondern eher der Geringfügigkeit zu verdanken, dass man das Verfahren damit beendet hat.«
»Wie auch immer. Daraus lässt sich kein Strick drehen, an dem Sie mich aufknüpfen können.«
»Nein.« Kern blätterte in der Akte, als müsse er nachlesen. Der Mann vor ihm war zwar schmierig und sicher nur bedingt kultiviert, aber nicht ohne eine gewisse Intelligenz. Intelligenz und Bildung sind zwei unterschiedliche Dinge. Die flüssigen, widerlegenden und durchaus plausiblen Antworten, die der Mann gab, waren nicht die eines Dummen. Vielmehr ließen sie zwar auf eine beschränkte Bildung, nicht aber auf einen fehlenden Verstand schließen. »Was war eigentlich mit der Pioneer-Anlage, die Sie unter die Leute bringen wollten und die, nachgewiesener Weise, aus einem Einbruch stammte? Sind Sie ein Hehler?«
»Ich habe das Ding, ebenfalls nachgewiesener Weise, auf dem Flohmarkt am Körnerplatz gekauft, zusammen mit ein paar Stücken Meißner Porzellan.«
»So ganz eindeutig geht das hier nicht hervor. Dafür gibt es eine unterschriftliche Erklärung von Ihnen, künftig als informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit …«
Thomas Vester lachte laut auf. »Wenn Sie alle, die einmal diesen Wisch unterschrieben haben, ans Kreuz nageln wollen, haben Sie Mühe, einen Platz zu finden, der groß genug dafür wäre.
Ja, so war das wohl, dachte Barnaby Kern. Aber diese Burschen haben dafür gesorgt, dass die Hehlerei unter den Ladentisch fiel. »Wie bekamen Sie Kontakt zur Staatssicherheit?«
»Ein Mann namens Josef Gretschko, der zuständig für den Export von Kunst der DDR war, stand in Verbindung zu den Künstlern. Er bezog sich auf Josef Hegenbarth, dessen Bilder auch im Westen gezeigt wurden. Er kam zu uns ins Atelier, und er versprach, ein paar Bilder Helmut Müller-Karstens für eine Ausstellung nach Stuttgart freizugeben. Einige Tage später wurde ich in der Straßenbahn von einem Mann angesprochen, der mich in eine Wohnung nach Dresden-Neustadt brachte. Das Haus in der Timaeusstraße hatte eine Wohnung, in der die Wände rosa gestrichen waren. An der Wand hingen ein Bild des Staatsrates und eines von Minister Mielke. An den Wänden liefen irgendwelche Telefondrähte lang. Im Durchgangszimmer stand eine Tischtennisplatte. Als wir kamen, spielten dort zwei Männer Tischtennis, ein weiterer schaute gelangweilt zu.«
Barnaby Kern notierte sich den Namen Josef Gretschko und fragte: »Sie meinen, es war eine konspirative Wohnung?«
Thomas Vester hob die Schulter und machte ein vielsagendes Gesicht.
»Kommen wir auf Ihre Ausbildung zum Lithografen zurück.« »Aber gerne doch, Kommissar. Was genau wollen Sie wissen?«
»Wo Sie diese Fähigkeit erlernt haben.«
»Mein Stiefvater Helmut Müller-Karsten, der ja ein nicht ganz unbekannter Dresdner Maler und Lithograf war, hat mir diese Fähigkeit beigebracht. Und die nötige Begabung dazu hatte ich seit meiner Kindheit praktisch mit der Muttermilch eingesogen.«
»Der Maler führte Sie also an die Technik heran?«
»Die ich so beherrschte, dass ich das Drucken für ihn über-nahm. Die Bilder entstanden nahezu immer in Kooperation. Ein Litho von Helmut Müller-Karsten und mit dessen Unterschrift wertvoll gemacht, war allezeit auch ein Teil von Thomas Vester.«
»Sie haben Lithos von Müller-Karsten verkauft?«
»Natürlich. Er war nicht mehr so gut zu Fuß und beauftragte mich, die Bilder unter die Menschen zu bringen.«
»Unter die Menschen?«
»An Galerien meist.«
»Meist?«
»Ich kannte auch einige Sammler, die direkt kauften.«
»Auch an Falconettis Galerie?«
»Natürlich, auch an Falconettis, Giovanni Fuoli war immer ein aufgeschlossener Abnehmer, und an die Galerie Kühl.«
»Wenn Sie die Bilder zusammen herstellten, soll das dann heißen, Sie reklamierten immer fünfzig Prozent der eingenommenen Summe für sich?”
»Nicht immer fünfzig Prozent, aber einen Teil davon. Es war keine Summe ausgemacht. Er gab mir freiwillig, was er wollte.«
»Und was Sie brauchten, um zu überleben. Warum hausten Sie im Atelier von Müller-Karsten?«
»Wohnte, Herr Kommissar. Ich wohnte dort, weil Wohnungen zu DDR-Zeiten knapp waren. Ein einzelner Mann hatte kaum eine Möglichkeit, eine angemessene Wohnung für sich zu bekommen. Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, meine gemeinsame Arbeit mit meinem Stiefvater intensiv zu betreiben.«
Barnaby Kern dachte daran, wie schwer es damals tatsächlich war, eine vernünftige, zentralbeheizte Wohnung zu bekommen. Er konnte sich aber für seine Person nicht vorstellen, bis zum neunundvierzigsten Lebensjahr mit seinen Eltern zusammen gewohnt zu haben. Auch wenn die Wohnung noch so bescheiden gewesen wäre, er hätte das kleinste Zimmer genommen, nur um eigenständig zu leben. Was also war es, das Vester davon abgehalten hatte, diesen Weg zu gehen? »Wo waren Sie in den letzten vier Tagen?«, fragte Kern unvermittelt.
»In den letzten vier Tagen, warten Sie. Vor vier Tagen war Montag, der 11. Juli. Ich bin am 9. Juli nach Bischofswerda gefahren. Meine Mutter hat dort ein Grundstück von meinem Großvater geerbt.«
»Wie hieß Ihre Mutter mit Geburtsnamen?«
»Ursula Reseigennak.« Thomas Vester grinste den Kommissar herausfordernd an und sagte: »Lesen Sie den Familiennamen einmal rückwärts!«
Barnaby Kern schrieb den Namen auf und las ihn so, wie ihn der Mann aufgefordert hatte, es zu tun.
»Sie sind ein Spaßvogel, Vester. Wie also hieß Ihr Großvater wirklich?«
»Reseigennak. Er war Fabrikant.«
»Wie sind Sie gefahren? Mit dem Auto?
»Mit der Bahn.”
»Waren Sie allein in Bischofswerda?«
»Zuerst ja.«
»Zuerst ja. Lassen Sie sich nicht jeden Satz aus der Nase ziehen.«
»Ich war mit der Bahn hingefahren, weil ein Bekannter am
Sonnabend noch arbeiten musste. Er kam dann am Sonntag mit dem Auto nach.«
»Wie hieß der Bekannte?«
»Martin Hild.«
Kern blätterte zurück. Hild war der Mann, der Vester wegen Unterschlagung der hundert Ostmark angezeigt hatte. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, dachte er. »Hild?«
»Ich weiß, was Sie jetzt denken, Kommissar. Aber man muss auch verzeihen können.«
»Kam er allein?«
»Ja. Derzeit hat er keine Freundin.«
»Und Sie? Haben Sie eine Freundin?«
Die Frage kam so schnell, dass Vester überrumpelt war. »Ich, ich … hatte eine Freundin. Es ist schon Jahre her. Aber als sie starb, habe ich mir vorgenommen, mit keiner Frau mehr zusammenzuleben.«
»Warum? Warum nahmen Sie sich das vor?«
»Weil es keine so selbstlose Frau mehr geben wird. Und ich möchte die guten Erinnerungen an sie behalten.«
»Wie hieß die Frau?«
»Viola Tillack. Ich habe eine Zeit lang mit ihr zusammen-gewohnt.«
Barnaby Kern notierte sich den Namen der Frau und fragte: »Woran ist Viola Tillack gestorben?«
»Es war ein Straßenbahnunfall. Sie war nicht auf der Stelle tot, verstarb aber in der Nacht nach dem Unfall, ohne das Bewusstsein noch einmal erlangt zu haben.«
»Das ist traurig«, stellte Barnaby Kern fest. »Aber warum hatten Sie beschlossen, keine Verbindung mehr einzugehen? Schließlich geht das Leben doch weiter.«
»Weil sie meiner Mutter so ähnlich war und ich eine solche Frau niemals mehr finden werde.”
Kern schrieb sich als Notiz: Verhältnis zur Mutter, Mutter-komplex? Und die Frage: Ist er homosexuell? Das hätte zwar keine unmittelbaren Einflüsse auf seine Ermittlungsarbeit, würde aber die Persönlichkeit des Mannes in seinen Augen anders beleuchten. Vester spielte hier den starken Mann, der auf alles eine klare Antwort geben konnte. Kern war sich sicher, dass er täuschte. Nach allem, was er bisher von ihm wusste, musste er annehmen, dass er ein eher schwacher Charakter war. »Sie mochten Ihre Mutter sehr?«
»Sollte ein Sohn die Mutter nicht ehren und lieben?«
»Oh doch, das sollte er in jedem Fall. Kommen wir noch ein-mal zurück zu Viola Tillack. War sie jünger als Sie?«
Thomas Vester sah den Kommissar mit gespielter Verblüffung an. »Älter. Aber was macht das, wenn man Vertrauen zueinander hat?«
Wieder machte sich Kern eine Notiz. Er wollte sich genau erinnern, wenn er den Mann, der vor ihm saß, einschätzen wollte. »Nichts. Gar nichts. Es kommt nicht allein auf das Alter an, sondern auf das gegenseitige Verstehen, auf Vertrauen – so wie Sie es gesagt haben – und letztlich auf Freundschaft oder Liebe. Was war es bei Ihnen? Freundschaft oder Liebe?«
»Ich denke, es war eine wunderbare Freundschaft.«
»Keine Liebe?«
»Sie werden es vielleicht nicht glauben, Kommissar, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt liebesfähig bin. Ich denke, eher nicht.«
»Sie meinen, Sie wissen nicht, ob Sie zeugungsfähig sind?« Thomas Lenz machte Anstalten, den Raum zu verlassen, und Kern gab dem Schutzpolizisten zu verstehen, dass er mit Lenz zusammen gehen solle. Als die beiden Männer draußen waren, fragte Kern: »Haben Sie Probleme, mit einer Frau zu schlafen?«
Es dauerte einen Augenblick, bis Vester verstand, was der Hauptkommissar von ihm wollte.
»Sie fragen mich nicht etwa, ob ich homosexuell bin?«
»Finden Sie an der Frage wirklich etwas Ungewöhnliches, Herr Vester?«
»Das haben mich früher die Burschen vom Geheimdienst auch gefragt«, sagte er.
»Und was haben Sie ihnen geantwortet?«
Vester war zum ersten Mal während der Vernehmung unsicher. »Steht das nicht in Ihrer schlauen Akte?«
»Nicht direkt. Aber ich möchte trotzdem wissen, was Sie den Burschen vom Geheimdienst damals gesagt haben.«
»Sie wissen, dass in der DDR Homosexualität nicht gern gesehen war.«
»Ich erinnere mich, dass man zumindest männliche Homosexuelle anders anfasste als andere Straftäter.«
»Ich sagte, ich sei normal. Als ich Viola kennenlernte …«
»Wie lernten Sie Frau Tillack kennen?«, unterbrach Kern.
»Sie kam ins Atelier. Nicht jeder wurde bei Helmut Müller-Karsten vorgelassen. Wer nicht angemeldet und akzeptiert war, konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen. Aber Viola hatte eine Empfehlung eines Maler-Kollegen meines Stiefvaters. Und sie war interessiert daran zu erfahren, wie eine Lithografie entsteht. Also zeigte ich es ihr. Helmut«, er verbesserte sich, »… mein Stiefvater hatte nichts dagegen.«
»Na ja, vielleicht dachte er, jetzt schafft unser Thomas den Absprung.«
»Das hätte meine Mutter niemals zugelassen.«
Wieder der Hinweis auf die Mutter, dachte Kern. »Aber sie erkannten Ihre Chance, als Viola Tillack Interesse zeigte.«
»Sagen wir mal so – wir mochten uns.«
»Wann war der Unfall?«
»Im September 1978.«
Kern fügte diese Information seinen Aufzeichnungen zu. »Wusste Frau Tillack von Ihren Neigungen?«
»Ja.«
»Trotzdem gab sie Ihnen ein Zuhause … Finden Sie das normal?«
»Wir verkehrten auf einer anderen, auf einer geistigen Ebene miteinander.«
Was war an dem Mann dran, dass eine Frau sich für dieses Individuum interessierte, dachte Kern. Aber so sehr er sich auch mühte, er konnte keine Erklärung dafür finden. »Kommen wir zurück auf Bischofswerda. Herr Hild kam also am Sonntag mit dem Auto.«
»So war es.«
»Was machten Sie dann?«
»Wir fuhren in der Nacht mit dem Auto nach Frankfurt. Martin hatte dort einen Bekannten, den wir besuchen wollten.«
»Na ja, von Bischofswerda nach Frankfurt ist es ja nicht allzu weit.«
»Frankfurt am Main, Herr Kommissar«, sagte Vester belehrend.
»Nach Frankfurt am Main? Das sind ja einige Stunden Fahrt.«
»Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Und als wir am Vormittag ankamen, gab es den Freund nicht mehr und das Lokal auch nicht.«
»Es war ein einschlägiges Lokal. Deshalb sind Sie also nach Frankfurt gefahren?«
»Ja. Das Lokal hieß Rote Katze. Man hatte es geschlossen, als die erste Aids-Welle in Frankfurt Hinweise auf den Ansteckungsort gab. Das war Anfang der Achtzigerjahre.«
»Anfang der Achtzigerjahre. Wieso kannte Hild einen Mann aus Frankfurt am Main? Durfte er denn in den Westen reisen?«
»Hild hatte eingesessen. Der Bekannte, der wegen Beihilfe zur Flucht aufgeflogen war, ebenfalls.«
»Dann waren Sie also am Montag in Frankfurt, stellten fest, dass es weder den Bekannten Hilds noch dessen hochgelobte Rote Katze gab, und was machten Sie dann?”
»Für mich war es das erste Mal, dass ich Dresden verlassen hatte, um den Westen kennenzulernen. Also fuhren wir nicht auf direktem Weg auf der Autobahn zurück. Am ersten Tag fuhren wir nach Aschaffenburg. Wir sahen uns das Renaissanceschloss Johannisburg an, die Staatliche Gemäldegalerie und die Stiftskirche aus dem 12. und 13. Jahrhundert.«
Hauptkommissar Barnaby Kern schaute zur Uhr. Inzwischen war es Spätnachmittag geworden, und die meisten seiner Kollegen waren ins verdiente Wochenende unterwegs. Thomas Lenz würde noch hinter der Scheibe im Nebenraum sein und die Vernehmung beobachten. Einen Augenblick streifte ihn der Gedanke, dass Lenz ein zuverlässiger Partner war, auf den er ungern verzichtet hätte. Wie lange arbeiteten sie schon zusammen? Fünf, sechs, nein, es mochten schon sieben Jahre sein.
»In Aschaffenburg zu schlafen, wäre zu teuer geworden. Also suchten wir uns eine kleine Pension auf dem Land. Hösbach hieß der Ort. Hild hat bestimmt die Quittung für die Übernachtung. Es lässt sich für Sie leicht nachprüfen, dass wir dort waren.«
Kern machte sich eine Notiz zur Befragung Hilds und die Abforderung der Übernachtungsquittungen, die er für Montag veranlassen würde.
»Am Dienstag fuhren wir nach dem Ausschlafen weiter über Land bis Schweinfurt«, fuhr Vester fort.
»Warum Schweinfurt?«
»Da interessierte uns das 1570 erbaute Renaissancerathaus, die spätromantische Johanniskirche und das Städtische Museum. Wir übernachteten in Baunach nahe der Autobahn. Am Mittwoch besuchten wir Bayreuth, dessen Stadtbild stark in der Barockzeit geprägt wurde. Seit 1876 finden dort die Bayreuther Festspiele statt. Der Sachse Richard Wagner hat es 1872 gegründet. Die Wagner-Dynastie herrscht noch heute über die Festspiele und den Grünen Hügel. Donnerstag ging es über die Autobahn zurück nach Dresden. Da wir spät ankamen, blieb ich bei Hild, der mich heute nach Hause fuhr, wo ich die Bescherung sah. Man hatte einfach meine Wohnung versiegelt. Wie, so frage ich Sie, soll ich zu frischer Wäsche kommen, wenn ich vor verschlossener Tür stehe?«
»Wobei wir wieder beim Kernpunkt der Befragung wären«, sagte der Hauptkommissar. »Haben Sie das Unheil im Atelier Müller-Karstens verursacht, bevor Sie gefahren sind?«
»Unfug. Was für ein Unheil? Warum sollte ich das tun?«
Barnaby Kern bemerkte eine kleine Unsicherheit seines Gegenübers, die er noch nicht richtig zu deuten wusste. »Weil ein Einbrecher weniger an der Zerstörung eines Bildes und einer Druckplatte interessiert wäre als an dem Geld, das unangetastet war.«
Thomas Vester hob die Schultern: »Woher soll ich das wissen, wer dort das Geld vergessen hat.«
»Was mich wundert, ist, dass Sie, der Sie immer in Geldnot waren, mehr als achthundert Mark liegen lassen. Irgendetwas ist hier faul. Oberfaul!«
»Wer behauptet, dass ich immer in Geldnot war? Das ist schlichtweg eine Lüge.«
»Warum ist das eine Lüge?«
»Ich sagte Ihnen schon, dass Helmut Müller-Karsten immer geteilt hat.«
»Und wenn Ihnen das nicht reichte?«
»Dann gab es meine Mutter, die im Besitz einer ganzen Reihe von Bildern Müller-Karstens war. Sie verkaufte dann einige und gab mir, was ich brauchte.«
Diese Aussage bestätigte Kern die Einlassung der Frau Färber zu diesem Thema. »War es Ihr Geld, das gefunden wurde?« »Natürlich.«
»Wie viel war es genau?«
»Ich weiß es nicht mehr.«
»Wie sah die Geldbörse denn aus?«
Vester überlegte, und da er selbst nur über eine alte, kunstlederne Geldbörse verfügte, die er aber meist nicht mitnahm, weil er sich angewöhnt hatte, das Geld lose in der Tasche zu haben, beschrieb er dem Hauptkommissar eben diese Börse.
Barnaby Kern schaute auf das Foto, das Maximilian Slupinski von der Geldbörse gemacht hatte. Es war eine lederne, schwarze Tasche mit überlappendem Verschluss, wie ihn die Kellner im Hosenbund zu tragen pflegten. Offensichtlich pokerte Vester jetzt um das Geld, von dessen Existenz er bis heute keine Ahnung zu haben schien. »Worin hat Ihr Stiefvater eigentlich Geld aufbewahrt?«, fragte er abrupt.
»Gar nicht. Er hatte kein Gefühl für Zahlungsmittel. Die waren ihm egal.«
»Aber er brauchte doch Geld.«
»Für die Finanzen war meine Mutter zuständig. Sie sagte ihm rechtzeitig, wann das Geld alle war, und Müller-Karsten arbeitete wieder einen Tag konzentriert. In diesen Schaffensperioden malte er manchmal bis zu fünf Aquarelle an einem Tag, um dann wieder wochenlang nichts zu tun. Er war eben ein echter Künstler, im Leben wie im Schaffen.«
»Wo hat Ihre Mutter das Geld aufbewahrt?«
»In einer Kellnertasche.«
»In einer Kellnertasche … In einer schwarzen Kellnertasche?« »Ja.«
»Nun ist Ihre Mutter ja seit fast einem Dreivierteljahr tot. Wo befand sich die Tasche in dieser Zeit?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Sie haben die Tasche nach dem Tod also nicht an sich genommen?«
»Nein.«
»Helmut Müller-Karsten war schlecht zu Fuß, sagten Sie. Wer hat für ihn eingekauft?«
»In der Regel Frau Färber, oft auch ich.«
»Da musste er Ihnen doch Geld geben, um einkaufen gehen zu können.«
»Sie vergessen, dass ich es war, der die Bilder an den Mann brachte und einen Teil des Geldes zum Wirtschaften einbehielt.”
Barnaby Kern notierte sich, dass Vester Geld zurückbehielt. Er würde Frau Färber befragen, woher sie das Geld bezogen hatte, um einkaufen zu gehen, und wer sie letztlich für ihre Arbeit entlohnte. Er stand auf, um kurz in den Raum hinter der Scheibe zu gehen. An der Tür angekommen, drehte er sich um und fragte: »Man hat ein Bild …«, er verbesserte sich, »eine Lithografie zerstört und eine Druckplatte aus Stein.«
»Das Lächeln der Mona Lisa », entfuhr es Vester.
»Woher wissen Sie das, wenn Sie nicht dort waren, nachdem die Verwüstung stattgefunden hat?«
Vester lachte. »Es gibt augenblicklich nur einen bearbeiteten Stein im Atelier. Er war zur Herstellung eben dieses Bildes gedacht. Es zeigt meine Mutter in jungen Jahren. Steine, mit denen wir nicht mehr arbeiteten, hatten wir ausgelagert.«
Barnaby Kern ging durch die Tür in den Raum, in dem Thomas Lenz die ganze Zeit gesessen hatte und dem Gespräch gefolgt war. Schweigsam ging er an die Scheibe und beobachtete Vester, der seinerseits auf die Spiegelscheibe stierte, wohl wissend, dass man ihn beobachtete.
»War er es?«, fragte Thomas Lenz.
Kern hob die Schultern. »Er ist schwer zu fassen. Vielleicht ist er ein Psychopath mit einer schweren Persönlichkeitsstörung. Das wäre nichts Neues. Die meisten Psychopathen kommen aus zerrütteten Familien. Sie sind aggressiv, auffallend angstfrei, unzuverlässig und impulsiv. Gefühle wie Schuld, Reue, Scham, Fürsorge, Einfühlung, Liebe scheinen bei ihnen zu fehlen.«
»Und nun?«
»Wir schicken ihn nach Hause und holen uns am Montag diesen Hild.« Die beiden Kommissare gingen wieder zum Vernehmungsraum. »Sie können jetzt gehen. Am Montag werden wir das Atelier öffnen«, sagte Kern. »Bis dahin müssen Sie woanders übernachten. Eine Frage habe ich noch. Wo sind Sie eigentlich zur Schule gegangen?«
»In Bischofswerda.”
»Aber Ihre Mutter lebte doch in Dresden.«
»Meine Großeltern haben mich aufgezogen. Ich bin erst später nach Dresden gegangen. Nach dem Tod meines Großvaters.«
»Bleiben Sie während der nächsten Woche in Dresden. Es kann sein, dass wir Sie noch einmal brauchen.« Barnaby Kern nickte Lenz zu. Der forderte Vester auf, ihm zu folgen, und brachte ihn zum Ausgang.