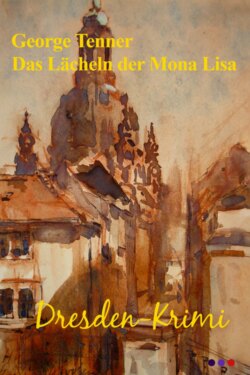Читать книгу Das Lächeln der Mona Lisa - George Tenner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеAm Montag, dem 18. Juli, schickte Barnaby Kern seinen Kollegen Thomas Lenz zusammen mit Silke Fritsche, um Martin Hild in dessen Wohnung in der Tzschimmerstraße in Dresden-Striesen zu befragen. Obwohl die Abteilung wie alle Abteilungen im Haus an Personalmangel litt, bestand er darauf, dass seine Beamten niemals allein in irgendeine Wohnung gingen. Zu gefährlich war das, falls man auf einen Menschen stieß, der unkontrolliert Gewalt anwendete. Ein in die Enge getriebener Verbrecher würde auch nicht vor dem Leben eines Polizisten Halt machen.
Als die beiden abgefahren waren, machte sich Kern daran, die Unordnung auf seinem Schreibtisch aufzuräumen und einen der unbearbeiteten Fälle abzuschließen. Obwohl er bemüht war, sich ganz seiner angefangenen Arbeit zuzuwenden, ging ihm die am Freitag stattgefundene Befragung des Thomas Vester nicht aus dem Sinn. Er fragte sich, ob der Mann, der auf die fünfzig zuging und durchaus nicht dumm zu sein schien, normal war. Bei all seiner Erfahrung musste er sich eingestehen, noch niemals in seiner Dienstzeit einen so außergewöhnlichen Fall gehabt zu haben. Fast zu jeder Zeit waren die Menschen einzuschätzen gewesen. Irgendwo gab es doch immer einen Schwachpunkt. Aber bei Vester war er sich nicht sicher. Wenn überhaupt, wo glitt dann das Normale des Mannes in die Anomalität über, dachte er. Genau das ist der Knackpunkt, der gefunden werden muss. Vester, darüber war er sich klar, war ein Grenzfall. Er rief sich die Inspizierung der Wohnung des Malers noch einmal ins Gedächtnis. Plötzlich regte sich in seiner Erinnerung, dass er bei der Aufnahme am Freitag kein Telefon gesehen hatte.
Sicher hatte er es nur nicht bemerkt, war mit anderen Wahrnehmungen beschäftigt. Er holte sich den Bericht Slupinskis hervor. So sehr er auch suchte, die Spurensicherung erwähnte auch kein Telefon. Kurz entschlossen rief er Slupinski an. Nach der allgemeinen Begrüßungsformel fragte er: »Habt ihr am Freitag den Anrufbeantworter des Malers abgehört? Mir ist das glatt durch die Lappen gegangen.«
Slupinski lachte. »Du wirst alt, Barny. Es gab kein Telefon.« »Bist du sicher?«
»Kein Telefon, Barny.«
»Kennst du heute noch Leute, die ohne Fernsprecher leben?«, fragte Barnaby Kern. »Nach der Wende hatten es doch alle eilig, so ein lausiges Ding zu bekommen, und so mancher hat sich dann mit seinen Handykosten finanziell total übernommen.«
»Ja. Aber der Müller-Karsten hatte kein Telefon. Kein Telefon und keinen Kühlschrank. »
Barnaby Kern bedankte sich. Als er aufgelegt hatte, machte er sich eine Notiz, um Vester danach zu fragen. Was habe ich noch vergessen? Mein Gott, ich habe ihn weder gefragt, ob ein Testament seiner verstorbenen Mutter vorlag, noch, ob der Maler eins hatte, dachte er. Das ist der Anfang von Alzheimer. Slupinkski hatte recht, er wurde alt.
Gegen elf kamen die beiden Kommissare von der Befragung des Zeugen Martin Hild zurück. Silke Fritsche legte eine Zellophantüte mit Übernachtungs- und Tankquittungen vor. Daraus ließ sich lückenlos der Weg von Bischofswerda nach Frankfurt am Main und zurück über die Landstraßen belegen. Es schien erwiesen, dass die beiden Männer dort waren, wie Thomas Vester es gesagt hatte.
»Wenn nun der Vester gar nicht mit in Frankfurt war und Hild ihm das Alibi gezielt besorgt hat?«, fragte Kern.
»Das halte ich für ausgeschlossen, Barny«, sagte Lenz. »Du verrennst dich da in etwas, was nicht so ist.«
»Ich wollte, du hättest recht.«
»Wir haben eine Zeugenaussage von ihm, und alles, was er sagte, klang glaubhaft. Trotzdem werde ich die Kollegen vor Ort bitten, das Alibi nachzuprüfen.”
»Gut.«
»Du hast am Freitag gesagt, du würdest Vester für einen Psychopathen halten«, sagte Lenz. »Auf deine Frage, ob er seine Mutter liebe …«
»Ich fragte, ob er seine Mutter sehr mochte, und er antwortete: ›Sollte ein Sohn die Mutter nicht ehren und lieben?‹ So war die Fragestellung. Und dann brachte ich seine Freundin, diese Tillack, ins Spiel.« Barnaby Kern nahm die Handakte mit den Notizen und blätterte darin herum. »Ah, hier. Ich sagte wörtlich auf seine Frage: ›Oh doch, das sollte er in jedem Fall. Kommen wir noch einmal zurück zu Viola Tillack. War sie jünger als Sie?‹ Und er antwortete: ›Älter. Aber was macht das, wenn man Vertrauen zueinander hat?‹ Ich sagte: ›Nichts. Gar nichts. Es kommt nicht allein auf das Alter an, sondern auf das gegenseitige Verstehen, auf Vertrauen – so wie Sie es gesagt haben – und letztlich auf Freundschaft oder Liebe. Was war es bei Ihnen? Freundschaft oder Liebe?‹ Und er sagte: ›Ich denke, es war eine wunderbare Freundschaft.‹ Ich fragte nach: ›Keine Liebe?‹ Antwort: ›Sie werden es vielleicht nicht glauben, Kommissar, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt liebesfähig bin. Ich denke, eher nicht.‹«
»Ja. Und was schließt du daraus?«
»Als wir ihn entließen, fragte ich noch, wo er zur Schule gegangen sei, und er sagte, er habe in Bischofswerda die Schule besucht, und seine Großeltern hätten ihn aufgezogen. Richtig?«
»Ja.«
»Ich vermute, der Mann hat eine Neurose, eine Störung aufgrund einer Fehlverarbeitung von Erlebnissen. Sie äußert sich in Angst, Verstimmung, Zwanghaftigkeit, in Kontaktschwäche, oft auch Einschränkung der Leistungsfähigkeit und vegetativen Störungen. Manchmal aber auch, indem sich derjenige gegen die Gefühle der Angst wehrt. Und dann wird er gewalttätig.«
»Denkbar wäre das durchaus«, stellte Thomas Lenz fest.
»Einer richtet seine Aggression gegen einen Menschen, ein anderer beispielsweise gegen ein Bild«, ließ sich Silke Fritsche vernehmen. Es war das erste Mal, dass sie das Wort ergriff, nachdem sie Kern die Zellophantüte mit den Quittungen gegeben hatte.
»Es gibt augenblicklich nur einen bearbeiteten Stein im Atelier. Er war zur Herstellung eben dieses Bildes gedacht. Es zeigt meine Mutter in jungen Jahren«, las Kern aus der Handakte.
»Vielleicht hasste der Mann seine Mutter«, sagte Lenz.
Kern klappte die Akte zu. »Der Grat zwischen Liebe und Hass ist verdammt schmal. In der Jugend hatte seine Mutter ihn, sagen wir einmal, aus Bequemlichkeit bei den Großeltern abgegeben.«
»Oder wegen der Unfähigkeit, ein Kind zu erziehen«, warf Silke Fritsche ein.
»Vielleicht auch aus beiden Gründen. Wie auch immer. Der Junge wächst mit allen Verwöhnszenarien der Großmutter auf, die natürlich bemüht ist, dem Jungen die fehlende Mutterliebe zu ersetzen. Sie will aus ihm einen jungen Mann machen, der im Leben besteht, und erreicht prompt das Gegenteil.«
»Allzu viel Gutmütigkeit ist Dummheit«, warf Silke Fritsche ein. »Das hat meine Oma immer gesagt.«
»Die Zeugin Färber hat ausgesagt, er sei lebensunfähig gewesen, hätte sich in den Alkohol geflüchtet. Die Mutter habe ihn mit Geld versorgt. Und die war es auch, die ihn im Atelier des Malers unterbrachte.« Barnaby Kern machte eine kleine Pause, legte den Finger der linken Hand an die Nase, so wie es seine Mitarbeiter von ihm kannten, wenn er darauf hinweisen wollte, dass er es förmlich riechen könne, und sagte: »Sie tat das nur, um ihn einigermaßen kontrollieren zu können, und kaschierte das mit der Hilfe für Müller-Karsten bei der relativ schweren Arbeit des Steindruckens.«
»Ja, so könnte es sein.”
»Ich wette eins zu hundert, dass es so ist«, sagte Kern nachdenklich. »Ich frage mich nur, wie er es zeitlich angestellt hat, die Verwüstung im Atelier zu inszenieren, gleichzeitig aber im rund vierzig Kilometer entfernten Bischofswerda aufzutauchen, nach Frankfurt am Main zu fahren, um dann nach vier Tagen seelenruhig zu uns zu kommen und den Entsetzten zu spielen.«
»Inszenieren ist das richtige Wort, Barny«, sagte Thomas Lenz. »Vielleicht hat er ja damit gerechnet, dass die Polizei das Tohuwabohu findet. Nein, vermutlich beabsichtigte er es. Möglicherweise war es ein Teil seines Planes.«
Kern öffnete noch einmal die Handakte und legte die Zellophantüte mit den Quittungen ein. Dann gab er Silke Fritsche das Dossier. »Machen Sie Kopien von den einzelnen Quittungen, und sorgen Sie dafür, dass die Originale zurückgegeben werden.«
»Was willst du machen?«, fragte Lenz.
»Ich werde die Unterlagen der zuständigen Abteilung geben und veranlassen, dass sie sich den Kerl noch einmal vorknöpfen. Wir haben andere Aufgaben.«