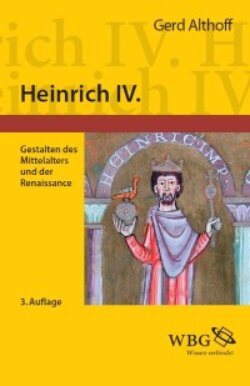Читать книгу Heinrich IV. - Gerd Althoff - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Rahmenbedingungen herrscherlichen Handelns im 11. Jahrhundert
ОглавлениеMan kann einem König des Mittelalters gewiss nicht gerecht werden, wenn man sich nicht über die Bedingungen Rechenschaft gibt, denen sein Handeln unterworfen war. Erst vor diesem Bedingungsgefüge werden ja individuelle Handlungsweisen eines Herrschers als solche erkennbar, wenn sie nämlich von den gängigen Mustern und Konventionen abweichen. Diese Konventionen für herrscherliches Handeln waren durchaus verschiedener Herkunft, denn sowohl die Kirche wie der Adel hatten es seit dem Frühmittelalter erreicht, dass die Herrscher den Erwartungen dieser ihrer wichtigsten Helfer in wesentlichen Fragen entsprechen und ihr Handeln an bestimmten Konventionen orientieren mussten, wenn sie nicht deren Unterstützung verlieren wollten. Abgeleitet waren diese Konventionen einmal aus den Erwartungen und Anforderungen, die die Kirche an Lebens- und Amtsführung eines christlichen Herrschers richtete;19 zum anderen resultierten sie aus dem Wertehorizont adligen Selbstverständnisses, das königlicher Machtentfaltung Grenzen setzte, weil es die Achtung der adligen Ehre und des Ranges als Basis der Zusammenarbeit einforderte.20 Zwischen beiden Vorstellungshorizonten bestanden Konkurrenzen und Divergenzen, die nicht immer einfach zu überbrücken waren. Es ist aber im Wesentlichen gelungen, die durchaus unterschiedlichen Wertvorstellungen von Adel, Kirche und den Königen selbst so in Einklang zu bringen, dass aus ihnen Spielregeln der Politik hervorgingen, die Herrschaft in geordneten und akzeptierten Bahnen und Verfahren möglich machten.21
Es ist jedoch kein einfaches Unterfangen, diese Konventionen zu verstehen, die nirgendwo zusammenhängend schriftlich fixiert, sondern als ungeschriebene Gewohnheiten praktiziert und tradiert worden sind. Diese Gewohnheiten existierten lediglich in den Vorstellungen der politisch handelnden Menschen, und es war gewiss nicht selbstverständlich, dass in jedem Einzelfall alle die gleichen Vorstellungen von adäquatem Verhalten besaßen. Dies bedeutet konkret, dass sich der Herrschaftsverband in bestimmten Verfahren immer wieder neu darüber verständigen musste, was der Herrscher im Einzelfall zu tun habe, welche Aufgaben und Pflichten aber auch die Mitglieder des Verbandes zu übernehmen und welche Rechte sie auszuüben hätten. Leitvorstellung in diesen Verfahren war, man müsse nur „finden“, wie man es früher oder schon immer gemacht habe. Dann handele man richtig, weil nach guter alter Gewohnheit.
Zum Verständnis dieser durchaus fremdartigen Vorgänge ist es notwendig, sich von einer Fixierung auf die Funktionsweisen des modernen Staates zu lösen und sich auf das einzulassen, was in der modernen Forschung „konsensuale Herrschaft“ genannt wird. Denn diese Form der Herrschaft ist gerade für das Hochmittelalter charakteristisch. In vielfältigen Formen von Beratung stellte man Einigkeit da rüber her, was zu tun sei.22 Dies geschah in einer mehr oder weniger dichten Folge von Hoftagen, zu denen sich die Großen des Reiches mit dem König trafen.23 Da sich die Gruppe dieser „Großen“ aus kirchlichen Würdenträgern und aus dem Laienadel zusammensetzte, darf man davon ausgehen, dass dem König aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven und Interessen Rat gegeben wurde. Und nichts wäre unangemessener, als sich solche Beratungen wie Vorgänge demokratischer Willensbildung vorzustellen. Königsherrschaft war aber im 11. Jahrhundert nicht denkbar ohne diese Beratung, deren Formen vielfältig waren und von der vertraulichen Vorklärung bis zur Inszenierung einer öffentlichen Beratung reichten, mit der längst Ausgehandeltes verbindlich beschlossen wurde. Über Fragen des Ranges und der Nähe zum König entschied sich, wer an solchen Beratungen beteiligt wurde. Dieser Stellenwert der Beratung in der königlichen Herrschaftspraxis ist vor allem deshalb bewusst zu machen, weil einer der häufigsten und nach dem Gesagten auch gravierendsten Vorwürfe gegen Heinrich IV. war, er habe sich nicht oder von den falschen Leuten beraten lassen.24
Konsensuale Herrschaft realisierte sich durchaus nicht nur in Beratung. Nachdem man durch mündlich-persönliche Verhandlungen zum Konsens gefunden hatte, wurde dieser nämlich rituell handelnd öffentlich zum Ausdruck gebracht. Die öffentliche Kommunikation des hochmittelalterlichen Herrschaftsverbandes kannte eine Fülle von demonstrativ-rituellen Handlungen, die eine wichtige Funktion erfüllten: Mit ihnen wurden komplexe Botschaften einer Öffentlichkeit, die vornehmlich aus Mitgliedern der Führungsschichten selbst und deren Vasallen bestand, vermittelt. Im Rollenspiel der Rituale machte der hochmittelalterliche Herrschaftsverband handelnd Absichtserklärungen mit hohem Geltungsanspruch, die zukünftiges Verhalten verbindlich in Aussicht stellten.25 Durch rituelle Handlungen wie Handgang oder Akklamation vollzog der populus die Anerkennung des neuen Königs; durch demonstratives Erweisen von Milde oder Barmherzigkeit zeigte andererseits der König, wie er Getreue zukünftig behandeln wolle, womit er den Anforderungen seines Amtes gerecht zu werden versprach. Rituelle Handlungen bei der Begrüßung wie im Verlaufe eines Hoftages brachten verpflichtend zum Ausdruck, dass man mit den bestehenden Verhältnissen und mit dem eigenen Platz in der Rangordnung einverstanden war. Dies Einverständnis sollte auch für die Zukunft gelten.
Mit rituellen Handlungen zeigte man andererseits auch, dass Friede und Eintracht getrübt waren und ein Konflikt drohte. Und mit rituellen Handlungen kehrte man schließlich vom Konflikt zum Frieden zurück, indem sich etwa ein Gegner dem König öffentlich zu Füßen warf und dieser ihm daraufhin durch Aufheben und Kuss verzieh und Frieden gewährte. Diese Art öffentlicher Kommunikation mittels Ritualen und rituellen Verhaltensmustern, für die der Herrschaftsverband viel Zeit aufwandte, ist daher ein zuverlässiger Indikator für den Zustand der Beziehungen innerhalb des Verbandes, und es ist von besonderem Interesse, welche Auswirkungen es auf diese rituellen Interaktionsformen hatte, als die Herrschaft Heinrichs IV. in eine Dauerkrise geriet. Oder allgemeiner formuliert: Was sagen die öffentlichen Rituale über den Zustand der Herrschaft Heinrichs IV. aus?
Die Analyse von rituellen Aussagen weist nachhaltig aber auch auf einen Wesenszug des hochmittelalterlichen Königtums, der für sein Selbstverständnis wie für die Rahmenbedingungen seiner Herrschaftsausübung konstitutiv war: Es handelte sich um ein Sakralkönigtum, die Herrscher verstanden sich als eingesetzt „von Gottes Gnaden“. Sie wurden als vicarius, als Stellvertreter Christi aufgefasst, bei ihrem Amtsantritt gesalbt und so numinoser Kräfte teilhaftig.26 Dies machte sie aber nach dem Verständnis der Zeit alles andere als gottähnlich. Vielmehr regierten sie, wie es schon das Bibelzitat auf der Reichskrone in Erinnerung rief, durch Gott (per me reges regnant), sie waren seine Werkzeuge und vermochten nichts aus sich selbst, sondern alles nur mit Gottes Hilfe. Deshalb bedurften sie des Rates und der Mahnung vorrangig der Priester, die ihnen vielstimmig nahe brachten, nichts der eigenen Kraft, sondern alles der Hilfe Gottes zuzuschreiben. Der Satz des Lukas-Evangeliums: „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“, ist im 10. und 11. Jahrhundert geradezu zum Leitmotiv für die Darstellung herrscherlicher Prüfungen und letztendlicher Erfolge geworden. Die aus diesem Wissen resultierende humilitas war eine unverzichtbare Eigenschaft der Könige.27
Und dieser Verpflichtung entsprachen sie durch eindrucksvolle rituelle Handlungen, durch die sie ihre Abhängigkeit von göttlicher Hilfe kundtaten und zugleich diese Hilfe zu erlangen suchten. In liturgischen und paraliturgischen Zusammenhängen finden wir immer wieder Demutshandlungen der Könige, seien es Proskynesen, Barfußgehen oder andere rituelle Äußerungen ihrer eigenen Unwürdigkeit. Die Vorgänger Heinrichs IV. hatten sich dieser Kultur der demonstrativen Selbsterniedrigung vor Gott nicht verweigert, sondern im Gegenteil expressive Ausdrucksformen praktiziert, was zum Verständnis der Vorgänge in Canossa wie ihrer Konsequenzen zu berücksichtigen ist.
Die angesprochenen Rahmenbedingungen der Königsherrschaft wurden wie gesagt vor allem durch zwei Kräfte geprägt, die im 11. Jahrhundert den Anspruch erhoben, an der Herrschaftsausübung der Könige in maßgeblicher Weise teilzuhaben: durch die Kirche und den Adel. Schon seit der Karolingerzeit kann man von einem Kräftedreieck Königtum – Adel – Kirche sprechen, das sich alle wesentlichen politischen Entscheidungen vorbehielt und Vorgehensweisen und Verfahren etabliert hatte, solche Entscheidungen vorzubereiten, zu fällen und durchzusetzen. Diese Situation hatte sich bis zum 11. Jahrhundert nicht grundlegend verändert, auch wenn mit den Ministerialen und den Bürgern der städtischen Siedlungen nun neue Kräfte politische Wirksamkeit zu entfalten begannen und die Kräfteverhältnisse veränderten. Die Ministerialen stiegen seit dem 11. Jahrhundert gewissermaßen als Funktionselite auf, indem sie für königliche, geistliche und adlige Herren Funktionen wie die Verwaltung von Besitzkomplexen oder Burgen übernahmen und auch Waffendienst leisteten. Hierdurch boten sie die willkommene Alternative, Besitz nicht als Lehen ausgeben zu müssen, sondern in eigener Verfügung halten zu können. Ihre Dienstpflichten darf man sich strikter vorstellen als diejenigen eines Lehnsmannes.28
Die Bürger der städtischen Siedlungen hingegen begannen im 11. Jahrhundert, sich genossenschaftlich zu organisieren, was letztlich in den Prozess der Bildung der Stadtgemeinden einmündete, die aus geschworenen Einungen erwuchsen. Hierdurch etablierten sie sich als neuartige Kraft, die ihre Aktivitäten zunächst einmal vor allem gegen die Stadtherren richtete, die in aller Regel Bischöfe waren. Es ist charakteristisch und dürfte kaum zufällig sein, dass Heinrich IV. bei seiner Herrschaftsausübung in auffälliger Weise auf diese neuen Kräfte zurückgriff – und sich dadurch auch massive Probleme einhandelte.29
Die Interaktionen im Kräftedreieck von Königtum, Adel und Kirche wurden von Wertevorstellungen und Normen geprägt, die durchaus unterschiedlich waren und sich teilweise auch diametral widersprachen. Dies schuf insgesamt im Herrschaftsverband eines hochmittelalterlichen Königs eine Situation, die man sich als durchaus agonal und konfliktträchtig vorstellen muss. Es konkurrierten nämlich Normen und Wertvorstellungen einer adligen Kriegergesellschaft, für die Ehre und Rang höchste Güter bedeuteten, mit dem Ethos des Christentums, das bekanntlich Nächsten-, ja sogar Feindesliebe und Demut als höchste Tugenden propagierte. Und die Beachtung dieses Ethos wurde von den an den erwähnten Beratungen führend beteiligten Klerikern, insbesondere Bischöfen und Äbten, eingefordert, da sich nur so die wichtigste Voraussetzung der Königsherrschaft einstellte: die Hilfe Gottes, ohne die auch der noch so mächtige Herrscher hilflos war, wie die Kleriker zu betonen nicht müde wurden. Den Spagat zwischen königlicher Prachtentfaltung und Herrschaftsrepräsentation, wie sie die adligen Lehnsleute erwarteten, und der Beachtung christlicher Herrschertugenden zu vollbringen, darf man sich daher alles andere als einfach vorstellen.
Als Heinrich IV. seine Herrschaft antrat, war die hier knapp skizzierte Zusammenarbeit zwischen Königtum, Adel und Kirche schon eine relativ lange Zeit praktiziert worden. Obgleich die Kräfteverhältnisse nie statisch wurden, hatten sich die Verfahren der Konsensherstellung wie der öffentlichen Repräsentation von Herrschaft, die Verfahren der Konfliktführung wie der Konfliktbeilegung im Ganzen bewährt und für eine zwar immer labile, doch selten fundamental gefährdete Ordnung gesorgt. Die etablierte Herrschaftsform wurde in der Forschung lange Zeit mit dem Begriff „ottonisch-salisches Reichskirchensystem“ apostrophiert, wodurch der Blick vielleicht zu sehr auf die gewiss wichtige Zusammenarbeit von Königtum und Kirche gelenkt wird. Jedenfalls darf man die Bedeutung des weltlichen Adels als Helfer, Partner und Gegner des Königtums in dieser Zeit auf keinen Fall unterschätzen.30
Da es zweifelsohne in dem hier gegebenen Rahmen nicht möglich ist, die angesprochene Herrschaftsform in allen ihren Eigenheiten und Funktionsweisen vorzuführen, seien im Folgenden vor allem diejenigen behandelt, die in der Zeit Heinrichs IV. – und vorrangig durch Heinrich IV. – Ursache und Gegenstand von Konflikten wurden.
Grundlage des Verhältnisses der Könige zum Adel war spätestens seit ottonischer Zeit gewesen, dass die Könige die Erblichkeit der adligen Stellung anerkannten und keine Versuche unternahmen, durch Einbehaltung und Neuvergabe von Lehen oder Ämtern Veränderungen in der Rangordnung des adligen Herrschaftsverbandes durchzusetzen, um so eine Intensivierung der Dienstbereitschaft auf Seiten des Adels zu erreichen. Im Gegenteil, wir kennen aus dem 10. und 11. Jahrhundert spektakuläre Fälle, in denen Könige besonders loyalen adligen Helfern alle ihre Lehen zu Eigen gaben – und so das wechselseitige Verhältnis demonstrativ gar nicht mehr auf Unterordnung, sondern auf Huld und Freundschaft gründeten.31 Der Verzicht auf solche verändernden Eingriffe hatte naturgemäß zum Ergebnis, dass die Rangordnung festgeschrieben und die adlige Stellung so gut wie unangreifbar wurde, was gewiss zu dem Bewusstsein des Adels erheblich beigetragen hat, eher Partner des Königs als weisungsgebundener Helfer zu sein. Man muss diese Entwicklung bedenken, wenn man die Politik Heinrichs IV. gegen bestimmte Adlige ins Auge fasst.
Mit der Anerkennung der adligen Stellung durch die ottonischen Könige gingen neue Praktiken der Behandlung von Adligen in den Fällen einher, in denen diese in bewaffnete Konflikte gegen Könige verwickelt waren. Es hatten sich im 10. Jahrhundert Modelle der Konfliktbeilegung herausgebildet, die adlige Gegner der Könige weitgehend von strengerer Bestrafung verschonten. An die Stelle des Verlustes von Leben, Freiheit oder Stellung, wie sie noch in der Karolingerzeit gang und gäbe gewesen waren, traten nun Formen demonstrativ milder Behandlung, wenn sich die Adligen am Ende des Konflikts zu öffentlichen Genugtuungsleistungen gegenüber dem König bereit fanden. Die dann demonstrativ gewährte königliche Milde hatte zur Konsequenz, dass der Reumütige sofort oder bald wieder in Amt und Würden restituiert wurde. Diese Praxis des Zugeständnisses von Sonderbehandlungen, die sich am Rang der Betroffenen ausrichteten, haben Könige schon im frühen 11. Jahrhundert zu verändern und hierbei ihre königliche Strafgewalt in den Vordergrund zu schieben versucht. Doch bestand der Anspruch, dass der König gerade bei hochrangigen Gegnern – und bei hochrangigen Fürsprechern seiner Gegner – besondere Milde walten zu lassen habe, bis in die und über die Zeit Heinrichs IV. hinaus fort. Dies ist in Rechnung zu stellen, wenn man seinen Umgang mit Gegnern untersucht.32
Im Verhältnis zur Reichskirche hatten sich ebenfalls im 10. Jahrhundert feste Verfahren herausgebildet, wie sich der König in die Auswahl der Reichsbischöfe einschaltete. Ihm kam der entscheidende Einfluss bei der Auswahl des Kandidaten zu, auch wenn formal die kanonische Wahl durch Klerus und Volk der Bischofsstadt nie aufgegeben wurde. Am Beispiel der oft bezeugten „Wahl am Königshof“ lässt sich die Verteilung der Gewichte bei der Auswahl des Kandidaten verdeutlichen. Es gab seit dem endenden 10. Jahrhundert verstärkt die Praxis, dass eine Delegation von Klerus und Laien aus der Bischofsstadt, die einen neuen Hirten benötigte, an den Königshof kam. Manchmal brachten sie einen eigenen Kandidaten und Wahlvorschlag mit, manchmal fragten sie auch einfach den König, wen sie zu „wählen“ hätten. In jedem Fall aber hatte der Kandidat des Bistums das Nachsehen, wenn der König einen eigenen Kandidaten präsentierte. Dieser wurde dann von der Abordnung gleich am Königshof gewählt.33
Seit der Endphase der Regierung Ottos des Großen hatte sich auch die Gewohnheit verfestigt, dass der König Kandidaten für Bischofsstühle vorrangig aus dem Kreis seiner Hofkapelläne rekrutierte. Es entwickelte sich sozusagen ein Karrieremuster: Jüngere Söhne aus den Adelsfamilien des Reiches, die nicht zuletzt aus erbrechtlichen Gründen auf die Klerikerlaufbahn verwiesen wurden, traten nach einer Ausbildung in einer der Domschulen in die Hofkapelle des Königs ein, in der sie einige Jahre Dienst taten, so Erfahrung sammelten und bezüglich ihrer Loyalität und Eignung geprüft werden konnten. Überzeugten sie den König, sorgte er für ihre Promotion auf einen Bischofssitz, wobei er sie bevorzugt dort einsetzte, wo sie nicht durch Herkunft in verwandtschaftliche Netzwerke eingebunden waren.34 Zwar sind hin und wieder Stimmen zu hören, die sich gegen die eine oder andere königliche Entscheidung erheben, doch kann man im Wesentlichen sagen, dass diese Praxis akzeptiert wurde. Sie hat in hohem Maße dazu beigetragen, dass die Bischöfe der ottonisch-salischen Zeit bereit und befähigt waren, die ihnen zugedachte Rolle im Rahmen der königlichen Herrschaftsausübung zu übernehmen. Dies ist vor dem Hintergrund zu betonen, dass Heinrich IV. auf ganz ungewöhnliche und massive Widerstände in mehreren Reichskirchen stieß, denen er in eigentlich herkömmlicher Weise seine Kandidaten für den Bischofssitz präsentierte. Und diese Widerstände resultierten nicht aus einer grundsätzlichen Ablehnung des königlichen Investiturrechts, sondern entzündeten sich an ganz anderen Fragen.35
So wie für die Investitur der Bischöfe hatten sich auch für andere Felder der Zusammenarbeit zwischen Königen und Kirche seit dem Frühmittelalter feste Gewohnheiten etabliert, die auf Prinzipien von Leistung und Gegenleistung basierten. Die Leistungen der Könige bestanden dabei ganz wesentlich aus Schenkungen und Privilegien; die Gegenleistungen der Kirchen und ihrer Leiter aus dem „Reichsdienst“ in Form von Beratung, seit dem Beginn des 11. Jahrhunderts auch aus Beherbergung und Versorgung des Königs und seines Gefolges sowie vor allem aus der Heeresfolge, die Bischöfe und Äbte persönlich und mit ihren weltlichen Vasallen leisteten. Die militärische Kraft der königlichen Heere beruhte im 10. und 11. Jahrhundert zu einem hohen Prozentsatz auf den Kontingenten geistlicher Institutionen. Zu diesem Einsatz waren die Kirchen durch das Ausmaß der königlichen Schenkungen befähigt, die seit dem 10. Jahrhundert dem Verzicht auf eine eigene königliche Zentralverwaltung gleichkamen, wie die Karolinger sie praktiziert hatten. Unterfüttert wurden die Schenkungen durch Privilegierungen wie etwa mit königlichen Markt-, Münz- oder Zollrechten, die geistlichen Institutionen zugestanden wurden und sie so mit erheblichen Einkünften ausstatteten. Die Förderung der weltlichen Stellung geistlicher Institutionen erreichte ihren Höhepunkt, als die Könige auch noch dazu übergingen, Grafschaften, die an sie zurückfielen, nicht mehr an Adelsfamilien auszugeben, sondern sie Bischöfen zu überantworten, die dann aus dem Kreis ihrer Vasallen „Amtsgrafen“ einsetzten.36 Schon im 11. Jahrhundert konnte etwa der Bischof von Würzburg von sich behaupten, alle Grafschaften in seiner Diözese seien in seiner Hand. Diese knapp skizzierte Form der Zusammenarbeit des ottonischen und salischen Königtums mit der Kirche hat auch Heinrich IV. im Wesentlichen fortzusetzen versucht, so dass auf diesem Felde Änderungen nicht in erster Linie von ihm, sondern von den reformkirchlichen Kräften ausgingen, die seit dem 11. Jahrhundert begannen, diese Übernahme weltlicher Verpflichtungen als unvereinbar mit den eigentlichen Aufgaben und Zielen der Kirche anzusehen.
Es dürfte auf der Hand liegen, dass diese Entwicklung die Kirche zur unverzichtbaren Stütze des Königtums gemacht hatte und jede Form eines Rückzugs aus ihren Verpflichtungen das Königtum in eine existentielle Notsituation bringen musste. Wir werden uns im nächsten Kapitel mit den Ideen beschäftigen, die genau diesen Rückzug der Kirche aus ihren „Verstrickungen in die Welt“, wie man nun sagte, propagierten. Wie radikal diese Gedanken waren, sei hier nur mit dem Hinweis angedeutet, dass im Jahre 1111 immerhin ein Vertrag zwischen Papst Paschalis II. und König Heinrich V. abgeschlossen wurde, der die ganze skizzierte Entwicklung rückgängig machen sollte. Die Kirchen, so verpflichtete sich der Papst, sollten alle von den Königen geschenkten Güter an das Königtum zurückgeben; der König versprach im Gegenzug, auf jeden Einfluss bei der Bischofserhebung und auf Reichsdienst zu verzichten. Eine solche Regelung zog die logischen Konsequenzen aus den Ideen, die die Kirche vom Einfluss der Laien befreien und den Dienst für das Königtum als simonistische Praxis verdammen wollten. Man hatte bei diesem Vertrag aber die Zeche ohne den Wirt gemacht und die geistlichen wie weltlichen Reichsfürsten an den Verhandlungen nicht beteiligt. Von diesen hatte nämlich niemand ein Interesse an einem solchen Rückzug der Kirche aus weltlichen Angelegenheiten, der mit dem Verlust der materiellen Ressourcen einherging. An ihrem massiven Protest scheiterte der Vertrag denn auch sofort.37