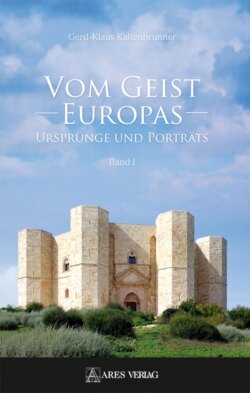Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 10
Platon Im Anfang war das Staunen Der Mann, der die Ideen schaute
ОглавлениеUnd es neigen die Weisen Oft am Ende zum Schönen sich.
Hölderlin
Hesiod ist der Mythos mit philosophischen Keimen. Platon ist die Philosophie, die auf ihren Gipfeln des Mythos nicht entraten kann, das Höchste in mythischen Bildern zur Sprache bringen muß: so vor allem im „Timaios”, im „Symposion”, in der „Politeia”, im „Phaidon”.
Platon ist die Philosophie, und die Philosophie ist Platon, wie bereits Emerson gesagt hat, der den Athener mit Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Napoleon und Goethe zu den „Repräsentanten der Menschheit” zählt.
Ähnlich hat Alfred North Whitehead, der britisch-amerikanische Metaphysiker, einmal geistreich knapp die gesamte europäische Philosophie als eine „Reihe von Fußnoten zu Platon” bezeichnet. Obgleich dieses Aperçu ein wenig übertreibt, so hält es zu Recht fest, daß Platon zu den fortzeugenden Gründergestalten des Abendlandes gehört, daß er in jedem anspruchsvollen Denken bewußt oder unbewußt gegenwärtig ist. So wie kein Europäer, mag er dem Christentum noch so entfremdet sein, die Bibel entbehren kann, sowenig kommt er um Platon herum, auch wenn er kein professioneller Philosoph ist.
Platon ist die Philosophie, obwohl er seine Gedanken nirgends in zusammenhängender, für sich abgeschlossener, durch-systematisierter Weise darlegt. Er verfaßte Dialoge, in denen fast immer Sokrates, sein geliebter Lehrer, als Hauptgestalt auftritt: Sokrates, der, wie Jesus, keine Zeile geschrieben, sondern alles dem gesprochenen Wort anvertraut hat … Sokrates, der Plebejer, als Sprachrohr des Aristokraten Platon, der sich mütterlicherseits von Solons Sippe, väterlicherseits von dem mythischen König Kodros und damit von dem Gott Poseidon ableitete … Sokrates, der niemals an der Verwaltung des Staats tätig Anteil nahm, als Meister des sich als Fürstenerzieher und politischer Reformator versuchenden, das Urbild eines „wahren Staates” entwerfenden Ordnungsdenkers, der zu dekretieren wagte, daß die Menschheit erst dann von ihren Leiden befreit sein würde, wenn die Herrscher Philosophen oder die Philosophen Herrscher geworden wären.
Sokrates war verheiratet und hatte drei Kinder. Platon blieb unvermählt und ohne leibliche Nachkommen. Aber wie viele Denker sind seine Söhne, Enkel und Erben bis auf den heutigen Tag! Ohne Platon kein Aristoteles und kein Plotin, kein Augustinus und kein Boëthius, kein Meister Eckhart und kein Nikolaus von Kues, kein Pico della Mirandola und kein Thomas Morus, kein Descartes und kein Malebranche, kein Leibniz und kein Kant, kein Geulincx und kein Solowjow, kein Schopenhauer und kein Husserl, kein Whitehead und kein Heisenberg. Was ist Hegel anders als ein dynamisierter und historisierter Platon? Die kirchlich gebundene Philosophie des Mittelalters, soweit nicht überwiegend aristotelische Scholastik, ein durch Dionysios Areopagita vermittelter, zum Teil aus dem Arabischen und Persischen zurückübersetzter Platonismus? Wieviel Platonismus steckt doch in Schiller, in der deutschen und englischen Romantik, desgleichen in Walter Pater, Charles L. Morgan, Hermann Broch und Othmar Spann, dem Wiederentdekker des Platonikers Adam Müller!
Keineswegs soll damit behauptet sein, daß alle hier nur beispielshalber genannten Denker in schulmäßigem Sinne „Platoniker” gewesen seien. Es gilt bloß, der unaufhebbaren Tatsache eingedenk zu sein, daß seit fast zweieinhalb Jahrtausenden durchweg im Dialog mit dem Dialogiker Platon philosophiert wird: anknüpfend, abwandelnd, wiederholend und auch polemisch.
Platon ist postum der frühen Kirche zum „Praeceptor theologiae” geworden; die vielberedete „Hellenisierung” des Christentums bedeutet im großen und ganzen dessen Platonisierung. Daran gibt es nichts zu deuteln, auch wenn neuerdings progressive Kirchenmänner dies für ein Verhängnis halten. Das Evangelium kommt aus dem aramäischen Raum, aber bereits die frühesten Apologeten und Kirchenväter — etwa ein Clemens von Alexandrien — haben es nicht am Leitfaden des Talmud ausgelegt, sondern gleichsam in die Sprache Platons übersetzt. Für sie war Platon sozusagen das griechische Gegenstück zum Alten Testament, eine den Heiden zuteil gewordene Vorbereitung auf Christus: Heilsgeschichte in Gestalt der Philosophie, ähnlich wie man seinen Meister Sokrates als Präfiguration, beinahe als Doppelgänger Jesu zu betrachten wagte. Noch im deutschen Mittelalter galt Platon als „der große Pfaff”, und dieser Titel war damals, wie sich von selbst versteht, anerkennend gemeint, gleichsam als nachgeholte Taufe: „Plato christianus.”
Desgleichen war dieser Zusammenhang und Parallelismus dem Humanismus einsichtig, einem Marsilio Ficino, Erasmus von Rotterdam, Pico della Mirandola, auch noch einem Goethe. Der Zuletztgenannte bezeichnete Platon als einen „seligen Geist”, dem es beliebe, immer nur einige Zeit auf der Erde zu weilen, nicht um sie kennenzulernen, sondern um ihr von oben das, „war ihr so not tut, freundlich mitzuteilen”: „Er bewegt sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder teilhaft zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in jedem Busen aufzuregen strebt.”
So hat ein kongenialer Deutscher noch im vorigen Jahrhundert Platon gesehen, der Dichter, der in einer einzigen Zeile zumindest die Hälfte von dessen Philosophie unübertroffen lapidar ausgedrückt hat: „Mir bleibt genug! Es bleibt Idee und Liebe!”
Von demselben Goethe, der mit Platon und Leonardo da Vinci zu den universalsten Geistern aller Zeiten gehört, gibt es auch einen kleinen Aufsatz aus dem Jahre 1796: „Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung”, in dem er allerdings, völlig zu Recht, gegen eine einseitige theologische Indienststellung des Griechen polemisiert. Platon war und ist mehr als ein Küster. Aber die Kirche wäre nie eine geistige Macht geworden ohne Übernahme der platonischen Ideenlehre und Ethik. Ferdinand Christian Baur, der Meister der Tübinger theologischen Schule, veröffentlichte 1837 eine religionsphilosophische Untersuchung mit dem Titel „Das Christliche des Platonismus.” Eine ähnliche Schrift stammt von Baurs jüngerem Zeitgenossen, dem Geschichtsphilosophen und Altertumsforscher Ernst von Lasaulx, einem seit langem so gut wie vergessenen Vorläufer Spenglers und Toynbees, den Jacob Burckhardt eifrig gelesen und exzerpiert hat. Der unselige Verehrer und Basler Kollege Burckhardts Friedrich Nietzsche — bis zur Raserei Antiplatoniker und Antichrist, ohne jemals von seinen geistigen Antipoden loszukommen — nannte das Christentum dieserhalb abschätzig einen „Platonismus fürs Volk”.
Diese wenigen, aufs Geratewohl herausgeklaubten Beispiele beweisen zur Genüge: Durch mehr als ein Jahrtausend wurden zentrale Dogmen des Christentums mittelbar oder unmittelbar in platonischen Kategorien formuliert, anhand des so gut wie heiliggesprochenen Platon ausgelegt und erläutert. Das gilt für die Lehre von der Ewigkeit Gottes, die Unsterblichkeit der Seele, die Schöpfung der Welt. Von Ewigkeit her ist der erst in der Zeit, mit der Zeit geschaffene Kosmos als „mundus intelligibilis” dem göttlichen Geist ideell innewohnend. Er hat wie alles Seiende ein unveränderliches Urbild. Die Schöpfung vollzog sich im Blick auf diese exemplarischen Urbilder: die überweltlichen Ideen. Gott ist Idealist, so wie es der Künstler ist. Die antlitzhafte Gesamtheit dieser Urbilder ist der Logos, die zweite göttliche Person, der Gottmensch Christus. Deshalb sagte der heilige Thomas von Aquin: „Wer die Ideen leugnet, der ist ein Häretiker; denn er leugnet den Sohn Gottes.”
Für Byzanz, das heißt: das bis zur Einnahme Konstantinopels durch die Türken am 29. Mai 1453 bestehende Oströmische Reich, das, trotz seines offiziellen Namens Rhomaike politeia, von jeher ein griechisch-kleinasiatisches Imperium war, verstand sich der Platonismus geradezu von selbst. Ungeachtet gelegentlicher Aufwallungen mönchischen Dunkelmännertums und klerikaler Verdächtigung des Heiden ließ sich Platon nicht rückgängig machen. Eine Ausbürgerung aus dem christlich gewordenen und stark orientalisierten Hellenentum kam nie infrage. Einzelne byzantinische Philosophen, Enzyklopädisten und Polyhistoren gingen so weit, Platon neben Sokrates und Plutarch einen Platz im Himmel reservieren, ihn heiligsprechen zu wollen, so der Bischof Joannes Mauropus, der Mönch Michael Psellos und dessen Schüler, der gebürtige Normanne Joannes Italos.
Solcherart haben Patristik, Scholastik und auch noch der florentinische wie der Cambridger Humanismus Platon fortgesetzt, weitergedacht und umgebildet. Ähnliches gilt für die spekulative Mystik von Plotin über Dionysios Areopagita und Scotus Eriugena bis zu Meister Eckhart und dessen Nachfahren.
Wohin wir blicken: Platon ist allgegenwärtig. Er ist es nicht nur für Schulphilosophen und Fachtheologen, sondern bis weit ins achtzehnte, ja sogar noch ins neunzehnte Jahrhundert für jeden gebildeten Laien. Weltgewandte Lebemänner haben angesichts des nahenden Todes den „Phaidon” gelesen, so wie sie sich in ihrer Jugend an der Liebeslehre des „Symposions” und des „Phaidros” berauschten.
„In der Tat trachten die wahrhaft Philosophierenden danach zu sterben …”, heißt es in grandioser Einseitigkeit bei Platon, der ja auch in seiner „Apologie des Sokrates” die letzten Stunden des zum Tode verurteilten Meisters überliefert : die antike Entsprechnung der Passion.
„Der Gerechte wird gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden an beiden Augen und schließlich wird er nach allen Martern noch ans Kreuz geschlagen werden …”
Das steht nicht im Evangelium, das ist keine Weissagung des Jesaja. So heißt es in Platons Dialog über die Gerechtigkeit, der „Politeia” — ein griechisches Seitenstück zu den Prophetenworten über die Leiden des Gottesknechtes im Alten Testament. Ist es ein Wunder, daß Platon kanonischen Rang erhielt, ähnlich wie der Römer Vergil wegen seiner die Geburt eines Heilandsknaben feiernden vierten Ekloge als „adventistischer Heide” galt?
Wie in dem Buch der Bücher kann man auch in den Schriften Platons, der Bibel der Philosophen, fast alles finden. Geistreich treffend bemerkt Friedrich Schlegel, der Platon mit Jakob Böhme verbindende Meisterdenker der deutschen Romantik: „Platon enthält eigentlich die Weisheit, der ganze Geist der Philosophie ist in ihm; er hat alles gewußt, nämlich das Ganze, das, worauf es ankommt.” An anderer Stelle setzt er ergänzend hinzu: „Platon hatte kein System, sondern nur eine Philosophie … Man kann die große Einheit in Platons Werken nur suchen in dem bestimmten Gange seiner Ideen, nicht in einem fertigen Satze und Resultate, das sich am Ende finde … Er ist nie mit seinem Denken fertig geworden, und diesen immer weiter strebenden Gang seines Geistes nach vollendetem Wissen und Erkennen des Höchsten, dieses ewige Werden, Bilden und Entwickeln seiner Ideen hat er in Gesprächen künstlerisch darzustellen versucht.”
Deshalb erscheint uns Platon bald als virtuoser Rationalist und Dialektiker, dessen subtile Begriffsbestimmungen akrobatisch anmuten und uns schwindelig machen; bald als Dichter, Mythenschöpfer und Visionär, der das Geheimnis der Wirklichkeit in unvergeßlichen Bildern zu vermitteln trachtet. Ich erwähne das Höhlengleichnis in der „Politeia”; die Eröffnungen über das Schicksal der Toten im Jenseits, die sich am Schluß des erwähnten Dialogs, aber auch des „Gorgias” und des „Phaidon” finden; die Rede des Aristophanes über den androgynen Urmenschen im „Symposion”; den das mit einer Weltseele ausgestattete All als „Abbild” (eikón, „Ikone”) eines ewigen Urbildes deutenden Schöpfungsbericht im „Timaios”.
Der leibfeindliche, die Sinnlichkeit als pöbelhaftes, unzuverlässiges, niederträchtiges Zeug befehdende jenseitssüchtige Aristokrat und Asket lobpreist an anderer Stelle den Eros als Mittler zwischen Göttern und Menschen, als Himmelsleiter, als lebenstiftende, weltbeschwingende und geistbildende Urmacht. „Amor ist es, der uns zusammendrückt.” Das ist zwar Novalis, aber fast wörtlich sagt dies, in der Nachfolge Hesiods, der den Eros als Urgestalt philosophischen Daseins feiernde Platon durch den Mund der Priesterin Diotima, die den Sokrates in die Mysterien der geschlechtlich-übergeschlechtlichen Liebe eingeweiht habe.
Der die Poeten aus seinem Staat verbannende Philosoph hat nicht nur selbst in seiner Jugend Tragödien hervorgebracht, die verlorengegangen sind, sondern gibt sich auch in seinen Dialogen immer wieder als hinreißender Dichter zu erkennen, im „Lysis”, im „Symposion”, im „Phaidros” (aus dem Thomas Mann ganze Passagen in seine Novelle „Der Tod in Venedig” hineingearbeitet hat). Den Homer und den Hesiod tadelt der Moralist Platon zwar, weil sie „schlechte Gleichnisse gebrauchen betreffs dessen, wie beschaffen die Götter und die Heroen seien”; er empört sich darüber, daß die Dichter sich erdreisten, den Göttern Krieg, Ehebruch und Verwandlung in Tiergestalt zuzuschreiben. Ebenso hält er, wie später frühchristliche Eiferer und puritanische Protestanten, das Theaterspiel für eine bedenkliche Sache, weil zu lügenhafter Nachahmerei und aufreizender Verwandlungskunst verführend.
Doch derselbe Platon spricht an andrer Stelle, in den „Nomoi”, von dem „gottbegeisterten Dichtergeschlecht”, das „durch die Gunst der Chariten und Musen mit seinen Liedersprüchen oft genug die Wahrheit trifft”. Derselbe Platon plädiert für eine musische Erziehung, lobpreist das Ästhetische als menschenbildende, ethosformende Macht. Gesang und Reigen sind für ihn nicht bloß Kinderspiel, sondern staatsbürgerliche Einrichtung und Gottesdienst zugleich. Platon, der einmal die Dichter für Lügenbolde und Jugendverderber, ein andermal für göttlich inspirierte Lehrmeister der Wahrheit hält, einmal geradezu calvinistisch ernst und nüchtern, dann aber zu solchen Aussagen sich hinreißen lassend: „Jedermann also, ob Mann oder Frau, möge die schönsten Spiele zum eigentlichen Inhalt des Lebens machen, ganz im Gegensatz zu der jetzt herrschenden Denkweise … Eben dies, Spiel und Bildung, sind für uns Menschen das Ernsthafteste. Gewisse Spiele muß man zum eigentlichen Inhalt des Lebens erheben, nämlich Opfer, Gesänge und Tänze” (Nomoi).
Der die Vernunft vergöttlichende, die Leidenschaften verdächtigende Intellektualist feiert im „Phaidros” Begeisterung und Wahnsinn, Enthusiasmos und Mania, als Gottesgeschenke, die den in sich verrammelten und verkrusteten Menschen überschwänglich heilsam entgrenzen, öffnen und erschüttern: „Nun aber entstehen uns die kostbarsten Güter aus einem Wahnsinn, der als göttliche Gunst verliehen wird …” (Phaidros); und er zählt auf die Pythia des Orakels zu Delphi, die Priesterinnen in Dodona, die Sibylle und andere verzückte Seherinnen; die Mysterien des Rausch- und Lösegottes Dionysos; das Besessensein von den Musen, das den Dichter erst zum Dichter werden läßt; und schließlich die Hingerissenheit durch das überwältigende Ereignis des Schönen, die erotische Erschütterung, die allerdings etwas anderes ist als noch so heftige Begierde. „Tatsächlich ist es allein der Schönheit beschieden, zugleich in höchstem Maße sinnenfällig und liebenswürdig zu sein …”
Der die Schönheit als Theophanie rühmende ist zugleich der das Schauen als klarsten, am geistigsten gestimmten Sinn feiernde Platon. Kein Wunder, daß er immer wieder Künstler, Ästheten und Kunstbegeisterte angezogen hat, auch solche, die von sich behaupteten, überhaupt kein Organ für Philosophie zu haben. Die Reihe reicht von Raffael über Shaftesbury, Winckelmann und Joubert bis zur deutschen Klassik und dem Grafen Platen, ja sogar bis zum Jugendstil, bis zu Stefan George, dem Maler, Graphiker und Schriftsteller Richard Seewald, den Malern von Beuron, und dem eine Ethik der Schönheit kündenden Paneuropa-Pionier Richard Coudenhove-Kalergi. „Wär nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt es nie erblicken …” Goethe hat mit diesen Versen eine durch Plotin vermittelte erzplatonische Einsicht dichterisch knapp zur Sprache gebracht.
Der das Schöne mit dem Guten aufs innigste zusammenschauende Platon ist der Vater des Idealismus. Durch ihn ist das Wort Idee zum festen philosophischen Terminus geworden.
Das griechische Wort idea (Aussehen, Erscheinen, Gestalt) leitet sich ab von idein (sehen, erblicken, schauen); das dazu gehörige Verbalnomen lautet eidos (Bild, Gestalt, Form, das Geschaute). Die Verkleinerungsform von eidos heißt eidolon (Bildchen). Von ihm leiten sich übrigens unsere drei Fremdwörter ab: Idol (Trugbild, Gespenst, Wahnvorstellung, Götzenbild), Idyll (Bild friedlich-einfach-beschaulichen Lebens) und schließlich Ideal (Vorbild, Leitbild, Zielbild).
Welch ein Glück, daß Platon niemals genau definiert hat, was Idealismus ist, wie er ja auch für das, was er mit „Idee” meint, stellenweise andere Ausdrücke gebraucht. Zweierlei liegt freilich offen zutage. Erstens: „Idee” ist bei Platon etwas ganz anderes, recht eigentlich sogar das Gegenteil von dem, was man heute darunter gedankenlos versteht; Idee ist mehr als ein bloßer Gedanke, Begriff oder gar Einfall — und mit eben dieser Einsicht, die Platon immer wieder aufs neue erörtert, beginnt philosophische Kultur. Zweitens: Idealismus ist keine „Lehre”, sondern eine Lebenshaltung; keine Theorie, sondern eine Praxis, allerdings eine theoretisch erleuchtete Praxis oder, wie die Franzosen es nennen, manière de vivre. Der Materialismus ist in weit höherem Maße eine Theorie als der Idealismus; abgesehen davon, daß er sowohl historisch als auch systematisch immer der zweite, wenn nicht gar dritte in der Folge und im Range ist: Antwort, Polemik und Berichtigung des Idealismus; nicht Aktion, sondern Reaktion.
Die Idee ist das Geschaute. Sie ist eigentlich das, was nicht nur wir Menschen eräugen, sondern, wenngleich bewußtlos, alle Geschöpfe in dem Grade, in dem sie wesen und sind. Das ist der tiefe, der abgründige Gedanke, den Platon mit dem Begriff der methexis („Teilhabe”) umschreibt. Alles Seiende verdankt sich einem Sehen, Gesichtetwerden oder kurz und knapp: einem Gesicht. Die Vision ist nur die höchste Steigerung jener seinsstiftenden Ekstase, in der alle Wesen sich an dem Anblick der Ideen ausrichten und von ihnen durchschaut, durchlichtet und mit Sein belehnt werden. Sie bilden sich aus, indem sie sich in die ihnen entsprechenden Ideen ein- und hineinbilden, imaginieren in die „Imago” des Urbildes.
Das sei eine „spekulative” Marotte, mag man sagen: „Begriffsdichtung”, „nichts als Idee”, vielleicht sogar im klinischpsychiatrischen Sinne „fixe Idee”. Das über die Spekulation verhängte Verdikt schüchtert viele ein. Es hatte eine gewisse Berechtigung als Korrektiv gegen einen zuchtlosen Mystizismus. Aber Philosophie ist Spekulation, weil Platon die Philosophie ist. Es ist aberwitzig, von der Philosophie zu verlangen, sich angesichts der Erfolge einer methodologisch beschränkten Naturwissenschaft auf bloße Fragen der Epistemologie, Logik und Semantik zu konzentrieren (so bedeutsam diese Probleme unleugbar sind, sofern man sie in einem größeren Sinnzusammengang behandelt). Arbeitsteilung, Methodologie, Aufmerksamkeit auf reproduzierbare und zwingend einsichtige Details in Ehren — aber dies kann doch nicht das letzte Wort sein: Sicherheit um jeden Preis, Wahrheit reduziert auf das experimentell Erwiesene oder mathematisch Gültige. Auf die Dauer läßt sich nicht der mit dem Leben gleichzusetzende Impuls unterdrücken, der wissen will, was es alles zu verstehen gibt, und nicht bloß, wie es nach den Normen der Schule zu verstehen sei. Wer diese meine Auffassung teilt, befindet sich in guter und überaus bunter Gesellschaft, in der man Whitehead, Bergson, Klages, Solowjow, Heidegger, Bloch, Spann und Hans Jonas begegnen kann. Sie alle haben das Abenteuer der Spekulation gewagt.
Man lasse sich doch nicht durch den zufälligerweise in die Sprache der Börsianer und Steuerfahnder gelangten Ausdruck beirren. Spekulieren kommt vom lateinischen speculari, „spähen”, auslugen, ins Auge fassen. Aus einem gewissen Abstand, etwa von einer Warte (specula), das, was sich zeigt, die species, nachdenklich zu betrachten, ist die spekulative Haltung des Philosophen vom Schlage Platons. Das lateinische Wort species (Anblick, Gestalt, Erscheinung) entspricht ganz dem griechischen eidos oder idea. Der spekulierende Mensch gleicht dem Türmer Lynkeus, der das platonische Hochgebet ausspricht:
Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt …
Der spekulierende Philosoph ist in die Tiefe spähender Kundschafter des Weltgeheimnisses. Sicherheit gibt es da keine, eher packt ihn der Schwindel. Statt verbürgte Gewißheit in kleine Rechenpfennige auszumünzen, setzt er sich einem ätherischen Taumel aus. Dieser Taumel ist das Staunen, das thaumazein des Griechen — die Wurzel ursprünglicher Spekulation. Platon nennt es ausdrücklich „das Pathos des Philosophen”. Und abermals, wie bei den Wörtern Idee und Spekulation, gewahren wir eine schaubezügliche oder ophtalmische Grundbedeutung. Sowohl das griechische thaumazein wie das deutsche staunen bedeuten bereits in vorphilosophischem Sinne soviel wie verwundert anschauen, unverwandten Blickes starren, vor dem Unbekannten, Fremden oder Wunderbaren anschauend standhalten …
Diese Haltung des Staunens verbindet das nicht mehr ganz wilde, aber noch nicht verkorkste Kind mit dem Philosophen Platon, in dessen Dialogen sich so viele Gedanken über Kindheit und Jugend, Erziehung und Spiel finden. Der zum Sehen geborene, zum Schauen bestellte Mensch findet im Erstaunen zur Philosophie und durch sie zur Spekulation.
Anfang und Bedingung der Philosophie ist das Staunen. Das hat Platon in seinem großen Spätwerk, dem Dialog „Theaitetos”, für alle Zeiten festgehalten. Hier sagt der durch die scharfsinnigen Darlegungen des Sokrates ratlos verwirrte Jüngling, nach dem der Dialog benannt ist: „Bei den Göttern, mein Sokrates, ich komme aus dem Staunen nicht heraus über die Bedeutung dieser Dinge, und manchmal wird mir’s beim Blick auf sie geradezu schwindlig.” Darauf versetzt der Meister dem vom Gefühl gelinden Taumels ergriffenen Theaitetos: „Das ist ganz und gar das Pathos — die Gemütsverfassung — eines wahrhaften Philosophen: das Staunen. Es gibt keinen andern Anfang der Philosophie als diesen.”
Das Staunen ist aber nicht nur der kindhafte Anfang der Philosophie, sondern auch ihre reife Frucht in höchstem, beinah schon leisest verklingendem Alter. Der liebebewegte Philosoph geht den Weg vom Sinnlichen zum Seelischen, vom Seelischen zum Geistigen, und immer neue Schönheiten immer umfassenderer Art erschließen sich ihm, sagt Diotima im „Symposion”. Am Ende aber wird er, so fährt sie fort, „plötzlich ein staunenerregendes wesenhaft Schönes erblicken, auf das alle früheren Bemühungen hinzielten”: „Auf dieser Stufe ist, wenn irgendwo, das Leben für den Menschen lebenswert.”
Es ist dies der Weg vom nichtwissenden Staunen zum die Idee mit großen weitgeöffneten Augen schauenden Staunen, der Weg von der verblüfften Verwunderung zur ergriffenen Bewunderung, von der Ratlosigkeit zur Kontemplation und Spekulation.
Spekulation höchster Art kann nicht trügen. Sie vermag allerdings denjenigen, der sie pflegt, unter Umständen für das, was man gemeinhin das Leben nennt, untauglich zu machen, ähnlich wie Weitsichtige nahe liegende Dinge nicht oder nur undeutlich wahrnehmen. Ähnlich ergeht es ja auch dem Goetheschen Türmer Lynkeus. Streit und Verwirrung entstehen erst, wenn das, was staunend gesehen und visionär geschaut wurde, in Worte übersetzt werden soll: in meistens vieldeutige und durch langen Gebrauch belastete Worte aus oft ganz andern Lebensbereichen. Streit und Verwirrung entstehen vor allem dann, wenn Philosophie jenes tertium datur vergißt, das ihr Standort ist, sofern sie staunt und spekuliert: weder Wissenschaft noch Dogma, weder Laboratorium noch Kirche, weder Politbüro noch Werbeagentur, sondern eben das Aushalten im Erstaunen und die Bereitschaft, wie Heidegger, Platon fort-denkend hinzufügt, „dieses Erstaunen als Wohnsitz anzunehmen”.
Wenn dies geschieht, dann verliert das Spekulieren jeden Beigeschmack von Überheblichkeit. Es ist nichts als das zutiefst demütige Verharren im Anblick der Welt-Tiefe, die tiefer ist, als der Alltagsverstand wähnt. Dieser will Sicherheit, Gewißheit, Richtigkeit, vor allem aber eine „demokratisch” mißverstandene Einfachheit. Er will begreifen und beweisen, wo man bestenfalls schauen und staunen kann, weil das in Erscheinung Tretende wesentlich unantastbar und unergründlich ist. Deshalb ist Philosophie von jeher eine Sache einsamer Einzelgänger oder kleiner verschworener Bünde, obwohl es vielleicht jedem Menschen in gewissen Augenblicken widerfährt, unbewußt und ungewollt zu philosophieren.
Auch dies hat Platon bereits gesehen, wie sein Wort im Dialog „Sophistes” zeigt, wo vom Denken als dem „tonlosen Gespräche der Seele mit sich selbst” die Rede ist. Der Denker ist all-ein mit sich selbst. In der Zwiesprache der Seele kommt etwas zu Wort, das im Grunde unsagbar ist. Es sind die ersten und die letzten Dinge, auf die es ankommt. Logik und Dialektik, Geometrie und Semantik, Definitionen und Methoden, Zahlen und Figuren sind dazu nur Vorspiel, Rüstzeug und Übung. Sie sind nicht das Ziel. Das Ziel ist wie der Ursprung der hochzeitliche Beginn des Staunens. Von ihm gilt das merkwürdige Wort in den „Nomoi”: „Denn der Anfang ist auch ein Gott und rettet alles, wenn er von jedem die gebührende Ehre empfängt.” In ihm gründet fruchtbare Spekulation, die im Grunde Intuition ist.
Was aber ist Intuition? Nun, es kann ja gar nicht anders sein, das aus dem Lateinischen stammende Wort bedeutet ursprünglich ganz einfach: anschauen, betrachten, im Auge haben, in gelegentlichem Zusammenhang auch: staunen. Diese spekulierende Intuition oder intuitive Spekulation kann in dafür Empfänglichen geweckt, aber nicht wie einer der üblichen Lehrgegenstände eingetrichtert werden. Das ist der Sinn der sokratischen Kunst, der Mäeutik, der „Hebammenkunst”, die ebenso ein Charisma ist wie der damit eng verwandte pädagogische Eros. Wem sie zu eigen sind, von dem geht jene Wirkung aus, die Adalbert Stifter in seinem wahrhaft platonischen Roman „Nachsommer” einer vornehmen Frau zuschreibt: „Es schien, daß das, was die vorzüglichsten Männer in ihrer Gegenwart sprachen, von ihr angeregt wurde, und daß ihre größte Gabe darin bestand, das, was in andern war, hervorzurufen.” In Gegenwart solcher Menschen erinnern wir uns plötzlich dessen, was wir nichtwissend schon wissen. Erinnernd wird aus Einsamkeit Gemeinschaft, aus Schweigen Zuspruch.
Auch dies hat Platon in den unvergeßlichen Worten seines siebenten Briefes formuliert, im Bewußtsein, daß er hier eine Dimension berührt, die eigentlich jenseits des Äußerungsfähigen liegt: „Denn es läßt sich nicht in Worte fassen wie andere Wissenschaften, sondern aus dem Zusammensein in ständiger Bemühung um das Problem und aus dem Zusammenleben entsteht es plötzlich wie ein Licht, das von einem springenden Funken entfacht wird, in der Seele und nährt sich dann weiter durch sich selbst.”
Platon hat mit diesen Worten sein Ideal einer „Akademie” umrissen, von der unsere Lehr- und Diskutierbetriebe bloß den Namen haben. Kein akademischer Philosoph würde heute mit Cicero Platon den „Gott unter den Philosophen” nennen. Auch vom urspringenden Staunen wird von Schulphilosophen kaum gesprochen, wohl aber in zunehmendem Maße von über die Grenzen ihres Faches hinausdenkenden Naturwissenschaftlern und Soziologen, vor allem aber von den Dichtern.
Achtzig Generationen waren über die Erde gezogen, als Nikos Kazantzakis in dem analphabetischen Arbeiter Alexis Sorbas einen Menschen unseres Jahrhunderts gestaltete, der, ohne je von Platon etwas vernommen zu haben, ein naturwüchsiger Platoniker ist: „Mit demselben fragenden Erstaunen pflegt er jeden Menschen, einen blühenden Baum, ein Glas frisches Wasser anzusehen … Alles erscheint ihm als Wunder, und jeden Morgen, wenn er die Augen aufschlägt und die Bäume, das Meer, die Steine oder einen Vogel ansieht, steht er mit offenem Mund da.”
Die Sonne Homers lächelt auch uns noch und ebenso das Intelligenz, Argument und Apophantik gewordene Lächeln der leicht gekräuselten Lippen des Sokratikers Platon. Das Lächeln des metaphysischen Charmeurs ist das gleichsam transzendentale Lächeln des Odysseus von Ithaka wie des Alexis Sorbas von Kreta. Es umspielt das Antlitz Picos della Mirandola, Erasmus’, Goethes und Novalis’. Mag in gewissen Stunden philosophischer Verdauungsschwäche und Verstimmung ein freudloser Famulus sich trübselig sagen:
Ich empfinde fast ein Grauen,
Daß ich, Plato, für und für
Bin gesessen über dir:
Es ist Zeit hinauszuschauen
Und sich bei den frischen Quellen
In dem Grünen zu ergehn,
Wo die schönen Blumen stehn …
(Martin Opitz)
Aber was ist recht verstandener Platon, der nicht zum verschulten Platonismus oder altphilologischen Pflichtpensum erniedrigte Platon, anderes als ein Wasserfall frischer Quellen und ein ewiger Frühling, der den abendländischen Geist immer wieder zum Erblühen bringt? Sooft uns seine Sonne lächelt, taut das Eis der Denkzwänge und Schematismen, ist etwas Griechisches im Aufbrechen: am Pariser Hof zur Zeit des Scotus Eriugena; im zwölften Jahrhundert in Chartres; dann im mediceischen Florenz und überhaupt in der italienischen Renaissance; in der im siebzehnten Jahrhundert gedeihenden Schule von Cambridge, die mittelbar noch einen Newton beeinflußte; in Weimar und Jena zur Zeit Goethes und Schillers; unter König Ludwig I. in München, als dort Baader, Schelling, Görres, Döllinger und Lasaulx lehrten.
Sooft uns Platon lächelt, wird es aufgeräumter, heller und freundlicher in Europa, erhebt sich der Mensch vom Prokrustesbett angemaßter Orthodoxie, kämpft er mit dem Florett gegen die Windbeuteleien der Sophisten und materialistische Herabsetzung. Platon ist allemal Geistesfrühling, Sonnenaufgang, Erwachen aus dogmatischem Schlummer und phantombewirkten Katzenjammer. Wo Platon lächelt, blüht Geistes-Gegenwart, Freude am Denken und staunende Feinfühligkeit gegenüber dem Wunderbaren. Platon ist die Philosophie, die dem Boëthius im Kerker erscheint, so wie sie den zum Tode verurteilten Sokrates die ironische Haltung gegenüber dem Leben bis zuletzt bewahren läßt. Das Lächeln Platons umspielt und segnet alle Momente, in denen der Vorrang der Form vor dem Stoffe sich mit siegreicher Anmut kundgibt. Es erneuert und vertraut auf die ästhetische Erziehung des Menschen, die Versöhnung von Sinnlichkeit und Geist, Schönheit, Weisheit und Güte. Es läßt uns entzückt für einen gnadenhaften Augenblick un riso dell’universo gewahren, von dem Dante (Paradiso XXVII, 4 ff.) singt:
Was ich hier sah, schien mir ein Lächeln süß
Des Weltalls, also daß mir Aug und Ohr
Die Trunkenheit ins Innere strömen ließ.
(1989)