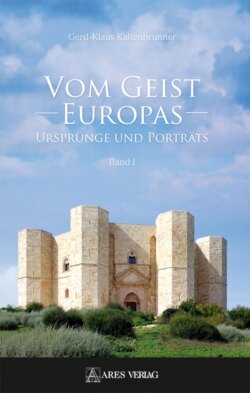Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 9
Kolumnentitel Hesiod Wie die Griechen zu ihren Göttern kamen
ОглавлениеMatéros aglaòn eidos
Mit Hesiod zu beginnen, heißt mit dem Beginn zu beginnen. Hesiod ist der Erste in so vielen Hinsichten. Das Abendland hebt mit ihm an. Hesiod ist der erste dichterisch blühende Zweig am Baume des Okzidents. Hesiod ist Arche ganz und gar.
Arche ist Hesiod in des Wortes doppelter Bedeutung. Arche ist er als der schlechthin Erste, der mit dem ersten beginnt: der arché. Árche ist Hesiod, weil er das Fahrzeug ist, mit dem er urälteste, bereits zu seinen Zeiten vom Aussterben bedrohte Überlieferungen des Ostens durch Weltuntergänge hindurch gerettet hat.
Hesiod der Erste, Hesiod unvergleichbar, nachfolgelos und einzig: Hesiod der Archäus und Archon des Abendlandes, ohne dessen durch die Jahrtausende hallendes Wort wir über die Ursprünge nichts wüßten!
Hesiod, der Künder der Ursprünge! Der beginnliche Mann, der Noah seelengeschichtlich frühester Weistümer und Weisungen …
Weltreiche schwanden, Völkerschaften versanken, Geschlechter von Gottkönigen starben aus, aber Hesiods Lehre und Weisheit währt bis auf den heutigen Tag.
Hesiod preise ich, denn sein Erscheinen ist die Einsetzung und Besiegelung europäischer Poesie, die mehr ist als Reimgeschwätz und versifizierter Putz.
Mit Hesiod setzt ein abendländische Dichtung als Prophetie, der Dichter als weissagender Seher, als eingeweihter Kundiger und Kundiger der Gottheit, als Enthüller und Liturge von Hierophanien und Theophanien.
In Hesiod sind archetypisch-paradigmatisch vorweggenommen die in Weltallsphären ausgreifenden Kundschafter und, wenngleich in unterschiedlichstem Maße, beglaubigten Gottesschauer: der auf der Insel Patmos von prophetischen Gesichten überwältigte Apokalyptiker Johannes; der die drei Reiche des Jenseits, Kreis für Kreis, durchschreitende Florentiner Dante; der alles Vergängliche verzückt als Gleichnis gewahrende Schöpfergeist der Deutschen, Goethe, der Dichter Fausts.
Wer von Hesiod spricht, nennt mittelbar auch das Eddalied Völuspa und das Kalevala, das Muspilli und die Miorita, das Nartenepos und die Kosmogonien der Orphiker.
Hesiod, diese ehrwürdige Vokabel, der Widerhall auch der altägyptischen Pyramideninschriften, des Gilgameschliedes, des Rigveda, der Upanishaden und der Bhagavadgita, der keilschriftlichen Weltentstehungsberichte des Zweistromlandes und Anatoliens. Durch Hesiods griechischen Mund echot zu uns sogar Opfermythos sibirischer Schamanen und Kult innerasiatischer Wanderhirten.
Hesiod gleicht der Korykischen Grotte in Kilikien. Menschgewordene Höhle ist der Dichter. Von der Muse getrieben, hallt durch die Weltalter sein göttlich stammelndes Wort. Durchtönt von seinem Altvaterlippenpaar ungeschminkt Unvordenkliches, manchmal von ihm selbst kaum begriffen, aber im Gesange berührt.
Angelockt von ihrer archaischen Schönheit, verlieren wir uns zuletzt im Höhlenwald der Stalaktiten und Stalagmiten, in tropfenschlägig versteinerten Ergießungen ältester Erdgeschichte. Gezogen von ihren kristallisierten Reizen, erzittern wir zuletzt in heiligem Dunkel vor der Majestät des hier hausenden Gottes.
Hesiod ist mehr als ein großer Name, mehr als der erste namentliche, sich selbst nennende Dichter Europas. Hesiod gehört zu jenen gewaltigen Namen der Aventiuren abendländischer Seelen- und Sinngeschichte, in denen etwas über das Menschliche hinauswächst. Hesiods Dichtertum ist mehr als eine biographische Erscheinung, es ist Instrument und Maske einer Theophanie, eines untrüglichen Offenbarwerdens des Göttlichen: Nomen, numen …
Der vom Mysterium tremendum, vom Mysterium fascinans ergriffene Dichter erfindet keine Gottheit, keine einzige. Bloß Spätlinge unterwinden sich, gebastelte Götter zu unterstellen und bringen höchstens geistreiche Allegorien oder witzigen Spuk zustande. Hesiod bleibt unverstanden, hielte man ihn für einen Götterfabrikanten, wie dies unerleuchtete Priestertrughypothesen den sogenannten Primitiven zumuten; indes doch nur zivilisierte, ja untergehende Gesellschaften dazu imstande sind, nicht aber in Schöpfungsfrühe hinaufreichende, ihr kongeniale Völker.
Hesiod hat keinen der hundert und aberhundert Götter, die er in seinen beiden erzenen Großgedichten nennt, ausgedacht und hergestellt. Er hat sie eräugt, weil sie sich ihm erweislos gezeigt haben. Hesiod hat sie beseligt gesichtet, in verzücktem Lobpreis rühmend, manchmal aber auch in der Seele erschaudernd ob der Übergewalt der mit dem Siegel des Unerfundenen und Unvordenklichen visionär geschauten kosmischen Vorgänge.
Kein lieber Gott offenbarte sich ihm, sondern eine allerschütternde Kaskade von Göttern, Dämonen und Monstern. Titanen und Giganten sah er, kannibalische Kämpfe und vulkanische Kataklysmen. Augenblicke gab es, in denen ihm bangte, es könne ihn das grausame Geschick Aktaions ereilen, der unbefugt die Göttin im Bade sah. Aber Hesiod war ausgelost, sie schauen zu dürfen. Er war bevollmächtigt, nicht nur ein göttliches Wesen nackt zu erblicken, sondern das Pantheon: nicht nur die in seligem Lichte lebenden Olympier, sondern auch die unterweltlichen Numina — Hades und Tartaros, Erinnyen und Nemesis, Nyx und Erebos, Gorgonen und Graien, Styx und Hekate, Kerberos und Typhaon. Die Hölle ist wahrlich keine christliche Erfindung …
Hesiod schaute all dies, ohne zu erstarren. Erblickte der ungeheuren Macht des Negativen unbeirrt ins grause Antlitz und hielt ihre erdgeschichtliche Katastrophen herbeiführenden Paroxysmen fest. Untergang, Tod und Hölle feige nicht wahrhaben zu wollen, stand Hesiod nicht zu. Erblickte nicht weg, er verweilte im Angesicht des Schrecklichen ohne tödlichen Schock. Mit hartem Auge faßte und fixierte er auch das Grauen, hielt ihm unverwandt stand und hielt es sorgfältig fest.
Kein Dichter, und sei er noch so trickreich, vermag zu erfinden, was Hesiod schaute und sang — ohne durch Medusenblick zu versteinern. Nichts von dem, was wir in seiner Theogonie lesen, hat er, der eher schwerfällig herbe Dörfler aus boiotischem Gau, listig ausgesonnen. Er schaute es überwältigt unnachgiebig, erschauernd festbleibend. Er bekundete und enthüllte die Visionen, wie nur je ein gottergriffener Prophet. Er bezeugte, was sich nicht aushecken läßt, sonden nur entdecken. Das uralte, längst zu formelhafter Floskel herabgekommene Wort vom Dichter als begeistertem Sprachrohr und Mundstück des ihn erfüllenden, antreibenden und zum Tönen bringenden Genius, hier ist’s, wenn irgendwo, Ereignis. Der Begriff Offenbarung beschreibt den Tatbestand mit algebraischer Exaktheit.
Nicht nur beim Baden sah Hesiod unzählige nackte Götter, um dann Name für Name die fünfzig Töchter des Nereus, von den dreitausend Okeaniden immerhin deren einundvierzig litaneigleich zu katalogisieren. Ohne ein Voyeur zu sein, vielmehr mit der erhabenen Unbefangenheit eines arglosen Riesenkindes, eräugte und belauschte er auch ihre Umarmungen, Beilager und Hochzeiten, ihre Amouren, Buhlschaften und Liaisons.
Nicht einen lieben Gott entdeckte Hesiod, wohl aber unermeßliche Scharen liebender Götter. Ein Pantheon von ehelicher wie außerehelicher Liebe pflegenden Gottheiten bezeugt der schaubegnadete Dichter. Sie sind wollustatmende, sinnenfreudige, nach geschlechtlicher Erfüllung verlangende und Wonnen wie Qualen leidenschaftlicher Liebe auskostende Wesen und Mächte. Es gibt Götterehen, Götterkonkubinate und Götterliebeleien, aber auch Götterblutschande, Göttergattenmord und in schaurigster Morderotik sich austobenden Götterliebeswahn.
Diese erotisch schwelgenden, in geschlechtlicher Üppigkeit sich verschwendenden Götter sind keine Eunuchen, keine antikonzeptiven, keine unfruchtbaren oder sterilisierten Götter. Ihre Brunst und Lust äußert sich in überschwänglicher Fülle. Göttlichkeit ist sich selbst mehrendes Leben.
Die griechischen Götter unterscheiden sich von den Menschen nicht durch ihr Schöpfertum, sondern durch ihre Fruchtbarkeit. Unsterblichkeit kommt zum Tragen in unausschöpflicher Werdelust, Zeugungslust und Gebärungslust.
Der griechische Gott mußte nie die Last auf sich nehmen, Mensch zu werden. Im Grunde war er ein Makro-Anthropos, ein mit Majuskeln geschriebener Mensch, ein ins Große übersetzter homo ludens. Als solcher erscheint er vor allem bei Homer. Oder der Gott verkörpert eine Lebensmacht, ist Gestalt gewordenes Amt, Element und Widerfahrnis: Eros und Krieg, Weinrausch und Dichtung, Nacht und Schlaf, Morgenröte und Regenbogen, Wald und Meer. Göttlich ist alles, was Menschen trägt und beflügelt, entzückt und bedroht, erstaunen und erzittern läßt. Der Unterschied zwischen Göttern und Menschen ist einer der Lebenskraft oder des Temperaments, somit duch Übergänge und Stufen vielfältig verbunden, nicht aber ein ontologischer Abgrund wie der von Schöpfer und Geschöpf. Beide sind geboren und geworden.
Die Götter Hesiods leben nicht von jeher. Sie sind das Ergebnis einer Evolution. Rückschauend erweisen sie sich als ebensowenig ewig wie die Menschen. Nur im Hinblick auf die Zukunft währt ihre Lebensfrist ewig. Götter wie Menschen sind nicht gemacht, sondern gezeugt. Ihre Geburtlichkeit verbindet sie. Ebenso teilen sie, nur graduell verschieden, Neigungen, Schwächen und Geistesgaben. Was sie voneinander trennt, ist nicht die Geburtlichkeit, sondern das Privileg der Unsterblichkeit, das nur den Göttern zukommt, während der Mensch wesenhaft der Sterbliche ist. Göttern vorbehaltene Unsterblichkeit aber gibt sich kund in opulenter Fruchtbarkeit.
Hesiod war Landmann. Er besaß Herden, die er weidete. Wie der jüdische Gott sich den Schafe hütenden Moses, David und Amos offenbart, so fahren die Musen vom Helikon den Hirten Hesiod an, bevor sie ihn heißen, sich aus dem Zweig eines blühenden Lorbeers den Seherstab zu schneiden, und ihm die Genealogie der Götter enthüllen. Für den Landmann Hesiod sind Zeugung, Geburt und Fruchtbarkeit die ausschlaggebenden Kategorien. Der Bauer und Hirt weiß ohne weiteres Zutun, daß alles daran hängt. Das meiste nämlich vermag die Geburt, so viel auch wirket die Not und die Zucht. Hesiod denkt genetisch und generativ, nicht technomorph oder demiurgisch.
Er könnte aber nicht so denken, wäre ihm nicht tagtäglich das Urphänomen des sich geschlechtlich vermehrenden Lebens anschaulich greifbar und wirksam gegenwärtig. Ob Wiese, Acker oder Herde: überall Same, Keim und Frucht. Korn, Traube und Rind müssen gepflegt, sie können gezüchtet werden, aber niemals gemacht. Reichtum ist in agrarischer Sicht das Ergebnis biotischer Vorgänge, nicht technischer oder maschineller. „Kapital” bedeutet eingebrachte Getreideernte; volle Scheunen und Keller; heckendes, ferkelndes, fohlendes, frischendes, kalbendes, lammendes Vieh; die geworfenen Tierjungen, die einem einzigen Weizenkorn entstammende Ähre sind die „Zinsen”. Mensch, Tier und Pflanze sind aufeinander angewiesen. Sie sind Symbionten. Als Kinder und Kindeskinder der Erde bilden sie eine weitverzweigte Sippe. Der ganze Kosmos bildet einen Generationszusammenhang.
Wie auf Erden, so im Himmel. Im Anfang war nicht ein Macher, sondern die Gebärerin. Wenn aber im Anfang das Wort war, dann gewiß nicht der Logos der Philosophen, sondern der Schrei der Kreißenden und das Lallen des Säuglings, der Ruf nach der bergenden, nährenden und tröstenden Amma und Mamma. In fast allen Sprachen kehrt dieser Ausdruck wieder, ohne daß von Entlehnungen und Einflüssen die Rede sein kann. Das Mutter-Wort ist das Urwort aller Muttersprachen der Welt, so wie die Mutterschaft zu den Universalien der menschlichen Gattung gehört und, wie der Kampf, sich dem Erforscher der Phylogenese als älter denn die Species Homo sapiens, als Erbe millionenjähriger Stammesgeschichte bezeigt.
Wenn nach einem berühmten, meist mißverstandenen Wort Heraklits Kampf der Vater aller Dinge ist, dann ist die säugende, speisende und sprachbildende Frau die Mutter Friede aller Dinge.
Und eben dies ist die ältere, die grundlegendere, die mit dem Siegel einer Offenbarung bezeugte Kunde des Hesiod: die Menschen, Götter und Elemente, Himmel, Erde und Unterwelt als eine einzige Genesis, als Invasion von Geburten und Abergeburten erweisende Ur-Kunde des Seher-Sängers, des auf kosmische Auen leitenden Dichter-Hirten, Völker-Hirten und Lehrer-Hirten von Askra.
Natura ist wie die griechische physis ursprünglich und wesentlich nascitura, das heißt: Geburt, Geburt und wieder Geburt, Geburt und Wiedergeburt, Geburt im dreifachen Sinne, nämlich Gebären, Geborenwerden und das Ausgeborene. Was bei Thomas von Aquin anklingt, was dann bei Böhme und Baader in barocker Weise theosophisch zentral wird, das ist bei Hesiod protoplasmatische Vision. Die Geburt ist der wahre Ursprung aller Dinge. Alle Dinge und Wesen, eingeschlossen die Götter und Regenten der kosmischen Ordnung, haben eine Mutter.
Das Sein entbirgt und entbindet sich im Antlitz des maieutischen Hirten als natura-nascitura, als physis, als Zeugung, Keimen und Wachsen, als Triplizität der Geburt. Hesiod ist Pan-Natalist. Schlechthin alles ist geboren und gebürtlich, zeugend und gebärend, gezeugt und nicht geschaffen im Anbeginn der Schöpfungsfrühe.
Im Dämmer der Urgeburt war die Urmutter, parthenogenetisch zeugend, geschwängert und gebärend, durchaus matriarchal. Gilt sogar für die Spätzeit, das fünfte, von Hesiod beklagte eiserne Weltalter, der Vorrang der Frau, die nicht nur, wie der Mann, geboren wird, sondern auch gebären kann, so steht um so mehr der tellurische, der bionome und kosmogonische Vorrang des Weiblichen fest. Die Magna Mater mundi ist in Hesiods Schau schlichtweg omnipotent. Sie kann nicht nur verschwenderisch weltenbildend gebären, sondern auch unerschöpflich und unbegattet zeugen. Sie bedarf nicht der Paarung. Der Mann taucht erst später auf. Die Frau als Mutter ist uranfänglich und unvordenklich, der Mann hingegen sub specie aeternitatis zweitrangig, erst nachträglich hinzukommender Sekundant im liebenden Kampf der Geschlechter.
Der hesiodeische Kosmos ist ganz und gar matriarchal, matrifokal und matrizentrisch: mutterursprünglich, mutterbezogen und muttermittig.
Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und später die Erde,
Breitgebrüstet, ein Sitz von ewiger Dauer für alle
Götter …
Also setzt Hesiod nach Anrufung, Lobpreis und Eingedenken der ihm erschienenen Musen ein. Zuerst entstand das Chaos. Das ist nicht Poeterei. Das ist Ontologie in Hexametern, musisch gestiftete Ontophanie, Seinserscheinung und Seinsauslegung in eins. Auch hier erweist sich Hesiod als der Erste. Der erste europäische Dichter, der an mehreren Stellen seiner beiden Werke von sich selbst spricht, ist auch der erste europäische Philosoph.
Jahrhunderte vor Anaximander, Heraklit und Empedokles fragt er nach dem Ersten, Ursprünglichen, Primordialen. Was war zuerst? Und wie entwickelte, entband und entfaltete sich alles bis hin zur Gegenwart hic et nunc, hier und jetzt? Der den Anfang erblickende Hesiod zielt auf den Beginn des Weltprozesses, der im Heute des dichtend Fragenden, fragend Dichtenden mündet.
„Zuerst entstand das Chaos …” Hesiod gibt zu denken. Das entscheidende Wort ist gefallen im hundertsechzehnten Vers der Theogonie: Chaos.
Hesiod gibt zu denken: Im Anfang war das Chaos? Hier stock’ ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Chaos hoch unmöglich schätzen, ich muß es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Hilfe und Erleuchtung bringt das Wort selbst: Chaos. Wir denken dabei an das Wort der anderen Genesis, den im zweiten Satz des ersten Kapitels des ersten Buches Mosis stehenden Ausdruck tohu wa-bohu, der zur geflügelten Redensart geworden ist. Wir sprechen von Tohuwabohu, wenn wir Durcheinander, Ordnungslosigkeit, Wirrwarr meinen. Dies entspricht durchaus dem Sinn des hebräischen Wortes: „wüst und leer” war die Erde, die Gott im Anbeginn mit dem Himmel erschaffen hat. Tohu wa-bohu erscheint in der Bibel als völlig negativ. Der Wirrwarr ist unschöpferisch, ergebnislos, schlecht. Aus sich selbst vermag er nichts hervorzubringen. Dies kann nur Gott, der Herr der Schöpfung.
Das in Hesiods Genesis beschworene uranfängliche Chaos ist durchaus kein Tohuwabohu. Wenn wir genauer lesen, ist das Chaos auch gar nicht zuallererst. Es wird bloß als erste Emanation oder Ausgeburt des Welt- und Götterentstehungsvorgangs genannt. Namentlich ist Chaos das erste, kosmogonisch jedoch das zweite. Das erste wird von Hesiod nicht unmittelbar zur Sprache gebracht, wohl aber verhüllt. Die Hülle ist allerdings so durchscheinend, daß man an die im Altertum berühmten Gewebe von der Insel Kos, die kaum etwas vom Körper verbargen, denken muß.
Diese nahezu durchsichtige Hülle ist das Wort Chaos. Chaos géneto, das Chaos entstand zwar als erstes; doch eben dadurch, daß es entstanden ist, erweist es sich nicht als das allererste. Das wahrhaft Erste kann nur unentstanden sein. Nun hängt aber das griechische Wort Chaos, das Hesiod mit Bedacht verwendet, sprachlich mit chainein und chaskein zusammen: „gähnen”, „öffnen”, „klaffen”, „auseinanderspreizen”.
Das Chaos des Hesiod ist somit keineswegs das Nichts. Wo nichts ist, kann auch nichts gähnen, klaffen oder sich öffnen. Auch die Redensart von der „gähnenden Leere” setzt ja Seiendes voraus. Der leere Becher, der gähnende Abgrund sind nicht nichts, sondern Eigenschaften körperlicher Gegenstände. Ihr Nichts ist bezogen auf ein Etwas, das dieses relative Nichts umschließt und überhaupt erst bildet, untermauert, begründet und eben dadurch in Erscheinung treten läßt.
Ebensowenig entspricht das theogonische Chaos dem Tohuwabohu der biblischen Genesis oder der „rohen und ungeordneten Masse” (rudis indigestaque moles), von der Ovid in seinen „Metamorphosen” spricht. Ältester griechischer Sprachgebrauch unterscheidet sich vom biblischen und modernen. Sein Chaos war ganz und gar nicht „chaotisch”.
Chaos heißt Auseinanderklaffen. Hesiod sagte: Zuerst entstand das Auseinanderklaffen. Er sagt: Es entstand. Dies bedeutet, daß das Auseinanderklaffen nicht von aller Ewigkeit her war. Es ist entstanden (géneto). Als entstandenes ist Chaos somit bereits Teilabschnitt des Weltprozesses, wenngleich ein sehr früher.
Am Anfang entstand das Auseinanderklaffen. Wir fragen, was oder wer hier auseinanderklafft, gähnt oder sich auseinanderspreizt. Was klaffte und ließ dadurch eine Öffnung entstehen? Ahnend wagen wir Spätgeborenen zu sagen, was der Dichter nicht unmittelbar nennt. Was der Grieche Hesiod ehrfürchtig verschweigt oder als so selbstverständlich voraussetzt, daß es sich für ihn erübrigte, darüber Worte zu verlieren, sagen wir mit dem Vers des Deutschen Hölderlin:
O nenne, Tochter du der heiligen Erd,
Einmal die Mutter.
Wer sonst als die Mutter? Die all-eine, ursprüngliche, unvordenkliche Magna Mater, quae vivit et regnat in saecula saeculorum, um es in der feierlichen Sprache der Liturgie auszusprechen, die, wenn überhaupt irgendwo anders, hier geziemend und billig ist: die Große Mutter, die lebt und königlich regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit oder, wie man noch bis zu Luthers Zeit betete: von ewen zu ewen. Die urständige Allkönigin ist’s, die oder deren Metamorphose sogar noch der spätzeitliche Materialist Lukrez im Prooimion seines Atomgedichts hymnisch als Wonne der Götter und Menschen feiert (De rerum natura I, 1 - 44):
Weil denn du nur allein die Natur der Dinge regierest,
Ohne dich nichts hervor an die Pforten des himmlischen Lichts tritt,
Nichts den fröhlichen Trieb noch liebliches Wesen gewinnet …
Nicht Tohuwabohu klafft, nicht gähnt allverschlingendes nichtendes Nichts mit annihilierender Sterilität. Die Mutter liegt in Wehen. In rhythmischen Zuckungen eröffnen sie die Geburt. Keine Geburt ohne Wehen. Höhepunkt der die Schwangerschaft vollendenden, die Geburt einleitenden Wehen ist aber die mit Schmerzen verbundene Öffnung von Gebärmutter, Muttermund und Scheide. Geburt ist der mehr oder weniger qualvolle Vorgang des Dehnens, Öffnens und Klaffens, damit das Kind aus der Mutterhöhle herauskommt ans Licht. Die in Wehen sich auseinanderspreizende Mutter verhilft dem sie verlassenden Kind zur Geburt. Mit ihren Eröffnungs- und Austreibungswehen schenkt sie der Leibesfrucht das Leben. Aus dem menschlichen Fötus, der ihren Schoß verläßt, wird ein Menschenkind.
Wie auf Erden, so im Weltall. Wie bei den Menschen, so bei den Göttern. Geburtlichkeit ist das Gesetz des Lebens. Jede Geburt erweist sich aber seit alters — von ewen zu ewen — als trächtig hervorzeugendes, ans Licht der Welt zutage bringendes Gähnen, Sich-Öffnen und Klaffen. Keine Geburt ohne produktives, das heißt wörtlich: hervorziehendes, herausrücken lassendes und hervorlockendes „Chaos”. Jede gelingende Geburt ist ein fruchtbares Chaos. Dies gilt für Menschen, Erde und Sterne. Nietzsches Zarathustra spricht in der Nachfolge Hesiods das Geheimnis des Werdens aus: „Man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.”
O felix Chaos! Furchtbar fruchtbar, nicht Wirrwarr und Zerstörung, sondern schöpfungsträchtig und mutterwütig! Seliges Chaos der Welten- und Göttergebärerin, daß dir millionenmal mehr als der heiligen Maria der dogmatische wie kultische Würdename gebührt: Theotokos, Dei para, Dei genetrix, Bogorodica, Mater Dei, Mère de Dieu, Madre di Dio, Gottesgebärerin und Mutter Gottes. Darin aber gleichst du, himmel- und erdehervorbringende Madonna Hesiods, der christlichen Erzmutter, daß du den monotheistischen Juden ein Ärgernis, den mythosentfremdeten Griechen eine Torheit sein mußt durch deine Doppelgestalt: Jungfrau und Mutter, Kóre und Méter, Parthenos und Tokogonia, Virgo und Genetrix. Die Kore Kosmu, wie wir die hesiodeische Weltenjungfraumutter mit Fug und Recht heißen dürfen, gebiert unbegattet und ungepaart, rein parthenogenetisch die breitgebrünstete Gaia, die Erde, dann den Tartaros und Eros, von dem Hesiod sagt:
… er ist der schönste der ewigen Götter,
Lösend bezwingt er den Sinn bei allen Göttern und Menschen
Tief in der Brust und bändigt den wohlerzogenen Ratschluß.
Aus der ungeschiedenen matriarchalen All-Einheit der kosmischen Madonna, die wahrlich im Anfang ganz und gar mutterseelenallein war, entspringen und werden entbunden durch chaosvermittelte Geburt: Gaia, die Erde als Weltelement, unterschieden von der Scholle des Ackerbodens (Chthon), dann der unterirdisch dunkle Tartaros und zugleich der lichterfüllte, lebenversüßende, zum Leben verführende Eros, der die aufgebrochene Einheit durch vermittelte Fülle erneut bewirkt.
Halten wir einen Nu inne, um uns zu besinnen. Was Hesiod in diesen sieben Versen sagt, ist mehr als bloße Literatur. Ist mehr als erhabene Dichtung, wenngleich ineins höchste Poesie. Es ist divinatorische Philosophie, Kosmosophie und Ontosophie, noch von mythischen Urgewässern frischtriefende Vorwegnahme und Versiegelung des offenbaren Geheimnisses, zu dem sich spekulativer Tiefsinn erst in Jahrtausenden maulwurfsähnlich hindurcharbeiten mußte, ohne es bis heute völlig begriffen zu haben.
Wahrlich, schon Hesiod bezeugt auf seine Weise kraft ihm zuteil gewordener Offenbarung: „daß die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis heute” (Paulus an die Römer 8, 22), „daß die Dinge ihre Tränen haben” (Vergil: Aeneis I, 462), daß die „innerste und tiefste Geburt in der Mitte stehet und das Herz der Gottheit ist” (Böhme: De tribus principiis), „Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht; aus dem Dunkeln des Verstandlosen — aus Gefühl, Sehnsucht, der herrlichen Mutter der Erkenntnis — erwachsen erst die lichten Gedanken” (Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit). Sogar bei Hegel, dem Archäologen des Weltgeists, findet sich noch ein Widerhall der Hesiodschen Epiklese der Geburtlichkeit aller Wesen: „Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht — ein qualitativer Sprung — und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen des Baues einer vorhergehenden Welt nach dem andern auf, ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet … Dies allmähliche Zerbröckeln … wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt”. (Phänomenologie des Geistes, Vorrede; vgl. Philosophie der Religion II, 2, II, 2 a)
Geburt ist der Ursprung aller Dinge. Auch das, was spätere Geschlechter als gemacht erachteten, ist geboren, urständet im Schoß der Mutter. Hesiod spricht von nichts anderem. Nicht einmal Bachofen vermochte mit solch erhabener Monomanie den ursprünglichen Kosmos als Matriarchat, die Entstehung des Alls aus gebärerisch-mutterwütigem Chaos als eine einzige Gynogenese zu deuten.
Wahrlich, zuerst entstand das Choas und später die Erde …
Nun übersetzen wir getrost mit frommer Verwegenheit, den Blick auf die allmütterliche „Kore Kosmu” gerichtet:
Wahrlich, zuerst entstand ein Wehensturm, durch den der Allmutter Schoß sich klaffend weitete und öffnete, und daraus wurden geboren die Erde, der dunkelabgründige Tartaros und Eros.
Der Primat des Weiblichen ist offenkundig: zuerst die heiligungenannte Allmutter, die mutterseelenallein durch sich selbst ist; dann ihre Geburtswehen; dann das fruchtbare Klaffen der Chaos-Geburt; hierauf die Parthenogenese der eingeborenen Tochter Gaia, der Erde. Es könnte sein, daß Gaia mit Tartaros und Eros, den beiden männlichen Gottheiten, eine Drillingsgeburt bildet. Aber dies würde nicht das geringste an ihrem Vorrang ändern. Hesiod nennt sie feierlich an erster Stelle. Sie ist das erstgeborne Kind der in chaotischen Wehen liegenden kosmischen Madonna.
Der in seinem zweiten Gedicht „Werke und Tage” anläßlich der durch Pandora — die griechische Eva — übermittelten Übel das weibliche Geschlecht wenig galant behandelnde Hesiod erweist sich in seiner „Theogonie” als ein wahrer Meister Frauenlob. Er verdient diesen Ehrennamen mit noch größerem Recht als der Minnesänger Heinrich von Meißen. Für Hesiod ist, wie vielleicht sonst nur noch bei dem sanfteren, leiseren, um nicht zu sagen diskreteren Laotse, das Weibliche eine kosmische Potenz, und noch dazu eine dem Männlichen offenkundig überlegene. Laotse spricht im „Tao te king” (Kapitel 6) bloß zarter und kürzer aus, was auch Hesiod singt:
Der Geist des Tals stirbt nicht,
das heißt das dunkle Weib.
Das Tor des dunklen Weibs,
das heißt die Wurzel von Himmel und Erde.
Deutsch von Richard Wilhelm
quellgründe/geist/un-/sterblich:
er/ist/urtümlich/weibliche,
des/urtümlich/weiblichen/pforte:
er/ist/himmel/erde/wurzel.
Deutsch von Jan Ulenbrook
Der unsterbliche Tal-Geist der tiefliegenden Quellgründe ist der Genius des tiefen Ewigweiblichen; seine „Pforte” — manche Übersetzungen nennen sie ausdrücklich „Mutterschoß” (Ernst Schwarz) — ist der Ursprung von Himmel und Erde. Dies sagt Laotse, der übrigens einige Jahrhunderte nach Hesiod gelebt hat.
Was der Chinese beinahe flüstert, das prasselt bei dem Griechen in hexametrisch hallender Sturzflut von Zeugungen und Geburten hernieder. Kaum sind Erde, Unterwelt und Eros geboren, da gibt es kein Halten mehr. Chaos entläßt ein weiteres düsteres Geschwisterpaar aus ihrem Schoß: die Nacht (Nyx) und den ebenfalls unterweltbezüglichen Abenddämmer (Erebos, vgl. Europa = „Abendland”). Der inzestuösen Verbindung von Erebos und Nyx entspringen endlich zwei hellere Geschwister: der leuchtende Tag (Hemeros) und die Himmelsluft (Aither, Äther).
Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht. In dem Dunkel des mütterlichen Schoßes bildet sich heran das sonnenhafte Kind. Dem Dämmer des Unbewußten entspringen die Lichtblitze des Geistes, die Effulgurationen der vernehmenden Vernunft. Nächtlich kehrt der wache Tagmensch zurück in das Asyl des Schlafes, in die Höhle seiner Bewußtlosigkeit, um sich in deren Dunkel zu erfrischen. Nacht und Finsternis sind eher gewesen denn der Tag. Wie anders schmecken bereits die beiden Wörter, wenn wir sie bedächtig aussprechen, sie gleichsam auf unserer Zunge zergehen lassen, ähnlich wie man in alemannischen Landen sagt, daß man den Wein nicht trinken, sondern züpfeln müsse: der Alltag hier, die Allnacht dort … Von allen Frauen, die ihm lieb, sei die Nacht die schönste, sagte vor etlichen Jahren ein seltsamer Dichter. Das klingt wie ein Plagiat, dem Novalis entnommen, und steht doch, wenngleich mit ein bißchen andern Worten, schon in Hesiods „Theogonie” …
Gaia, chaosentsprungene, erstgeborene Tochter der Allmutter, entläßt alsbald ihrem Schoß, wieder parthenogenetisch, wie Hesiod ausdrücklich festhält: Uranos (den Himmel), die Berge und Pontos (das Meer).
Gaia, die Erde, erzeugte zuerst den sternigen Himmel
Gleich sich selber, damit er sie dann völlig umhülle,
Unverrückbar für immer als Sitz der ewigen Götter,
Zeugte auch hohe Gebirge, der Göttinnen holde Behausung,
Nymphen, die da die Schluchten und Klüfte der Berge bewohnen;
Auch das verödete Meer, die brausende Brandung gebar sie
Ohne beglückende Liebe, den Pontos …
Gaia zeugt und gebiert. Der Sternenhimmel Uranos ist ihr Sohn, dann aber auch ihr Gemahl, von dem sie sich völlig umhüllen läßt. Der Himmel, Uranos, ist eine männliche Gottheit, aber durchaus nicht der Schöpfer der Welt. Seine vorzüglichste Aufgabe ist es, Gaia, die eigene Mutter Erde, zu umarmen und zu befruchten. Anstelle der Kreation tritt bei Hesiod, nach den allerersten parthenogenetischen Akten in frühester Frühe, die Hierogamie, die heilige Hochzeit: Beischlaf und Schwängerung als sakrale Geschäfte mit kosmogonischen Folgen. Begehren, Umarmung und Orgasmen sind in hesiodeischer Schau kultische Vollzüge; ob ehelich oder außerehelich, ob exogam oder endogam oder sogar inzestuös, dies ist, zumindest in kosmischer Urzeit, alles eins.
Von dem, was damals — ab origine, in illo tempore, en arché — sich gewaltig begab, fällt noch Lichtglanz und Weihesinn auf die menschliche Geschlechtsliebe, auf die beständigste wie auf die flüchtigste Verbindung von Mann und Frau. Jede Liebesvereinigung auf Erden erscheint sub specie aeternitatis als Nachfolge des hieros gamos der Götter, der Myriaden hochzeitlichen Liebesfeste und Liebesbünde der Unsterblichen, denen sich das All verdankt.
Wie ein orgiastischer Katarakt durchzieht eine unaufhörliche Kette von Liebesgeschichten die gesamte Schöpfung. Eros, einer der allerfrühesten und der schönste der Götter, der selbst ewig unvermählt bleibt, ist immer im Spiel, wo Liebe auf Liebe trifft.
Hölderlin beginnt sein Gedicht „Lebenslauf”:
Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt
All uns nieder …
„Amor ist es, der uns zusammendrückt”, notiert sich Novalis, und er wiederholt damit, wie Hölderlin, Vergils Ruf (Bucolica 10, 69):
Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori
Alles besiegt Eros: wir auch weichen Eros.
Hölderlin, Novalis und Vergil haben Hesiod gelesen; Vergil trachtete sogar danach, mit seiner „Aeneis” als römischer Homer und mit dem Lehrgedicht über den Landbau „Georgica” sich als lateinischer Hesiod auszuweisen, so wie mit seinen Hirtengedichten als italischer Theokrit.
Der Poimèn-Poietes, der Hirt-Dichter Hesiod ist auch hier der Erste, der Archäus im paracelsischen Sinn des Wortes: samenreich durch die Jahrtausende fortzeugender, in immer neuen Signaturen und Konfigurationen gestaltenüberquellender Lebensdrang, élan vital abendländischer Dichtung, die das Seiende zur Sprache bringt und im Gewande der Schönheit zu denken gibt. Verglichen mit Hesiod ist Homer, obwohl zeitlich der frühere, ein Spätling. Hesiod kennt und nennt viele Gottheiten, die Homer bloß am Rande erwähnt oder völlig verschweigt. Gemessen an Hesiods göttlichen Hochzeiten, sind die Abenteuer der homerischen Olympier leichtfertige Affären, fast schon operettenhafte Travestien à la Jacques Offenbach. Ich sage dies nicht, um Homer herabzusetzen, dessen „Odyssee” zu meinen liebsten Büchern gehört und die durch nie wieder erreichte Schönheiten entzückt, die man bei Hesiod vergeblich suchen würde. Homer wird hier nur genannt, um die unvergleichliche Besonderheit und Eigenart des boiotischen Theogonikers herauszuheben. Hesiods Werk gibt uns Kunde von Hierophanien, die, wäre es verlorengegangen, die ausschweifendste Einbildungskraft eines Phantasiasten nie und nimmer hätte erfinden können. Eben deshalb darf Hesiod gerade in götterlos dürftiger Zeit erwarten, „daß gepfleget werde der feste Buchstab, und Bestehendes gut gedeutet”.
Gaia, die breitbrüstige, allernährende Mutter Erde, zeugt und gebiert den Uranos, den bestirnten Himmel, auf daß sie, bisher trotz aller Geburten jungfräulich ganz und gar, endlich auch die Beglückungen innigster Zweisamkeit erführe:
Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blüten-Schimmer
Von ihm nun träumen müßt.
Dies ist ein letztes, sublimes, sozusagen in zärtlichstes Pianissimo entrücktes Echo Hesiods: die Erde erzeugt den Sternenhimmel, um durch die nächtliche Umarmung des eigenen Sohnes einmal auf die übliche Weise Mutter zu werden.
Der Inzest ist unvermeidlich. In jener kosmischen Frühzeit sind alle Wesen eng blutsverwandt, Töchter und Söhne einer einzigen Mutter. Was manche als Perversität bestürzen mag, dient geradezu der Normalisierung des Weltprozesses. Der außergewöhnliche Folgen zeitigende Mutter-Sohn-Inzest von Gaia und Uranos bewerkstelligt die Beschleunigung der Evolution, eine offenkundige Bereicherung und Multiplikation des Kosmos. Die hierogamische Blutschande, die eine unerhörte Maßlosigkeit zu sein scheint, wirkt als Akt der Berichtigung und Neuordnung des Lebens. Darüber hinaus steigert er dessen Fruchtbarkeit, Fülle und Vielgestalt. Der Inzest fungiert bei Hesiod als Initiative der normalen Sexualität. Geschlechtliche Fortpflanzung, Elternzeugung und schlußendlich sogar Ehe, Familie und Sippentum werden durch blutschänderischen Frevel angeregt, veranlaßt und eingeführt.
Hesiod gibt damit zu verstehen, daß am Anfang so vieler Dinge und Einrichtungen, die uns ehrwürdig und teuer sind, etwas Ungeheuerliches steht. Die Untat als Urheberin guter, lebensnotwendiger oder lebendienlicher Schöpfungen und Werke — ob Kult, Seßhaftigkeit, Städtebau, Staat, Recht, Friedensordnung, Verfassung: läßt sich nicht allemal zu Beginn ein Umsturz, Mord oder sonst ein Tabubruch ausmachen, oft nur in mythischen Bildern überliefert? Der Brudermord bei der Gründung Roms, die Kriegszüge Alexanders als Grundlegung eurasischer Ökumene, die Exzesse der Revolutionen als Feuerzauber der Neuzeit … Eine alte rumänische Ballade, die wahrscheinlich thrakischen, möglicherweise sogar vorindoeuropäischen Ursprungs ist, besingt das Werk des Baumeisters Manole (Emanuel, „Gott mit uns”). Im Traum empfängt er die Offenbarung, daß das von ihm entworfene Haus nur dann dauern könne, wenn ein lebender Mensch in dessen Gemäuer für immer eingeschlossen werde. Dies geschieht denn auch am nächsten Morgen. Der geopferte Mensch als Grund-, Eck- oder Schlußstein dessen, was Bestand haben soll … Man kann diese Legende als sadistische Phantasmagorie kannibalisch-unaufgeklärter Weltalter abtun, um den Preis, daß ihr anzüglicher Sinn verborgen bleibt. Spricht sie nicht mit schauervoller Deutlichkeit unumwunden aus, was Hesiod wußte, was alle ursprünglichen Überlieferungen mehr oder weniger kryptisch bekunden: Kein Gebilde, keine Stiftung, kein Bauwerk hat Dauer, wenn es nicht dem Ungeheuren und Schrecklichen benachbart, wenn es keine Geburt aus tödlich scheinendem Dunkel ist.
Ich behaupte nichts, ich frage nur ahnungsvoll, belehrt durch Hesiod, den Dichter des kosmogonischen Inzests.
Gaia, die Erdfrau, paart sich mit ihrem Himmelssohn Uranos. Hesiod erinnert damit an uralte Mythen, die schon zu seinen Lebzeiten verblaßt und kaum noch verstehbar waren. Er hält fest, daß einst im gesamten östlichen Mittelmeerraum wie in Kleinasien, Ägypten und Mesopotamien Kulte verbreitet waren, in deren Mitte eine Muttergöttin stand, die zu ihrem Geliebten meist ihren eigenen Sohn oder auch Bruder auserkoren hatte. Die Namen des Paares wechseln, aber alle folgen ein und demselben Urbild: Innana und Dumuzi, Ischtar und Tammuz, Anat und Baal, Aschera und El, Astarte und Adonis, Kybele und Attis, Isis und Osiris, Rheia und Kronos … Sogar bei Dante klingt noch abgewandelt etwas davon an, wie überhaupt im katholischen Marienkult, wenngleich, wie sich von selbst versteht, in spiritualisierter, mystisch-allegorischer Form:
Vergine madre, figlia del tuo figlio
Umile ed alta più che creatura
Termine fisso d’eterno consiglio,
Tu sei colei che l’umana natura
Nobilitasti si, che il suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
In der Übersetzung von Stefan George:
Jungfrau und Mutter! Tochter deines sohnes!
Voll demut und voll würde wie kein wesen
Nach vorbestimmtem rat des ewigen Thrones.
Du machtest unsre menschheit so erlesen
Und edel, dass der schöpfer selbst geruhte
Geschöpf zu werden dessen du genesen.
Hesiod erinnert an Zeiten, in denen Mutter-Sohn-Inzucht und Geschwisterehen offenbar nicht grundsätzlich für anrüchig, sondern als heiliges Vorrecht erlesener Ausnahmemenschen erachtet wurden, als imitatio divina der heiligen Hochzeiten, die Gaia und ihr Sohn Uranos feierten.
Durch das hierogamische Beilager von Erde und Himmel entsteht recht eigentlich der Kosmos, wie ihn sich so gut wie alle archaischen Völkerschaften vorstellen: der von den Sternensphären umkreiste, von Regen, Donner und Blitzen befruchtete Boden, der uns trägt, nährt und im Tode wieder aufnimmt. Der biblische Gottvaterfluch, daß Adam zur Erde wiederkehren werde, wie er von ihr genommen sei, lautet in von Hesiod inspirierter matriarchalischer Auslegung schlicht und einfach: Der Mutter bist du ausgeboren, also wirst du zurückfinden zur Mutter … Himmel und Erde, einander herzend, bilden gleichsam das Haus der Welt, den vom Sternengewölbe überzelteten Schollengrund aller Lebewesen, die von oben beleuchtete Weltenhöhle, aus der wir eigentlich gar nicht fallen können, weder im Leben noch im Tode.
Nun aber gibt es kein Innehalten mehr, der Weltprozeß wird erst jetzt völlig entfesselt. Dem heiligen Inzest von Gaia und Uranos entsproßt als erster Titan Okeanos, der von Pontos, dem gewöhnlichen Meer, zu unterscheidende Weltozean, den sich die Alten als die Erde ringförmig umkreisenden Strom vorstellten. Dann gebiert die uranisch befruchtete Erdgöttin die übrigen der insgesamt zwölf Titanen, deren jüngster Kronos ist, „dieses schreckliche Kind”. Hierauf folgen drei hundertarmige Riesen und die ebenfalls gewaltigen Kyklopen, welche später dem Zeus als Schmiede dienen werden.
Uranos wird bange angesichts dieser kraftstrotzenden Brut. Eifersüchtig versteckt er sie tief im Schoß der Erde. Er befördert sie somit auf unvorstellbare Weise zurück in den Leib seiner Mutter und Gattin Gaia. Er mißgönnt ihnen das Licht und zwingt die Mutter der Riesenkinder, auf die Freuden weiterer Geburten und heranwachsender Nachkommenschaft zu verzichten. Damit löst er eine Familientragödie aus, die alle Ehedramen der Welt, von Sophokles’ „Oidipus” über Strindbergs „Der Vater” bis zu Karl Schönherrs „Der Weibsteufel” und Eugene O’Neills „Trauer muß Elektra tragen”, durch ihre kosmogonische Dimension in den Schatten stellt.
Die unter der Last der gewaltsam in ihrem Schoß zurückgehaltenen Kinder stöhnende Gaia schmiedet grollerfüllt eine gewaltige Sichel. So wie sie sich zuerst mit ihrem Sohn Uranos verbunden hatte, so verbündet sich die Enttäuschte nun gegen ihn mit dessen eigenen Kindern. Sie fordert Rache für die ihr von Uranos angetane Schande. Die gekränkte Gaia schmiedet nicht nur die Sichel, sondern einen Verschwörerbund. Aber alle faßt Entsetzen, als sie vernehmen, was die in ihrer Würde beleidigte Mutter ihren Kindern ansinnt. Einzig der jüngste der Titanen, „der listenmächtige” Kronos, erkühnt sich, den Frevel des Vaters durch einen anderen zu sühnen:
Mutter, so will denn ich dir dies versprechen und möchte
Gern das Werk vollenden, denn unser verrufener Vater
Kümmert mich wenig, zuerst hat er ja übel gehandelt.
Und dann geschieht etwas Ungeheuerliches, das sich allenfalls mit dem apokalyptischen Krieg zwischen Michael und den abgefallenen Engeln vergleichen läßt. Die Eichendorffsche Mondnachtidylle, wo der Himmel die Erde leise küßt, endet unversehens in einer von der Mutter eingefädelten, vom jüngsten Sohn vollstreckten Bluthochzeit mit äonischen Auswirkungen:
An kam mit der Nacht der gewaltige Uranos, sehnend
Schlang er sich voller Liebe um Gaia und dehnte sich endlos
Weit. Da streckte der Sohn aus seinem Verstecke die linke
Hand und griff mit der rechten die ungeheuerlich große,
Schneidende, zahnige Sichel und mähte dem eigenen Vater
Eilig ab die Scham und warf im Fluge sie nieder
Hinter sich …
Der Muttersohn Kronos tötet den Himmelvater Uranos nicht, aber er entmannt ihn. Angestiftet von der Erdmutter, beraubt er ihn des Gemachtes während des nächtlichen Liebesspiels. Aber bei Hesiod mindert nicht einmal eine mutterrächerische, männlichkeitsmordende Meintat die All-Fruchtbarkeit.
Das von Kronos amputierte Geschlechtsglied des Himmelvaters fällt durch die Sphären zur Erde herab. Das ihm entquellende Blut des verstümmelten Uranos sickert in Gaias Schoß. Darauf enstehen schließlich die drei Erinnyen, das waffenschimmernde Riesenvolk der Giganten und, als lieblicheres Gegengewicht zu soviel Entsetzen, die ersten Nymphen, die sogenannten Meliaden, weil sie vorzugsweise in einer Esche (griechisch melia) wohnen. Spätere Zeiten, die den Nymphen und Feen abhold waren, machten dann aus der Esche den Baum, in dem die Hexen hausen, ausgelassene Sabbate abhalten und aus dessen Holz die Stiele der Besen anfertigen, auf denen sie rittlings zum Blocksberg entfahren.
Von der Esche stammen aber sowohl nach Hesiod als auch nach germanischem und iranischem Mythos die Menschen ab. Genauer wäre zu sagen, daß nach Hesiod das Menschengeschlecht des ehernen Zeitalters eschengeboren sei, während der spätantike Enzyklopädist Hesychios von Alexandrien alle Sterblichen diesem Baum entsprungen sein läßt.
Uralt ist ja der Glaube, daß Bäume und Menschen verwandt, daß Blut und Harz im Grunde ein einziger Saft seien. Völker sind Menschenwälder, Wälder sind Baumvölker. Der kosmische Baum, an dem das Schicksal der Welt hängt, ist die dem Odin heilige Esche Yggdrasill. Esche ist aber im Griechischen ein Synonym für Lanze oder Speer. Aus dem Holz, aus dem sie selber zu sein wähnten, fertigten die alten Griechen wie Germanen ihre Waffen an. Bei Homer (Ilias II, 542 ff.) heißt es deshalb:
Rasch ihm folgte sein Volk mit rückwärtsfliegendem Haupthaar,
Schwinger des Speers und begierig, mit ausgestreckter Esche
Krachend des Panzers Erz an feindlicher Brust zu durch-
schmettern.
Die lebenschenkende und holden Nymphen gesellte Esche wird durch männliches Handwerk zum Todesholz. Bäume wie Krieger werden gefällt, sind im Tode: Gefallene. Noch zur Ritterzeit umpflanzten deshalb Fürsten, Grafen und Vögte gerne ihre Burgen mit Eschen. Daran erinnern auch die in deutschen Landen so häufigen Ortsnamen Esch, Eschbach, Eschau, Eschdorf, Eschelbach, Eschelbronn, Eschenau, Eschenberg, Eschenbruch, Eschenhausen, Eschenlohe, Eschenrode, Eschwege, Eschweiler und manche ähnliche. Der ritterliche Dichter des „Parzival”, Meister Wolfram, nannte sich selbst immer „von Eschenbach”. Die vielen Speere, die in den Turnieren, Tjosten und Schlachten des Gralsepos geschwungen und zerbrochen werden, sind ebenso aus Eschenholz wie die Kampfstangen der Helden Homers und der Schaft der Lanze, mit dem der römische Soldat in die Seite des tot am Kreuze hängenden Nazareners stieß.
Wegen des lieblichen Geschmacks des Saftes insbesondere der Mannaesche, den die Zikaden wie Nektar schätzen, galt die Esche den Griechen nicht nur als gewachsenes Nymphäum, Lebensbaum und Waffenholzlieferin, sondern geradezu als „Süßholz”. Die griechischen Namen für Esche (melia) und Honig (meli) sind fast gleichlautend. Die Meliaden sind also honigspendende Manna-Mädchen. In dieser Eigenschaft erinnern die Eschennymphen ans Goldene Zeitalter, das von so manchem Volk mit dem Honigseim zusammengebracht wird. Die ursprünglichste, naturgegebene Speise der Götter, angemessen dem von ihnen genossenen wesenhaften Glück, ist nicht die Ambrosia, sondern der Honig, der wunderbar von selbst aus Blumenblüten und Baumkronen herabtaut. Pasi theois meli, „Allen Göttern Honig”, lautet die Inschrift eines Tontäfelchens aus Knossos, das schon etwa achthundert Jahre alt war, als Hesiod seine „Theogonie” schuf.
Sogar der seines Zeugungsgliedes beraubte Uranos ist noch erstaunlich fruchtbar, bringt durch das grausam vergossene Blut Erinnyen, Giganten und Eschennymphen hervor. Schließlich purzelt der vom Himmel auf die Erde herabgefallene Phallos bergabwärts ins Meer. Hier aber geschieht das Wunder aller Wunder, wandelt sich Entsetzen urplötzlich in Entzücken, abscheuliche Entmannung in anmutsvollste Weibwerdung:
Aber sobald dann die Scham mit der stählernen Sichel geschnitten
Und sie vom Lande gekollert hinab in das brausende Weltmeer,
Trieb sie lange dahin durch flutende Wellen; da hob sich
Weißlicher Schaum aus unsterblichem Fleisch, es wuchs eine Jungfrau
In ihm empor, sie nahte der heiligen Insel Kythere
Erst, doch gelangte sie dann zum ringsumflossenen Kypros.
Trat ans Land die Göttin, die hehre, herrlich und Blüten
Sproßten unter den Schritten der Füße, und Götter und Menschen
Nennen sie nun Aphrodite …
Schaumgeborene Göttin und Kythereia im Kranzschmuck,
Kyprosentstandene auch, weil entstiegen der Küste von Zypern
Und auch Schamerfreute, weil aus der Scham sie entsprungen.
Eros geleitete sie, und der herrliche Himeros (Liebessehnsucht) folgte,
Als die soeben Geborne zur Sippe der Götter emporstieg.
Dieses Ehrenamt und Anteil ward ihr von Anfang,
Unter den Menschen sowohl wie unter den ewigen Göttern:
Jungfräuliches Gekose und frohes Lachen und Arglist,
Süßes Ergötzen und Wonne und Liebe und schmeichelnde Milde.
Dies ist die Geburt der Aphrodite, die Theophanie der „Schaumgeborenen”, denn aphros heißt im Griechischen Schaum. Aus bluttriefendem phallischen Fleisch wird Meeresschaum, und aus schaumgekrönter Woge auftaucht wollustatmend Anadyomene, die Ingestalt lockenden Weibtums, Götter wie Menschen erfreuende Frau Wonne, die die Römer mit Venus in eins setzten, so wie ihre Begleiter Eros und Himeros mit Amor und Cupido.
Eine andere, eine archaischere, gewaltigere Antike führt uns Hesiod vor Augen als die bereits vom Hellenismus, vollends von Ovid gemilderte, ins Spielerische übersetzte Olympierwelt; eine andere Aphrodite als die uns durch die Bilder Botticellis, Tizians, Giorgiones, Raffaels, Tiepolos, Renis, Velasquez’, Poussins und Ingres’ vertraute Schönheitskönigin; eine kosmische Gottheit, die in Anmut und Liebreiz verjüngt übersetzte Gaia, nicht aber das manchmal ein wenig gschamig fröstelnde, manchmal etwas jungmädchenhaft kokette, manchmal sexbombengleich laszive Mannequin, das uns die letzten fünfhundert Jahre abendländischer Malerei so oft beschert haben. Hesiods dem Meer entstiegene Aphrodite heißt auch Urania, „die Himmlische”, nicht weil sie die Patronin unsinnlich vergeistigter, gar frömmelnd jenseitszugewandter Liebe ist, sondern weil sie dem abgeschlagenen Penis des Himmelvaters Uranos entstammt.
Was spätere Dichter Aphrodite-Venus an Reizendem, Lüsternem und Possenhaftem ausschmückend unterstellt und beigefügt haben, kann sich ein findiger Kopf ausdenken, heiße er nun Honoré d’Urfé, Sir Philip Sidney, Claude Crébillon, Christoph Martin Wieland, Jacques Offenbach oder auch Carl Spitteler. Das aber, was Hesiod schildert, ist im strengsten Sinne des Wortes unerfindlich und eben deshalb unergründlich, unausschöpfbarund unvergeßlich. Eine Szene wie die der Geburt der Aphrodite läßt sich nicht ersinnen. Sie muß in unvordenklicher Frühe — en arché, in principio, in origine — eräugt worden sein. Hesiod hat sie entweder selbst „gesehen” oder bezeugt, was lange vor ihm einem anderen visionär offenbart wurde. Nur ein einziger neuerer Dichter, der halbvergessen ist, hat einmal, ohne Hesiod zu nennen, sich der Theogonie genähert; ich meine Wilhelm Heinse:
„Und die Liebe ward geboren, der süße Genuß der Naturen füreinander, der schönste, älteste und jüngste der Götter, von Uranien, der glänzenden Jungfrau, deren Zaubergürtel das Weltall in tobendem Entzücken zusammenhält. Und alle lebendigen Geschöpfe erhaschten in diesem Getümmel ihren Anfang; und vermehren sich nach alter Art immer wieder aus einem kleinen neuen Chaos.”
Dies ist hesiodeisch gedacht, wenngleich mit etwas andern Worten ausgedrückt. Bei Hesiod ist Eros, im Unterschied zu Heinse, nicht der leibliche Sohn der Aphrodite Urania, sondern nur ihr gleichsam an Kindes Statt angenommener Begleiter. Er ist ursprünglicher als die Mutter der Wonne, nicht Uranide, sondern gleichzeitig mit Gaia und Tartaros aus dem „Chaos” hervorgegangen, der erste Lichtstrahl, der wahre „Luzifer” und „Phosphoros”, Lichtbringer und Lichtträger in dunkler Welt, nicht selbst zeugend, sondern Prinzip jeglicher Zeugung, in jeder Umarmung gegenwärtig, fruchtbringender Beschwinger und Bezwinger der Leiber und Seelen.
Und nun Aphrodites Geburt, ein wahrer Sonnenaufgang nach dem schaurigen Gemetzel in grauser Nacht, von Hesiod besungen mit Worten, die später Sappho von Lesbos aufgreifen, fortspinnen und weitersingen wird. Hesiod stiftet Stichwort, Losung und Tonhöhe. Durch die Jahrhunderte hallt der von ihm angestimmte Gesang, fruchtbar wie die in ihm sich aussagende Genesis. Ein Geschlecht sagt es dem andern, ein Dichter vermittelt Lobpreis und Kunde der Götter dem folgenden. Strophe wechselt mit Antistrophe, Chor mit Chor in psalmodierendem Jubel, so daß ein einziges konzertantes Oratorium die Antike durchbraust, symphonisch geordnet: Gesänge, Gebete und Gesichte in eins, Hymnen, Dithyramben und Enkomien der Lyriker und Tragiker, der Rhapsoden und Kitharöden, der Liturgen und Symposiarchen, der Choreuten und Musageten, antiphonischer Lobpreis der seligen Unsterblichen, jeder Antwort und Echo Hesiods, Wechselgesang mit dem Archäus, der im Anfang anstimmend Leitwort und Parole gab.
Aphrodites Epiphanie ist kein Ende, sondern neuer Anfang, ekstatische Erneuerung des Ursprungs, Aufbruch zu neuen Zeugungen, Allbefruchtung und Panspermie. Die goldene Kette der Geschlechter wird weiter und weiter in immer neuen Zyklen, in denen auch Götterweltkriege nur gewittrige Zwischenspiele und vorübergehende Zuckungen sind: Aufbruch und Taumel kosmogonischer Orgien, in denen kein Glied nicht trunken ist, Exzesse der Verschwendung und Preisgabe, liebender Krieg, kriegerische Liebe, bacchantische Protuberanzen eines bleibend chaosgebärerischen Weltalls, das nicht fertig und zu Ende ist, sondern in immerwährender Geburt erzittert. Kampf und Katastrophe erweisen sich wie Liebe und Hervorbringung als Ausdruck ein und desselben Weltgesetzes, des Götter wie Menschen bergenden Kosmos, den weder ein Gott noch ein Mensch gemacht hat, der eine einzige allumfassende Genesis ist, welcher sich sämtliche Wesen verdanken.
Hesiod ist ganz und gar Genealoge, der einen Götter-Gotha erstellt, mit heiliger Pedanterie und feierlichem Lobpreis die Verwandtschaft aller Elemente und Wesen rhythmisch entrollend in einem wahrhaften Carmen saeculare. Ob im Himmel, auf Erden oder in der Unterwelt, ob zu Lande, zu Wasser oder in den Lüften, in allem Lebendigen pulst gleiches Blut. Und es gibt für Hesiod nur Lebendiges. Was Tod, Vernichtung und Untergang zu sein scheint, ist bloß Gestaltwandel, Bezähmung und Neuordnung. Die Kleinfamilie ist nichts als ein kümmerlicher Rest. Einander befehdende Völker sind göttlichentsprungene Geschwister, oft Nachkommen morganatischer Mischungen aus frühen Zeiten, da sich noch Unsterbliche sterblichen Frauen, Kronidentöchter sterblichen Jünglingen gesellten. Unsere Verwandtschaft ist größer als wir wähnen. Der Alltag verbirgt uns die Goldfolie der wahren Ahnentafel. In uns allen strömt königliches Blut, bei dem einen mehr, bei dem andern weniger. Wir alle sind Kinder, Enkel und Abkömmlinge, Kognaten, Angeheiratete und Affiliierte einer matriarchalen Dynastie. Jeder einzelne ist ein blühender Zweig vom Mutterstamm, jede Kleinfamilie bloß eine Filiale des Mutterhauses, des unter dem Namen Gaia firmierenden Großunternehmens für Götterproduktion.
Hesiods rhapsodische Genealogie entproletarisiert auch noch den Geringsten von uns, sogar das Kind kleiner Leute ist göttlich versippt. Hesiod aristokratisiert den Menschen, indem er ihn nicht als Erzeugnis eines Töpfers eräugt, sondern als fortzeugende Zeugung einer Mutter, als Ausgeburt und Anverwandten der Gynaikokratin Gaia. Wir müssen nur in die Frühe zurückblicken, um zu gewahren, wie sehr wir verwandt sind. Das ist Hesiods Frohbotschaft.
Den Modernen mögen seine Genealogien und Stammbäume überflüssig weitläufig und ermüdend müßig vorkommen, doch für Hellas stifteten sie ein Gemeinschaftsbewußtsein, wie es Staat und Politik nicht zuwege brachten, sondern nur der begeisterte Dichter.
Wer Hesiod einmal zu lesen begonnen hat, wird von dessen kosmogonischen Ahnentafelbildern sowenig gelangweilt sein wie ein Ikonenliebhaber von der hieratischen Monotonie der im Grunde nur ein einziges Urbild, immer neu abwandelnd, wiedergebenden Kultgemälde. Hesiods Götternamen sind wie kostbar gefaßte Edelsteine in den Text eingesetzt; das verbindet ihn mit sonst so unterschiedlichen Meistern wie dem Georgier Schota Rustaweli und dem Toskaner Dante Alighieri, die ebenfalls immer wieder perlen- und juwelengleiche Metaphern, Antithesen und Wortfiguren aneinanderreihen. Wie Zettel und Einschlag bilden genealogisch-etymologischer Prunk und epische Erzählung das Gewebe des Göttergedichts.
Aphrodite ist beileibe kein Ende, sondern nur Auftakt, Vorspiel und Übergang zu neuen hierodulischen Zeugungen und Geburten. Welch ein Gewimmel von Paarungen, von Göttersöhnen und Göttertöchtern, haarsträubend und schamlos nicht erst für christliche, gar puritanische Geister, sondern schon in der Antike, wenige Jahrhunderte nach Hesiod, nicht mehr recht verstanden, als Pornographie im Gewande der Theologie und pansexualistische Obszönität verunglimpft.
So schon von Heraklit und Xenophanes, die doch wahrlich noch ursprungnahe Denker waren. Bereits ein halbes Jahrtausend vor Christus, kaum zwei Säkula nach Hesiod empfanden einzelne Geister es unerträglich, den Göttern Geilheit, Gattung und Geburt „anzudichten”, was man nun sittenstreng richterlich dem Sänger vorwarf. Man wollte Götter ohne Unterleib, überhaupt leiblose Götter, denaturierte und depotenzierte Götter, sterile und spirituelle Götter, die ganz rein, nicht aber nackt sein sollten. Götter ohne Geschlecht, intelligible Persëitäten und ontologische Hypostasen, nicht aber generative, sich überschäumend fortpflanzende und hoheitlich zügellos über alle Satzungen bürgerlicher Wohlanständigkeit hinwegsetzende Götter.
Hingegen Hesiods überschwängliche Freude am Getümmel theogonischen Werdens! Kaum ist Aphrodite dem Schaum entstiegen, da gebiert die Nacht, die früher schon den Tag und den Äther geboren hat, im Gegenzug eine ganze Brut dunkler Gestalten: Schicksal (Moros), Finsteres Ende (Ker), Tadelsucht (Momos) und Tod (Thanatos), Drangsal (Oizys) und Vergeltung (Nemesis), aber auch Schlaf (Hypnos) und Traum (Morpheus). Obwohl mit Erebos vermählt, bringt sie parthenogenetisch des weiteren hervor die Hesperiden („Abendtöchter”), Moiren („Lebensfadenspinnerinnen”) und weitere Wesen, die sich ihrerseits fortpflanzen: Apate („Trug”), Geras („Alter”), Philotes („Liebeslust”) und Eris („Streit”). Jeder Name emblematisches Bild, heraldische Ikone, zu langbedächtiger Betrachtung stimmendes Mandala!
Nachdem Uranos entmannt ist, gibt sich Mutter Erde ihrem anderen Sohn hin, dem Meergott Pontos. Dieser inzestuösen Verbindung entspringen weitere Kinder, darunter Thaumas (das gestaltgewordene Staunen oder Wunderbare) und der später von Poseidon etwas in den Schatten gestellte weitere Seegott Nereus, von dem es heißt, daß er untrüglich wahrspreche, und der wohl deshalb auf verborgenen Umwegen in den christlichen Heiligenkalender gelangt ist …
Mit Nereus, dessen Mutter zugleich seine Großmutter ist, wird plötzlich alles wieder heiter, sobald er sich mit der Okeanide Doris vermählt. Welch ein Bild: die fünfzig lieblichen Töchter, Nereiden oder Doriden genannt, jede mit Namen begabt! Eine Ernte holdester Ausgeburten, väterlicher- wie mütterlicherseits meerentsprungen, eine Scheune voller Mädchen, in kristallenen Wogen sich ergötzend, letzend und scherzend. Mittelmeerisches Glück, jede Welle sich in einem bezaubernden Antlitz inkarnierend, Wasser gestalthaft geballt, gauklerisch zerfließend und erneut mutwillig spielerisch sich verkörpernd in immer aufs neue entzückenden jungfräulichen Metamorphosen!
Schmeichelndes, trübeloses, schmelzendes Glitzern und Flitzen, Locken und Kosen, Dichter, Leser und Seefahrer berückend, schon Hesiod dazu verführend, daß er einundfünfzig Namen nennt, obwohl er ausdrücklich von nur fünfzig Meernymphen spricht …
Welches Schwelgen in Namen, Taufe der wassergeborenen Kinder, heiligsprechende Schaumschlägerei, überbordende Hagiasmen … Hesiod ward gegeben ein Mund, evokatorisch lobpreisend große wie zarte Dinge und Wesen zu nennen … Welch arioses Rezitativ, diese Perlenkette sinnhaltig wohlklingender Namen: Ploto, „die Schimmernde”; Eukrante, „die Wohlgeführte”; Amphitrite, „die Rauschende”; Eudore, „Schöngeschenk”; Galene, „Windstille”; Glauke, „die Blauglänzende”; Speio, „die Grottige”; Kymothoë, „die Wogenschnelle”; Halia, „Salzflut”; Eulimene, „die vom guten Hafen”; Agaue, „die Hehre”; Erato, „Sehnsuchterweckerin”; Eunike, „Schönsiegerin”; Pasitheia, „Allgöttliche”; Dynamene, „mächtig Andrängende”; Pherusa, „Bringende”; Nesaia, „Inselwohnerin”; Aktaia, „Küstenwohnerin”; Panope, „Allblickende”; Galateia, „Milchantlitz”; Hippothoë, „Stutengeschwinde”; Kymodoke, „Wellenauffangende”; Kymatolege, „Wellenbesänftigerin”; Eione, „Strandmädchen”; Glaukomene, „Blausinnige”; Pontoporeia, „Meerdurchlässige”; Polynoë, „Vielsinnige”; Lysianassa, „Lösende”; Euarne, „Schönquellende”; Menippe, „übermütiges Füllen”; Eupompe, „Wohlbegleiterin”; Pronoë, „Vorsorgliche” …
Welche Fülle der Namen, jeder eine Facette des Meeres in all seinen Anblicken, Stimmungen und Leistungen! Jeder Name der Melusinenlitanei Beschwörung und Entzücken, Muschelmusik und Mannesrausch, nicht erst den gelehrten Antiquar bezaubernd, sondern von jeher griechischen Ohren liturgischer Wohlklang, apostrophischer Schmuck und Arznei halb hypnotisierender, halb aufreizender Harmonien. Goethes „Klassische Walpurgisnacht” im zweiten Teil des „Faust”, Claude Debussys von Mallarmé inspiriertes Orchesterwerk „L’après-midi d’un Faune” und noch Saint-John Perses „Amers” sind Widerhall der maritimen Apotheose Hesiods, der nichts götterleer sich vorstellen, nichts Gottverlassenes schauen kann, wohin immer er blickt. Von Azimut zu Azimut, vom Nadir zum Zenit, ist alles göttervoll, erfüllt von Göttergeburten, von göttlichen Scharen bevölkert, verwaltet und verherrlicht.
Mit Hesiod zu beginnen heißt, kein Ende finden zu können. Nicht einmal ein knappes Drittel seiner „Theogonie” habe ich zusammenraffend vorgestellt. Auch die Nereiden sind noch ursprungsnahe Weltenfrühlingswesen. Auf Uranos folgt Kronos, aber auch Kronos wird gestürzt durch seinen eigenen Sohn, der dann die Weltherrschaft antritt: Zeus. Welche Wendepunkte habe ich noch gar nicht berührt: Titanenkampf; Prometheus’ Opfertrug, Feuerraub, Bestrafung und Erhöhung; Pandoras verhängnisvolles Erscheinen; Atlas’ Weltenlast und Herakles’ Taten; die Hierogamien des Zeus mit Metis, Themis, Eurynome, Demeter, Mnemosyne und schließlich Hera. Wieviel wäre noch nachzutragen: Hesiods Unterwelt, seine Hymne auf Hekate, seine Nennung der Okeaniden, seine Schilderung des mit weltuntergangsähnlichen Verwüstungen einhergehenden Höllensturzes von Typhoeus, die Geburt der Athene, der Chariten und der Musen, des Hephaistos und der Persephone, der Zwillinge Apollon und Artemis … Aber sogar dann wäre ich noch nicht am Ende, denn es blieben noch die „Werke und Tage”, sein zweites großes Gedicht, wiederzugeben: die ausführlichere Fassung des Prometheus-, Epimetheus- und Pandora-Mythos, die Lehre von den fünf Weltaltern, das Hohelied der Gerechtigkeit und Arbeit, Hesiods Vorwegnahme des benediktinischen Imperativs „Bete und arbeite!”, seine Hausväterratschläge und Bauernkalenderweistümer … Hesiod und kein Ende; Hesiod, von dem Goethe rühmend sagt, daß bei ihm „Poesie, Religion und Philosophie ganz in eins zusammenfallen” … Hesiod, der Überlieferer der einzigen ganz erhaltenen mythischen Weltenstehungslehre der Griechen, die eine wahre Urgnosis darstellt …
Muß ich noch mehr sagen? Bedarf es noch weiterer Worte, um zu zeigen, wie nahe uns trotz seiner Ferne Hesiod ist, wie sehr uns trotz unbestreitbarer Befremdlichkeit seine blitzhaften Schauungen treffen? Diese Erfahrung wäre Allgemeingut, wenn man sich nicht weigerte, Hesiods Weltgedichte zu lesen.
Homer lebte im griechischen Kleinasien, Hesiod auf griechischem Festland in Europa. Hesiod der erste in so vielen Hinsichten, Boiotarch schlechthin, die Reihe der Granden eröffnend, mit der die abgelegene, im Rufe der Hinterwäldlerei stehende Landschaft Boiotien nicht nur Griechenland beschenkt hat: mit dem Paianschöpfer Pindar und dem Essayisten Plutarch, dem Pythagoreer, Strategen und Staatsmann Epameinondas und der Poetin Korinna von Tanagra.
Mag Homer zeitlich der ältere Dichter sein, so ist Hesiod seelisch der frühere. Von Homers Epen führen die Wege zur bildenden Kunst, zu den Skulpturen, mit denen die Hellenen das Land zusätzlich bevölkerten. Von Hesiod führen die Wege zur Philosophie, zur Kosmologie, zur Rechtsweisheit und Geschichtslehre.
Hesiod, mit dem so vieles anhebt, durch den so vieles fortlebt … Hesiod, durch den wir über den Ursprung wissen: das Chaos, das Werden und die Geburt …
Wie viele Potentaten und Eroberer sind entschwunden, vergessen ihre Befehle, zerfallen ihre Imperien und Paläste. Aber Hesiods gewaltlose Macht bezwingt noch heute, nach fast drei Jahrtausenden, und es ist keine angemaßte Macht eines Usurpators … Seine Nereiden leben, sogar dem Namen nach, im griechischen Volksglauben fort … Wir ahnen, daß die Welt über einem Abgrund von Schrecken errichtet ist; daß Recht, Ordnung und Olympiertum das Schauervolle nicht vernichten, sondern günstigstenfalls überwältigen, bändigen und umzäunen … Hesiod hat in mythischen Bildern weissagend geschaut, was wir heute zu wissen gezwungen sind …
Hesiod rufe ich an, den ersten namentlich bekannten festlandeuropäischen Dichter-Seher, der zugleich der erste Arbeiter-Dichter und Ahnherr abendländischer Philosophie ist …
Hesiod rühme ich, den das Klagelied vom Verfall der Weltalter wehmütig anstimmenden Übersetzer der indischen Kali-Yuga- Lehre ins Griechische …
Hesiod rufe ich an, den erleuchteten Hirten der Lämmer und Eingebungen; den Sänger ursprünglichen Einsseins von Göttlichem, Welt und Menschheit; den das All als Kaskade von Umarmungen und Geburten gewahrenden Matriarchäologen, für den nichts von der Beseelung ausgenommen ist und alles seinen Beginn in sich trägt; ich ehre die Macht dieses Stifters, Bürgen und Ferments der Abenteuergeschichte europäischer Ideen; ich verneige mich vor dem Künder der Blütengestalt Aphrodite, des Spieles der Wogen und der Schwarzen Madonna, deren Name ist: Erde …
(1989)