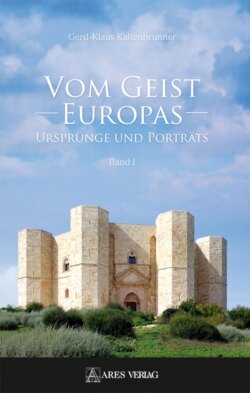Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 8
Apollinischer Norden Die Indoeuropäer: mehr als ein Phantom
Оглавление… sah an den Nord und legte Runen.
Herder
Polarlicht kann uns mit dem Geist verbinden.
Theodor Däubler
In Deutschland erlitt die Indogermanen-Forschung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen schweren Rückschlag. Nach dem Mißbrauch, den der Nationalsozialismus mit sprachwissenschaftlichen und frühgeschichtlichen Theorien getrieben hatte, galt es beinahe als anrüchig, sich mit der Eigenart und Herkunft der Indogermanen zu befassen oder auch nur von „Ariern” zu sprechen. Dabei sind, wie bekannt, beide Ausdrücke (die manchmal fälschlich gleichgesetzt wurden) ursprünglich rein linguistischen Ursprungs und viel älter als die Rassendoktrin Hitlers (die ihrerseits einige prominente nichtdeutsche Wurzeln hat, wie die Namen Arthur Gobineau, Houston Stewart Chamberlain und Ludwig Gumplowicz beweisen). Namhafte Gelehrte fast jeder europäischen Nation, neben Deutschen vor allem auch Engländer und Franzosen, haben die Indogermanistik begründet und aufgebaut. An ihrem Ursprung steht eine triftige Hypothese: die vielfältigen Übereinstimmungen in Grammatik und Wortschatz zwischen geographisch so entfernten Sprachen wie dem Isländischen, Deutschen, Griechischen, Iranischen, Armenischen und dem Sanskrit in Indien lassen sich plausibel nur durch die Annahme einer gemeinsamen Wurzel erklären. Daran schließt sich die naheliegende Frage, ob dieser ursprünglichen Sprachgemeinschaft auch ein „Urvolk” zugrundeliegt, das sich erst später verzweigt habe.
Die politisch-ideologischen Belastungen im Zusammenhang mit dem „Dritten Reich” haben auch mit dazu beigetragen, daß man heute — insbesondere im außerdeutschen Sprachraum — im allgemeinen nicht mehr von „Indogermanen”, sondern von „Indoeuropäern” spricht. Zu den Großmeistern einer solchen Indoeuropäer-Forschung, die sich souverän über zeitgeschichtliche Tabus und akademische Fachgrenzen hinwegsetzt, gehört der Franzose Georges Dumézil, der am 11. Oktober 1986, fast neunzigjährig, in Paris gestorben ist. Schon zu Lebzeiten ein Monument historischer, religionswissenschaftlicher und philologischer Gelehrsamkeit, zählt Dumézil neben dem Rumänen Mircea Eliade und dem Österreicher Othmar Spann zu den ganz großen Universalisten unseres Jahrhunderts. Sein umfassendes Lebenswerk hat dieser Kulturwissenschaftler, der dreißig indoeuropäische Sprachen beherrschte, der vergleichenden Untersuchung der Religion, Kultur und Gesellschaftsform der Indoeuropäer gewidmet.
In Deutschland ist Dumézil leider noch immer fast unbekannt. Es fehlen hier auch brauchbare Übersetzungen seiner Hauptwerke. Soviel ich weiß, sind auf deutsch bislang nur drei seiner Bücher erschienen: „Loki” (Darmstadt 1959), „Aspekte der Kriegerfunktion bei den Indogermanen” (Darmstadt 1964) und „Mythos und Epos. Die Ideologie der drei Funktionen in den Epen der indoeuropäischen Völker” (Frankfurt a. M. 1989); außerdem die eher belletristischen oder „ludi-magistralen” Kleinarbeiten in dem Bändchen der Bibliothek Suhrkamp: „Der schwarze Mönch in Varennes und Divertissement über die letzten Worte des Sokrates” (Frankfurt a. M. 1989). Umso mehr ist es zu begrüßen, daß der junge, aber sehr rührige Karolinger-Verlag in Wien 1986 ein Taschenbuch „Die Indoeuropäer” herausgebracht hat. Sein Verfasser, Jean Haudry, ist ein Schüler des Nestors der französischen Indoeuropäer-Forschung und sein Nachfolger an der angesehenen École Pratique des Hautes Études zu Paris. Die Originalausgabe, deren Manuskript Dumézil durchgelesen hatte, erschien 1981 im bedeutendsten akademischen Verlag Frankreichs, bei den „Presses Universitaires de France”.
Haudrys Band ist ein Abriß oder Kompendium. Präzis gegliedert, auf ideologischen Ballast verzichtend, aber auch die Verlockungen popularisierender Effekthascherei umgehend, stellt er eine Einführung in den gegenwärtigen Stand, in die Probleme, Methoden und Ergebnisse einer Wissenschaft dar, die in den letzten Jahrzehnten einen geradezu abenteuerlichen Aufschwung genommen hat. Dieser Aufschwung ergibt sich nicht zuletzt aus der Zusammenarbeit von Sprachwissenschaftlern, Archäologen, Religionshistorikern, Anthropologen und Experten anderer Disziplinen. Ihrer synoptischen Fähigkeit ist es gelungen, viele einst umstrittene Fragen einer Klärung näherzubringen. Die Resultate erscheinen umso aufregender, wenn man bedenkt, daß man von den Indoeuropäern nicht in der Art berichten kann wie über die alten Griechen, Römer oder Ägypter. Wir verfügen ja über keine historischen Augenzeugenberichte oder Monumente, die uns unmittelbar über ein Volk dieses Namens unterrichten. Schon die bloße Bezeichnung „Indogermanen” ist ein Kunstwort, das erst 1823 von H. J. Klaproth geprägt wurde. Ausgangspunkt ist einzig und allein die erstmals von William Jones im Jahre 1780 erkannte Verwandtschaft der meisten europäischen und mehrerer asiatischer Sprachen, zu denen, wie wir inzwischen wissen, neben dem Sanskrit auch das Hethitische gehört.
Schritt für Schritt vorgehend, gelingt es dem auf den Spuren Georges Dumézils wandelnden französischen Forscher, uns eine eigenartige Welt zu erschließen, deren Spuren unter jahrtausendelangen Überlagerungen überlebt haben. Ein bestimmtes geistiges Grundmuster archetypischer Art, das sich immer wieder Geltung verschafft, durchwaltet einen Erdkreis, der von Skandinavien über Litauen und Lettland bis nach Persien und Ceylon reicht. Es ist dies das Schema der Dreigliederung, das wie ein Wasserzeichen beinahe sämtliche Hervorbringungen der indoeuropäischen Völker prägt. Handle es sich nun um die Spitze des Pantheons bei den Griechen, Römern, Kelten, Germanen und Indern, um die Schichtung des gesellschaftlichen Körpers, um das Bild des Kosmos oder die Bevorzugung symbolträchtiger Farben — immer wieder begegnen wir Triaden und „dreifunktionalen Strukturen”: der göttlichen Dreiheit von Zeus, Hera und Athene, der Dreiteilung der Stände in Priester (Weise), Krieger (Wächter) und Landleute (Züchter), der Trias von Weiß, Rot und Schwarz, um bloß diese Beispiele zu nennen. Jean Haudry schließt nicht aus, daß das zentrale christliche Dogma von der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes, das Juden und Muslimen so befremdlich ist, sich einer indoeuropäischen „Umfunktionierung” des unerbittlichen semitischen Monotheismus verdanke. Doch auch derjenige, der diese Vermutung für allzu spekulativ hält, wird die Abschnitte über Weltsicht, Königtum, Gemeinschaftsbildung, Institutionen und Ethos der Indoeuropäer mit Gewinn lesen.
Was das Herkunfts- oder Entwicklungsgebiet (mißverständlich oft „Urheimat” genannt) des indoeuropäischen Volkes betrifft, so erinnert Haudry daran, daß viele Indizien auf den Norden weisen. Jedenfalls kommen Gebiete mit warmem Klima schon deshalb nicht in Betracht, weil deren eigentümliche Pflanzenwelt im indoeuropäischen Wortschatz völlig ausgespart ist. Der Mythos von den Hyperboreern, dem Volk der „Übernördlichen”, manche Anspielungen auf „lange Nächte” und zehn Monate währende Winterzeiten in iranischen, indischen und anderen Quellen lassen vermuten, daß diese Sprachgemeinschaft nordischzirkumpolaren Ursprungs ist. Was aber bedeutet Nord? Ist es nicht überaus aufschlußreich, daß alle Himmelsrichtungen nach Sonnenständen bezeichnet werden — mit Ausnahme des Nordens? Nord(en) leitet sich ab vom altnordischen „nor”, und dieses Wort bedeutet: „Felsen”. Es gibt so etwas wie eine indoeuropäischen „Nordzug”, Spuren einer kollektiven Erinnerung an eine Heimat in nördlichen Gebirgen. Dort liegt ja auch die Sommerresidenz des Lichtgottes Apollon. Der Eindruck der steinig nackten Felsengegenden, wie sie die Arktis und Subarktis beherrschen, fand auch seinen Niederschlag in zahlreichen kultischen Eigentümlichkeiten. Der Altar der Artemis auf Delos war zum Beispiel völlig aus Ziegenhörnern zusammengesetzt — eine Besonderheit, die man sonst nur bei arktischen Völkern, einschließlich der Lappen, beobachten kann. Insbesondere Apollon und die von den Römern mit Diana gleichgesetzte Artemis stehen in einem Nordbezug, dessen Anfänge bis in jene Urzeiten hinabreichen, da auf Grönland noch Magnolien blühten.
Ähnliche arktisch-polare Spuren finden sich, worauf Werner Müller aufmerksam macht, auch bei einigen Indianerstämmen. So wenden sich zum Beispiel die Schamanen der kalifornischen Pomo bei allen Riten einmal nach Osten, Süden und Westen, aber dreimal gegen Norden, „denn von dort ist alles ausgegangen”. Am Anfang der Indoeuropäer steht möglicherweise ein steinzeitliches Jägervolk, das dem rauhen Dasein in Schneesteppen gewachsen war und in symbiotischer Weise mit seinen Rentierherden zusammenlebte. Seine erste größere Ausbreitung scheint sich hingegen im südöstlichen Teil Rußlands vollzogen zu haben.
Bemerkenswert sind Haudrys Ausführungen über die indoeuropäische Auffassung vom Kriege. Sie entzieht sich völlig dem modernen Entweder-Oder von „Pazifismus” und „Militarismus” (oder „Bellizismus”). Einerseits gilt Krieg als Normalzustand, Friede als kurzfristige Ausnahme. Diese Haltung erinnert an Heraklits Spruch: „Der Kampf ist der Vater aller Dinge”. Krieg wird geführt, um „Lebensraum” zu gewinnen, zwecks Verteidigung des heimatlichen Bodens, um eine Beleidigung zu rächen, einen Aufstand zu unterdrücken, einen Vasallen drastisch an seine Botmäßigkeit zu erinnern, aber auch um „unverwelklichen Ruhm” zu erlangen. Zugleich besteht die Neigung, Kampf, Streit und Fehde rituell zu zügeln, ja als „Spiel” aufzufassen: als eine Art von Match, bei dem die Götter als Schiedsrichter wirken. Der Krieg ist im Idealfall kein wildes Gemetzel, sondern ein heroisches Meeting, in dem unter Einhaltung zähmender Zeremonien zwei Gruppen — bisweilen stellvertretend für ihre Völker auch nur zwei sich duellierende Könige oder Heerführer — ihre Kräfte auf festliche, beinahe liturgische Weise messen. Der Feind soll besiegt, nicht aber vernichtet oder auch nur entwürdigt werden. Flucht ist nicht von vornherein schändlich, wenn der Kämpfer bemerkt, daß die Schlacht eine für ihn ungünstige Wendung nimmt, weil die Götter ihm diesmal nicht wohlwollen. Wir gewahren hier eine archaische Völkerwelt, der zu unserem Erstaunen der Gedanke eines Ausrottungs- oder Vernichtungskrieges völlig fremd ist. Der Feind gilt nicht als Unhold oder Verbrecher, sondern geradezu als Gefährte, Kamerad und Mitspieler in einem athletischen Wettkampf, der nach strengen Regeln geführt wird. Der Krieg wird nicht als Massenschlächterei verstanden, sondern als eine kultische und kultivierungsfähige Auseinandersetzung agonaler Art. Er ist grundsätzlich ein „gehegter Krieg”, in dem keineswegs alle Mittel zur Bezwingung des Gegners erlaubt sind. Unsentimental ritterliche „Feindesliebe” fiel frühgeschichtlichen Männern, die noch nichts von der Bergpredigt gehört hatten, im Ernstfall leichter als einem im „seichten sumpf erlogner brüderei” (Stefan George) von Humanität und Menschenrechten aufdringlich schwätzenden Geschlecht.
Auch zu solchen durchaus aktuellen, wenngleich vom „Geist der Zeit” verpönten und tabuierten Überlegungen kann das dem Umfang noch kleine, von Thematik, Gehalt und Perspektive her jedoch gewichtige Buch des französischen Gelehrten anregen. Die Indoeuropäer sind nicht länger ein „linguistisches Phantom”, sondern eine unverwechselbare Ausprägung oder kulturelle Selbststilisierung und psychosoziale Lebensform der menschlichen Natur. Ihrer Eigenart wird nur gerecht, wer über den Besonderheiten das Allgemeinmenschliche nicht vergißt und über dem Allgemeininenschlichen sich bewußt bleibt, wie mannigfach die Erscheinungsweisen des Humanen in Sprache, Mythos, Kultur und Gesellschaftsaufbau sein können.
(1987)