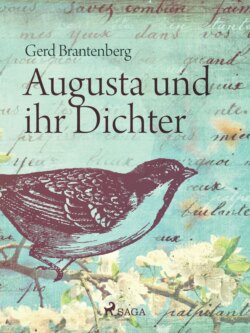Читать книгу Augusta und ihr Dichter - Gerd Mjøen Brantenberg - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kapitel
ОглавлениеEines Tages kamen die Gerüchte, daß im Kielwasser der Lensmannsgattin Gegenstände verschwanden, auch dem Lensmann zu Ohren. Ein Dorftrottel im Laden hatte sich verraten, er hatte einen über den Durst getrunken. Der Lensmann stellte seine Frau sofort zur Rede. Wußte sie, was über sie behauptet wurde? Nein, sie hatte keine Ahnung, sie hatte nie viel mit der Dorfbevölkerung zu tun gehabt, und es interessierte sie auch nicht weiter, was die sich so dachte. Gemocht hatten sie sie ja noch nie. Ihr Mann sagte nichts mehr. Aber eines Tages kaum ein Bauer aus Aune und sagte, aus seiner Truhe seien zehn Taler verschwunden, und zwar just an dem Tag, als Frau Mjøen Eier abgeliefert habe. Gleich neben der Truhe habe man ein mit den Buchstaben „H. P. S.“ besticktes Spitzentaschentuch gefunden. Stand auf so etwas keine Strafe? Das müsse der Lensmann ja am besten wissen, meinte der Bauer. Jon Mjøen war wütend und sagte, er wolle solches Gerede nicht hören, und ein Spitzentaschentuch sei kein Beweis. Sie könne das überall verloren und jemand könne es neben die Truhe gelegt haben. Aber am nächsten Tag suchte er den Bauern auf und gab ihm zehn Taler. Er sagte, er könne auf diese Summe besser verzichten als der Bauer, der jedoch solle im Gegenzug dafür sorgen, daß seine Leute nicht mehr über die Sache sprachen.
Das Gegenteil passierte. Als sich die Nachricht verbreitete, daß der Lensmann bezahlt hatte, war die Stimmung ganz oben. Jetzt konnten alle zugreifen. Sie brauchten dem Lensmann nur jeden Diebstahl zu melden, der sich im Ort zutrug, und schon würde er bezahlen, um seine Frau zu schützen.
Jon merkte schließlich, wie seine Reaktion ausgelegt worden war, und bat Gott, den anderen Erleuchtung zu schenken. Dann ging er zu seiner Frau und sagte: „Ich fürchte, du mußt mir deine Verstecke und Fächer zeigen.“ Er wußte nämlich kaum noch, was er denken sollte. Und er hatte Angst vor ihrem Zorn.
Und das zu Recht. Sie steigerte sich in eine Wut, die ihre Familienähnlichkeit mit Peder Bjørnson mehr als deutlich werden ließ, und sagte, sie hätte nie gedacht, daß es soweit kommen könnte und daß er ihr dermaßen mißtrauen würde. Und übrigens habe er kein Recht, das Wohnhaus zu durchsuchen. „Als dein Mann habe ich das nicht“, erwiderte er. „Als Lensmann wohl.“ Sie preßte die Lippen aufeinander und führte ihn zur Erbtruhe, in der sie ihre Schätze aufbewahrte.
Es war eine alte Eichenholzkiste mit gewölbtem Deckel und Eisenbeschlägen, in die die Jahreszahl 1712 eingestanzt war. Die Truhe hatte zu Helenes Aussteuer gehört, sie stammte von ihrem Großvater. Sie zog die Schlüssel hervor und öffnete. In der Truhe gab es kein Geld.
„Ja, ja, das kann natürlich auch anderswo sein. Vielleicht solltest du im Vorratshaus zwischen den Würsten nachsehen?“ schlug sie vor.
Mehr passierte nicht. Er wußte, daß er ebensogut ein Feuer mit Luft löschen wie versuchen könnte, ein Gerücht zum Verstummen zu bringen. Eine kleine Flamme mochte vielleicht erlöschen, eine große wurde nur noch größer. Und wenn die Gerüchte doch zutrafen? Und wie sah es wohl in Helenes Seele aus? Er fiel auf die Knie und faltete die Hände zum Gebet, aber das Gebet wollte sich nicht einstellen. Ihm fiel ein Bibelwort ein: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Er schaute in sich hinein.
„Und vergib uns unsere Schuld“ wurde jeden Sonntag in der Kirche gebetet. Es war so leicht, das zu sagen. Schwieriger war es, tiefer zu gehen. Vergib mir, daß ich geschlagen, gestohlen, meine Ehefrau betrogen habe! Das alles hatte er getan, das wußte er, wenn er sein Leben seit seiner Kindheit durchging. Er hatte den Herrn und seine Eltern verflucht und Mordgedanken gehegt. Nein, es gab wirklich kein Gebot, das er nicht gebrochen hatte. Er sagte sie alle auf und betete, und dabei dachte er an seine Sünden. Er hielt inne. „Du sollst nicht falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten.“
Hatte er auch dieses Gebot gebrochen?
Nichts war im Alltag so gegenwärtig, kein Gebot wurde so oft gebrochen, keines verbreitete soviel Gift unter den Menschen. Jon dachte lange nach. Er dachte über sein Leben nach, dachte an seine Schulkameraden beim alten Gemeindepastor Rønnau, an seine Mitkonfirmanden, die Freunde bei Amtmann Trampe, seine Hausgenossen heute. Und er konnte sich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal das achte Gebot gebrochen zu haben. Er hatte niemanden verleumdet. Er hatte keinen unbewiesenen Klatsch weitergetragen. Im Gegenteil, oft hätte er die, die nicht anwesend waren, gern verteidigt. „Danke, lieber Gott, danke, daß du mich davor bewahrt hast, das achte Gebot zu brechen.“
Er hatte vor kurzer Zeit einen neuen Choral gelernt. Probst Wexels in Kristiania hatte die norwegische Fassung geschrieben. Die Melodie war von einer sich wiederholenden, eintönigen Tiefe, und deshalb war es leicht, sich eine Unzahl von anderen Melodien und Rhythmen auszudenken.
Jesu, Jesu komm zu mir,
o wie sehn ich mich nach Dir!
Meiner Seele bester Freund,
wann werd ich mit dir vereint?
Tausendmal begehr ich dein,
Leben ohne dich ist Pein.
Tausendmal ruf ich zu dir:
O Herr Jesu, komm zu mir.
Keine Lust in dieser Welt,
die mein Herz zufriedenstellt;
deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreun.
Einmal würde er alles verstehen, er würde vor den Herrn treten, niederknien und ohne Schuld leben, ohne Versuchung. Und Gottes Liebe würde sein ganzes Herz erfreuen. Das verhieß das Lied – und seine Klänge enthielten eine Offenbarung.
Darum sehn ich mich nach dir,
eile, Jesu, komm zu mir;
nimm mein ganzes Herz für dich,
und besitz es ewiglich.
Sie würden über alles sprechen, was während des Lebens auf Erden geschehen war, sie würden einander alles anvertrauen. Wenn sie etwas genommen hatte, das ihr nicht zustand, dann würde sie es ihm sagen. Daß er sie in seinem Herzen betrogen, daß er gar Dirnen aufgesucht hatte, würde er zugeben. Alles würde dann so unwichtig sein.
Ach, o Herr, ich bin nicht rein,
daß du kehrest bei mir ein.
Nur ein Wort aus deinem Mund,
und die Seele ist gesund.
Komm, o Jesu, komm geschwind,
mache mich zu Gottes Kind!
Meine Seel bewahre dir,
ewig, ewig bleib bei mir!
Überall, wo er zu tun hatte – im Stall, zwischen den Häusern, auf den Feldern und im Wald, allein mitten im Gebirge – sang er mit schallender Stimme die sechs Strophen des neuen Liedes. Er brachte es auch den Kindern bei. Sie sangen es gemeinsam zu den Klängen des Monochords. Die Kinder, die Kinder, Gott segne die Kinder! Sie waren seine große Freude und seine Hoffnung im Diesseitigen, wenn sie ihm entgegenliefen und jeden Tag schöner wurden.
Im Dorf gab es nur eine Wanderschule, und Augusta hatte sie nach ihrer Rückkehr aus Kristiania besucht. Helene hätte sie gern nach Trondheim geschickt, wo sie feines Benehmen lernen konnte, wie ihre Halbschwester Tina das getan hatte. Aber Jon weigerte sich. Er wollte seine Tochter nicht aus dem Haus geben. Dann wolle er lieber selber eine Schule gründen, sagte er.
Er hatte im Dorf einen Verwandten, Iver Bjerkager, und in Klæbu war vor kurzer Zeit ein Seminar eingerichtet worden. Er versprach Iver, ihm die Ausbildung zu finanzieren, wenn er danach ins Dorf zurückkehren und die Kinder unterrichten würde. Für den jungen, begabten Bjerkager war das eine ungeheure Chance, und schon bald machte er sich auf den Weg nach Klæbu.
An Kindern fehlte es nicht. Zu Beginn des Jahrhunderts hatten in Oppdal um die tausend Seelen gelebt, inzwischen waren es an die dreitausendachthundert. Und während die Wanderschule weitermachte wie bisher, holte der Lensmann so viele Kinder zu sich, wie eine Klasse überhaupt haben durfte. Nämlich vierundzwanzig.
In Klæbu lernte Bjerkager, daß die Kinder Geschichte lernen sollten, indem sie das Gehörte nacherzählten, doch dazu mußte der Lehrer es zuerst drei- oder viermal vortragen. In Erdkunde sollten die Kinder an einer großen Tafel jedes Land mit Flüssen und Städten neu erschaffen, in Musik sollte der Lehrer die zweite Stimme singen, damit es schöner klang, jeder Schultag sollte mit Polka und Springer enden, damit die Kinder sich auch auf den nächsten Tag freuten. Jeden Morgen sollte natürlich ein Choral gesungen werden, doch auswendig sollten die Kinder nur Pontoppidans Glaubenssätze, die biblische Geschichte und den Katechismus lernen. Dieser Teil des Unterrichtsstoffes war nämlich der schwierigste, und gerade das, was man nicht versteht, sollte man auswendig wissen. Dann kann man es von Zeit zu Zeit hervorholen und überprüfen, ob man inzwischen vielleicht mehr versteht.
Geschichte, Erdkunde und Naturkunde sind nicht auf diese Weise unbegreiflich. Dieses Wissen sollten die Kinder sich auf eine Weise aneignen, die es zu einem natürlichen Teil ihrer selbst macht, zu ihren geistigen Armen und Beinen gewissermaßen.
Nach diesen Prinzipien also wurde die kleine Augusta unter Iver Bjerkagers mildem Blick unterrichtet. Er war ein hochgewachsener Mann, dunkel und mit Vollbart, ein lebendiger Erzähler, vielseitig und musikalisch, abends spielte er in der Küche zum Tanz auf.
Während der drei Wintermonate, die der Unterricht dauerte, wohnte Iver Bjerkager auf dem Hof, und abends saß er oft mit dem Lensmann zusammen und diskutierte über die allerwichtigsten Fragen. Ist Gott wirklich allgegenwärtig? Wo ist der Himmel? Wie sieht es dort aus? Was ist mit Sünden, die wir vor unserem Tod nicht mehr bereuen können – werden wir zur ewigen Pein verdammt, wenn uns zum Beispiel eine Lawine mitreißt? Und können wir auch nach dem Tod noch bereuen?
Probst Wexels hatte sich entsprechend geäußert. Er meinte, daß es durchaus möglich sein müsse, in der langen Zeit, die zwischen dem Tod eines Menschen und der Wiederkehr Christi verging, noch zu bereuen. Und Wergeland hatte vor kurzer Zeit erst behauptet, daß er zwar an eine Hölle glaube, aber nicht an eine ewige.
Alle anderen aktuellen Fragen – Straßenbau, der Konventikelerlaß und das neue Strafgesetz – waren Bagatellen im Vergleich zu diesen Dingen, man wußte schließlich, wie kurz das Leben im Vergleich zur endlosen Ewigkeit auf beiden Seiten doch ist.
Iver sagte: „Aber man kann nicht erwarten, daß ein Kind versteht, was Sünde ist und wie unendlich man im Jenseits bestraft oder belohnt wird. Wenn wir jung sind, kommt uns das Leben hier auf Erden ewig lang vor. Eine Unendlichkeit von Tagen und Jahren und Möglichkeiten liegt vor uns. Es kommt uns vor wie ein Meer, dessen anderes Ufer wir nicht sehen können. Ein Kind versteht deshalb nicht so leicht, was die Erwachsenen unter der Ewigkeit nach dem Tod verstehen. Die Ewigkeit ist doch hier! Eine Schulstunde bei einem übellaunigen Lehrer kann eine Ewigkeit voller Qualen sein – wozu braucht man dann noch eine Hölle? Ein Sommertag, an dem man im Sonnenschein Blumen und Beeren pflückt und die vielen Düfte wahrnimmt, kann ziemlich stillestehend wirken – wozu braucht man dann noch ein Paradies? Es steht geschrieben, daß vor Gott tausend Jahre wie ein Tag sind. Aber für ein Kind ist eine Stunde wie hundert Jahre. Das darf man als Schulmeister nicht vergessen.“
Der Eifer des jungen Iver gefiel dem Lensmann. Wenn er Zeit hatte, setzte er sich deshalb selbst mit ins Schulzimmer.
Augusta entdeckte bald, wie sehr ihr das Auswendiglernen lag. Vor allem, wenn es um Choräle und andere Lieder ging. Bjerkager brauchte ein Lied nur ein- oder zweimal zu singen, dann konnte sie es, denn die Wörter fügten sich so natürlich ineinander und paßten zur Melodie. So ähnlich war es mit den Ländern. Wenn man wußte, wo die Gebirge lagen, konnte man sich vorstellen, wo die Flüsse dahinströmten und wo sich in ihren Achselhöhlen und Ausbuchtungen Burgen und Städte gründen mußten. Wenn man dazu sah, wie sich an der Küste Ackerboden und Gebirge verteilten, dann konnte man das Land gleich zeichnen. Auch das war wie ein Lied. Und aus der Tatsache, daß die Menschen die Äcker bestellten und am Fuß der Berge ihre Häuser bauten, daß sie sich den Verhältnissen fügten oder dagegen aufbegehrten, daß sie Lieder über Trauer und Tod sangen und Jubelgedichte auf Geburt und Liebe verfaßten, folgte die Geschichte.
Es war wie ein Rundtanz: Lied – Land – Menschen – Lied. Lied – Land – Menschen – Lied.
Sie war zehn Jahre alt, als an einem Tag im Spätherbst Pastor Bjørnson mit seinem ältesten Sohn vor der Tür stand. Der Pastor hatte im Dorf etwas zu erledigen und wollte den Jungen solange auf dem Hof lassen. Er sei zu unruhig, um den Vater zu begleiten. Bjørnstjerne durfte an Bjerkagers Unterricht teilnehmen. Danach liefen sie zum Spielen in die Geröllhalde hinauf. Bjørnstjerne war seit ihrem Umzug nach Romsdalen mehrere Male mit seinem Vater nach Oppdal gekommen, aber sein letzter Besuch lag schon lange zurück, und jetzt wollte er alles über Kristiania hören. Augusta erzählte von ihrer Wohnung.
„Und Wergeland? Hast du Henrik Wergeland gesehen?“
„Ja, jeden Tag. Er wohnte doch gleich neben uns.“
Sie merkte, wie sie deshalb in seinen Augen wuchs. Sie kletterten immer wieder auf einen hohen, flachen Stein im Birkenwäldchen und sprangen herunter. „Er hatte Totenschädel auf dem Söller“, rief sie einmal im Sprung. „Totenschädel? Du lügst!“ Er sprang hinterher. Aber es stimmte. Bei Wergeland hatte in der Mansarde ein Student gewohnt. Der hatte Arme und Beine, einzelne Knochen und ein ganzes, grinsendes Totengerippe. Er studierte nämlich Medizin.
Hansemann und Augusta waren oft oben gewesen, um das Skelett zu bestaunen. Sie erzählte von den Knochen. Bjørnstjerne wurde nachdenklich, er schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein. Hörte er ihr überhaupt noch zu? Dann konnte sie auch etwas anderes sagen. „Er hat seine Dienstmägde geschlagen“, sagte sie, wieder im Sprung. „Was? Geschlagen? Jetzt schwindelst du schon wieder!“ Er setzte sich auf den Stein und wollte nicht springen. „Doch, hat er, aber er hat damit aufgehört, nachdem Vater ihm ins Gewissen geredet hatte.“
Sie erzählte, wie Wergelands Dienstmägde zu ihnen geflohen waren und sich im Keller versteckt hatten. Es reichte, daß sie Frau Wergelands Hemden noch nicht gestärkt hatten, wenn die spazierengehen wollte, oder daß ihnen ein Teller zu Bruch gegangen war, und schon schlug Wergeland los. Weshalb kein Dienstmädchen lange in seinem Haus blieb.
Diesmal hörte Bjørnstjerne interessiert zu. „Aber du hast gesagt, er hat damit aufgehört?“ fragte er. „Er hat es bereut“, sagte sie. Ihr Vater hatte ihm klargemacht, daß ein solches Benehmen nicht zu seinem guten Herzen passe. Wie sollten die Leute ihm dann noch glauben, daß er Tiere und Schmetterlinge und kleine Kinder liebte? Wergeland sagte, er schlage zu, ohne nachzudenken, es passiere immer wieder, es sei zur Gewohnheit geworden. Später brachte er dann ein Gedicht. Es handelte von einem Hund, den er einmal gehabt hatte. Das Gedicht hatte er dem Vater geschenkt. Es gab auch eine Melodie dazu. Ob sie es ihm vorsingen solle?
Nimmer schlag ich meinen Hund,
ich will ihn herzlich streicheln,
will ihm ein lieber Herr sein und
ihn mir zum Freund erweichen.
„Aber Augusta! Du kannst ja singen!“ rief Bjørnstjerne.
Er fürchtete sich immer, wenn Totengerippe erwähnt wurden. Ihre Seelen schmachteten in der Hölle. Flammenzungen beleckten sie Tag und Nacht, es gab kein Ausweichen. Und dort unten waren fast alle Toten, denn nur wenige waren auserwählt, und er glaubte nicht, jemals zu diesen zählen zu können.
Manchmal, wenn sich über den Bergkämmen zu Hause schwarze Wolkenbänke zusammenballten und sie das Unwetter kommen sahen, wenn sie den Donner hörten und die wilden Blitze über den Himmel jagen sahen, hielt er den Jüngsten Tag für gekommen. So mußte der doch aussehen. Was wußte die kleine Augusta Mjøen schon von den Dingen, die ihm durch den Kopf gingen?
Er hatte einmal einen Menschen sterben sehen. Das war jetzt einige Jahre her. Sein Vater hatte ihn zur Hinrichtungsstätte mitgenommen. Ein Mann aus Nesset sollte geköpft werden. Die Nachbarn umstanden ihn im Viereck und schauten zu. Der Mann war noch jung. Er war verurteilt worden, weil er eine Magd ermordet hatte. Aber so sah er wirklich nicht aus. Er legte den Kopf auf den Block. Der Kopf wurde mit einer Axt abgehackt und kullerte ins Gras, das Blut spritzte hoch. Dann wurden Kopf und Rumpf ins Grab geworfen.
Er versuchte immer wieder, dieses Bild zu verdrängen. Das Leben sollte heiter sein. Aber immer wieder tauchte das Bild auf, und alles war schrecklich. Jetzt sang sie. Wergeland litt, weil andere unter ihm leiden mußten. Er hatte geschlagen. Und das verstieß gegen das fünfte Gebot. „Du sollst nicht töten.“ Denn auch wenn wir schlagen, töten wir im anderen etwas. Norwegens größter Dichter war ein Sünder. Und aus der Reue entstand ein Gedicht.
„Erzähl mehr von Wergeland“, bat er.
Sie dachte nach. Mehr gab es eigentlich nicht. Ach, doch. Sie hatte seinem Pferd Zucker geben dürfen. Was noch? – „Er hat gesagt, wir sollen nicht nach Amerika gehen“, sagte sie. „Das weiß ich“, sagte er. „Das meint er, wenn er schreibt: Grüner das Gras kann nirgends sein, mehr voller Blumen gewebt, als bei mir, in der Heimat mein, dem Land, wo die Eltern gelebt. Damit will er uns Kinder vor dem Auswandern warnen.“ – „Wirklich? Dann weißt du mehr als ich.“
„Aber sicher. Ich bin doch ein Junge. Und ich bin älter.“ – „Zwei Jahre.“ – „Ja.“ – „Erzähl mehr.“ – „Oh! Frau Wergeland, weißt du, die hatte so schöne Locken. Die um ihren Hals getanzt sind. Solche will ich auch haben, wenn ich groß bin!“
Verdutzt sah er sie an.