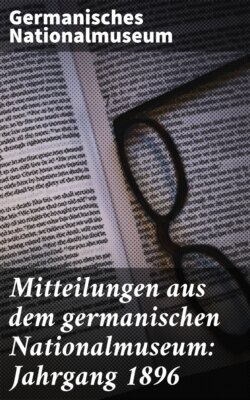Читать книгу Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum: Jahrgang 1896 - Germanisches Nationalmuseum - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Meister der nürnberger Madonna[65].
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Treten wir vor ein bedeutendes Kunstwerk, so ist eine der ersten Fragen, die sich uns aufdrängen, wer hat es gemacht. Die Frage ist begreiflich und gerechtfertigt, nicht nur vom Standpunkte des Historikers aus, sondern für jeden verständnisvollen Beschauer. Was uns interessiert, was uns anzieht oder abstößt, ist nicht nur das Kunstwerk als solches, sondern auch die Individualität des Künstlers, welche aus ihm spricht. So viele Irrtümer unvermeidlich unterlaufen, wenn Künstlernamen einzig aus stilistischen Kriterien bestimmt werden, man wird da, wo schriftliche Nachrichten oder gute Traditionen fehlen, immer wieder auf diese Bestimmungsweise geführt werden.
Unter den plastischen Werken der beginnenden deutschen Renaissance wird die nürnberger Madonna (G. M. 314, Städtische Kunstsammlung Plastik 5) stets in erster Linie genannt. Vielfach wird sie als das bedeutendste Werk der deutschen Plastik des frühen 16. Jahrhunderts bezeichnet, oft ist sie besprochen, in Abgüssen und Abbildungen ist sie allgemein verbreitet und bewundert.
Die Bezeichnung eines Kunstwerkes als bedeutendstes ist stets eine relative, insbesondere besteht zwischen Kunstwerken, bei welchen in erster Linie der intensive Ausdruck der Empfindung angestrebt wird und solchen, welche mehr die formal harmonische Schönheit der Erscheinung betonen, eine ästhetische Antinomie. Erstere haben eine höhere individuelle, letztere eine mehr typische Bedeutung, und unvermeidlich muss bei ihnen der Ausdruck der Gemütsbewegungen um einige Grade herabgestimmt werden. Und doch können zwei Werke dieser beiden Gattungen die gleiche Vollendung besitzen und bezüglich der Gattungen selbst sind wir nicht berechtigt, die eine der anderen überzuordnen. Wohl aber sind wir darüber klar, daß erstere mehr dem malerischen, letztere mehr dem plastischen Ideal entspricht. Die nürnberger Madonna, welche wohl mit Recht als Teil einer Kreuzigungsgruppe betrachtet wird, gehört zu letzterer Gattung. Die Figur ist das Werk eines großen Künstlers, welcher an formaler Begabung, an reinem Schönheitssinn alle seine Zeitgenossen überragt. Eine so ungewöhnliche Sicherheit des plastischen Könnens ist Niemanden angeboren, sie wird nur allmählig in ernster Arbeit erworben. Es ist ganz ausgeschlossen, daß der Meister nur diese eine oder nur wenige Arbeiten geschaffen habe. Solche sind aber bis jetzt nicht bekannt geworden. Ob ihm die Pietà in der S. Jakobskirche in Nürnberg zugewiesen werden darf, ist zum mindesten fraglich.
Daß aber das ganze Werk eines so großen Meisters bis auf eine Figur zu Grunde gegangen sei, ist höchst unwahrscheinlich.
Nürnberger Madonna.
Halten wir daran fest, daß die Figur eine nürnberger Arbeit ist, und es ist kein ausreichender Grund vorhanden, sie einer anderen oberdeutschen Schule zuzuweisen, so ist längst erkannt, daß sie weder von Veit Stoß, noch von Adam Kraft sein kann. Beide Künstler halten an dem spätgotischen, plastisch malerischen Stile des 15. Jahrhunderts fest, ihre Arbeiten sind von starker und tiefer Empfindung durchweht, welche selbst vor gewaltsamen Stellungen nicht zurückschreckt. Von einer Zuweisung der Madonna an einen von ihnen kann keine Rede sein. Anders stellt sich ein Vergleich mit den Arbeiten Peter Vischers, ein Vergleich, der bis jetzt nicht angestellt wurde. Peter Vischer ist seit den großen Meistern des 13. Jahrhunderts der erste deutsche Bildhauer, in dem die strengsten Stilgesetze der Plastik lebendig sind. Es ist etwas Objektives in seiner Kunst, seine Figuren haben gattungsmäßige, typische Bedeutung. Gegenüber den scharf individualisierten Persönlichkeiten Krafts oder gar Dürers haben seine Menschen etwas Allgemeines. Er individualisiert nicht mehr, als sich mit der harmonisch linearen Schönheit der Gesamterscheinung vereinigen läßt, auf welche sein Absehen in erster Linie gerichtet ist. Demgemäß sind auch die Bewegungen maßvoll und die Gewandung ist von klassischer Einfachheit, die Körperform mehr hebend als verhüllend. Von den untersetzten Verhältnissen der Apostelfiguren am Grabmale des Erzbischofs Ernst von Magdeburg geht er später zu schlanken Proportionen über. Die Apostel am Sebaldusgrab haben sieben und mehr Kopflängen.
Die charakteristischen Merkmale von Peter Vischers statuarischen Arbeiten, namentlich von den Aposteln des Sebaldusgrabes finden sich wieder an der Nürnberger Madonna. Die plastischen Motive und der Fluß der Linien sind von einer Harmonie und Klarheit, wie sie die deutsche Schnitzkunst vorher nie erreicht hatte. Das Bewegungsmotiv ist von oben bis unten einheitlich durchgeführt, hier stören keine Verrenkungen und Härten wie bei anderen Schnitzwerken der gleichen Zeit. Eine milde Stimmung beherrscht das ganze Werk.
Nun sind diese übereinstimmenden Momente an und für sich noch kein Beweis für Vischers Autorschaft, sie gewinnen aber dadurch erheblich an Gewicht, daß Vischer mit seiner plastischen Auffassung in seiner Zeit ganz allein steht. Beobachtungen von Einzelheiten kommen hinzu. Vischer liebt in der Gewandbehandlung lang gezogene Falten, der Fall der Obergewänder ist breit, zuweilen etwas schwer. Auch an der Madonna ist der Faltenwurf ähnlich behandelt. Man vergleiche den Fall des Mantels in beistehender Skizze mit dem der Schwester des Lazarus vom Epithaph der Margareta Tucher. Von der Knitterigkeit, von den barock gebauschten Rändern der Gewänder, wie sie noch Veit Stoß liebt, ist hier keine Spur mehr zu sehen. Auch die Behandlung der Hände und das rund vorspringende Kinn hat in anderen Werken Vischers seine Analoga.
Tucher’sches Epitaph.
Nürnberger Madonna.
Endlich aber ist die Figur — worauf schon Dr. Stegmann aufmerksam gemacht hat — überhaupt nicht im Holzstil, sondern im Metallstil gedacht und ausgeführt.
Die unruhigen, knitterigen und gebauschten Falten der Holzfiguren zielen auf eine malerische Wirkung ab, welche Polychromie und Vergoldung zur Voraussetzung hat; bei unserer Figur ist eine Steigerung der Wirkung durch farbige Behandlung kaum denkbar. Schon die Verteilung von Ober- und Unterkleid ist eine solche, daß durch ein Auseinanderhalten mittels Farbe nur eckige und unschöne Überschneidungen entstünden, welche der plastischen Erscheinung nicht zum Vorteil gereichen würden. Die großen Flächen des Mantels würden in anderer als der dermaligen grünlichen Farbe eben auch nicht viel anders erscheinen als jetzt.
Wohl aber würde die ganze Gewandung bei einer Ausführung in Bronze durch die Glanzlichter auf den Höhen und die dunkeln Schatten in den Tiefen der Falten sehr wesentlich belebt werden.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß der grünliche Anstrich der Figur nicht modern, sondern alt und mehrmals erneuert ist.
Mit dem Gesagten ist eine ziemliche Wahrscheinlichkeit für Peter Vischers Autorschaft gewonnen. Es darf indes nicht verschwiegen werden, daß zur Gewißheit manches fehlt.
Wenn auch Vischer von den kurzen Verhältnissen der magdeburger Figuren später zu schlankern übergeht, so überschlanke Figuren, wie die nürnberger Madonna sind von ihm doch nicht bekannt. Und die Ausführung ist sorgfältiger, als wir es sonst von Vischer gewöhnt sind.
Man möchte vielleicht, wenn man die Autorschaft Peter Vischers bezweifelt, an einen seiner Söhne denken, allein solange wir deren künstlerische Individualität nicht genauer kennen, wird sich auch nicht entscheiden lassen, ob etwa statt des Vaters, einer der Söhne, als Meister der Figur in Frage kommt.
Nürnberg.
Gustav von Bezold.