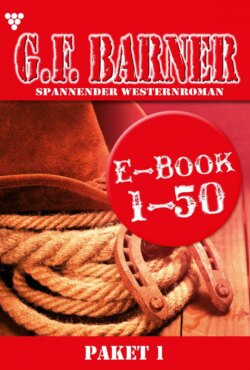Читать книгу G.F. Barner 1 – Western - G.F. Barner - Страница 30
ОглавлениеEs gibt wenige Dinge, die einen Mann wie Trevor Joslyn aufregen können, aber diese Sache tut es.
Während er mit dem geübten Blick eines Mannes, der viel im Sattel ist, den Himmel betrachtet, entdeckt er weit hinten die beiden noch kleinen Punkte und macht sie sofort als Aasgeier aus.
Die Geier kreisen. Ein Zeichen, dass sie Beute entdeckt haben. Und Joslyn fragt sich in diesem Augenblick, während er auf San Antonio in Texas zureitet, ob er dort unter den Geiern seine Männer finden wird. Dann schüttelt er den Kopf, aber dieses Kopfschütteln vertreibt nicht die finstere Ahnung in ihm.
Irgendetwas wird mit Saguaro, Eddy und Tonio passiert sein. Sie müssten längst wieder an der Herde ihre Arbeit tun, denn sie wissen alle drei, dass jede Hand gebraucht wird. Und nichts ist ihrer Art fremder, als sich vor irgendeiner Arbeit zu drücken.
»Ich«, sagt Trevor Joslyn zwischen den Zähnen, um die heiße Luft nicht gleich im Schwall zu atmen, »ich würde mir verdammt keine Sorgen machen, wenn nicht Slim wäre, dieser Bursche Slim Dorlanay. Ich habe ihm die Herde vor der Nase weggenommen und das vergisst er mir so wenig wie all die anderen Dinge, die ich ihm zugefügt habe. Eigentlich habe ich ihm gar nichts zugefügt, was er nicht verdient hätte, aber er hat es jedes Mal herausgefordert.«
Er hat die düstere Vorahnung, dass Slim Dorlanay irgendetwas mit dem Ausbleiben seiner Leute zu tun hat. Diese Ahnung ist beinahe eine Gewissheit und macht Joslyn langsam wütend.
So nähert er sich nun dem Punkt, über dem die beiden Rindergeier kreisen und sieht dort nur einen schon halb abgenagten Rest von einem Hund oder einem kleinen Maverick liegen. Genau kann man das nicht mehr bestimmen. Nur der Gestank lässt sich bestimmen, denn er weht genau auf Trevor Joslyn zu.
»Pfui Teufel«, sagt Trevor brummend und reitet im Bogen vorbei. »Das stinkt jämmerlich, ich möchte wissen, warum niemand das Stück Aas verscharrt.«
Und dann kommt Joslyn über die Bodenwelle und sieht in einer Meile Entfernung San Antonio vor sich liegen.
Dort ragt der hohe Schuppen der Häuteverwertung auf, ein dreistöckiger Holzbau, in dem stinkende Felle hängen und einen Geruch verbreiten, der schon drei Eingaben der Bürger zur Folge gehabt hat.
Weiter links liegt Bessemers Schmiede und neben ihr die alte Poststation.
Einige der Männer hocken bewegungslos wie Hühner auf einer Stange auf den Corralbohlen und sehen zu ihm hin, als er vorbeikommt.
Trevor erkennt Steve McLaine, einen sehr guten Mann, der trotzdem nicht bereit gewesen ist, mit ihm auf den Trail zu gehen. Er sieht weiter Wesley Hardin einen aus der weitverzweigten Hardinsippe. Ein friedlicher junger Mann, der sehr gut mit dem Lasso umgehen kann. Diese Männer hier kennt er alle. Und sie kennen ihn, den Mann, der hundertmal gezeigt hat, dass er etwas kann, der dann aber fortgegangen ist.
Warum – das weiß keiner.
Das weiß nur er allein – und ein Mädchen vielleicht.
Trevor hält neben den Männern an, die sich nicht rühren, aber gerade darin sieht er die Zeichen dessen, was auf ihn wartet.
Er sieht die Blicke, Blicke, die an ihm vorbeigehen und abwarten. Sie werden nichts sagen, sie sitzen hier wie eine Meute Männer, die auf etwas gewartet haben.
Und in dieser Sekunde weiß Trevor Joslyn, den sie auch den ›sanften Trevor‹ nennen, auf wen sie warten: Auf ihn!
Jetzt betrachtet er sie der Reihe nach und nickt ihnen zu.
»Hallo, Dutch«, sagt Trevor sanft wie immer, wenn man ihm begegnet.
»Hallo, Frankie – Steve – Wesley.«
Und dann erst, als sie ihn alle ansehen, kommt der Nachsatz: »Habt ihr Saguaro, Eddy und Tonio gesehen?«
Sie sehen immer noch an ihm vorbei. Er kennt diese Art, mit einer Antwort zu warten, niemanden anzusehen und doch viele Dinge sagen zu können. Und er weiß nun, dass mit seinen drei besten Männern etwas passiert sein muss.
»Ja«, erwidert Steve McLaine langsam. »Sie sind beim Doc.«
»So«, macht der sanfte Trevor nur. »Und?«
»Jemand ist ihnen begegnet, der zu groß für sie gewesen ist, Trevor«, murmelt Wesley Hardin. »Er hat Saguaro gesehen und ihm gesagt, dass er aus dem Weg gehen muss, wenn ihm ein Weißer begegnet.«
»Das hat der Mann gesagt? Und dann?«
»Nicht viel, Trevor. Saguaro wollte weitergehen, er wollte keinen Streit haben, aber Eddy ist wild geworden und hat den Revolver gezogen.«
»Und dann?«
»Jetzt ist er beim Doc und hat Glück gehabt, dass die Kugel nur seine Schulter streifte. Glück, dass Parker mit seiner Schrotflinte dazugekommen ist, sonst würde er tot sein.«
Sie betrachten Trevor jetzt alle. Und es ist nichts als die Neugierde von Männern in ihren Blicken, die erkennen möchten, ob sich Trevor aufregen kann.
Aber Trevor zeigt keine Erregung – er ist sanft wie immer.
»Der Sheriff ist nicht da, nur der Deputy, Hardin?«
»Nur Parker, aber er hat einen Mord verhindert. Vielleicht auch drei.«
»Drei?«
»Einige von uns sind sicher«, meldet sich ganz hinten der alte Johns mit seiner Fistelstimme, »dass der Bursche zu schnell für Tonio, Eddy und Saguaro gewesen sein würde. Saguaro hat ja nur sein Messer. Und mit zwei Männern wird der Bursche leicht fertig.«
Danach sehen sie wieder weg, aber sie klettern nun von ihrer Corralstange herab und kommen einige Schritte auf Trevor zu.
Trevor blickt über sie hinweg, sanft, ruhig, nur ein wenig nachdenklich.
Das ist es also, denkt Trevor Joslyn, so kommt es, wenn man sich Slim Dorlanay zum Feind macht. Irgendein Revolvermann, der auf meine besten Weidereiter losgeht. Einmal, um meine Mannschaft zu schwächen, zum anderen, um mich aus der Reserve zu locken. Und im Hintergrund sitzt wie eine Spinne Slim und wartet nur darauf, dass sich das Netz zuzieht und ich von einem Giftzahn getötet werde, wenn dieser Giftzahn auch ein Revolvermann ist.
Er nimmt den Blick herunter und sieht Steve McLaine an. Eine Sekunde bedauert er, dass er auf die Mitarbeit dieses ausgezeichneten Mannes verzichten muss, aber Steve hat noch nie jemanden im Stich gelassen, für den er geritten ist.
Er hat jetzt eine gute Arbeit und will nicht fortgehen. Niemand kann ihm das verdenken.
»Steve, wie heißt der Mann – und wo ist er?«
McLaine schürzt etwas die Lippen, ein beinahe vorsichtiger Ausdruck überzieht sein Gesicht.
»Wenn du dich unbedingt totschießen lassen willst, dann such ihn dir. Er ist nach der Schießerei weggeritten. Parker ist ihm nach, um festzustellen, wo er geblieben ist. Hast du schon mal von ›Big Charlie‹ gehört, Trevor?«
»James Charlie, mit der großen Nase?«
»Genau der. Er ist gekommen und hat Saguaro einen stinkenden Bastard genannt, der einem Weißen aus dem Weg zu gehen hätte. Weißt du, was das heißt? Er wird eines Tages ein Messer im Bauch haben, wenn Saguaro ihn allein erwischt.«
»Ja«, sagt Trevor Joslyn bitter. »Aber Saguaro eine Kugel im Kopf. Woher ist dieser Halunke Charlie gekommen?«
»Das fragst du dich am besten selbst. Er hat es niemandem gesagt und wird es auch dir kaum sagen!«
Joslyn biegt auf der Straße scharf nach rechts um und nähert sich dem Haus des Doc. Er sieht einige Leute, die ihn wie einen guten alten Bekannten begrüßen, der nach vier Jahren wieder in dieser Stadt ist. Er grüßt zurück, lächelt hier und da und beantwortet auch einige Zurufe.
San Antonio ist eine friedliche Stadt, in der nichts mehr verrät, dass erst vor kurzer Zeit eine Schießerei stattgefunden hat. Reiter kommen und gehen, Männer und Frauen spazieren auf dem Gehsteig entlang. Einen Augenblick streift Joslyns Blick die Fandango-Hall, und die Erinnerung ist wieder da.
Vielleicht wird er sie hier irgendwo treffen, vielleicht kommt sie im nächsten Augenblick aus der Tür dort drüben, an der noch ihre Initialen in vergoldeten Buchstaben stehen.
Sie heißt Mary Anne und ist einmal seine ganze Liebe und Hoffnung gewesen. Mary Anne Wheeler. Es war vor vier Jahren. Heute heißt sie Mary Anne Sherburn und ist die Frau des größten Mannes in dieser Gegend.
Vielleicht spricht sie manchmal im Traum, wenn sie neben Adam Sherburn liegt und schläft. Vielleicht redet sie dann das, was sie in den Nächten gesprochen hat, die sie mit Trevor Joslyn einmal verbrachte. Dann wird Adam vielleicht wissen, dass er zwar eine um vierzehn Jahre jüngere Frau bekommen hat, aber diese Frau ihn nur wegen seines unheimlichen Geldhaufens und wegen sonst nichts genommen hat.
Dann hält er vor dem Haus des Doc, sieht im Absitzen, dass die Leute ihn alle beobachten und stehen geblieben sind und betrachtet kurz den Wagen und die beiden Pferde vor dem Haus.
Narrheit, denkt er eine Sekunde, Narrheit, sie noch in die Stadt zu schicken, damit sie den Rest an Verpflegung holen. Sicher liegt alles auf dem Wagen.
Er blickt in den Wagen und nickt. Sie haben also alles besorgt. Und Eddy Swartz hat eine Kugel erwischt. Idiotischer Eddy, immer zu gerade und immer zu schnell beleidigt. Musst ruhiger werden, Junge. Brate deinem Gegner eins, wenn er denkt, dass du schon wieder friedlich geworden bist. Man muss immer eine Idee klüger sein wollen, Eddy.
Mit diesem Gedanken geht er auf die Tür zu und stößt sie auf. Und dann hört er auch schon deutlich durch die Tür vom letzten Zimmer jemanden sagen: »Mein Himmel, Trevor kommt, jetzt bekommst du etwas, Eddy!«
»Er hätte es auch getan und … Verdammt, Doc, muss das so fest sein?«
Trevor Joslyn macht einfach die Tür zum Behandlungszimmer auf und tritt ein. Er macht die Tür mit einer nachlässigen Bewegung zu, blickt die drei Männer an, die vor einem auf dem Stuhl sitzenden vierten Mann stehen und lehnt sich an die Wand.
»Dieser dicknasige Halunke …«
Eddy ist zwar blass, aber wenigstens kann er wütend reden und sogar gut sitzen. Um seine Schulter liegt ein Verband, der beinahe so weiß wie Eddys Haar ist. Eddy Swartz hat ganz weiße Haare und heißt eigentlich Eduard, aber sie nennen ihn nur Eddy. Er ist ziemlich groß, dabei schlank, und ziemlich zäh. Der beste Beweis für seine Zähigkeit ist, dass er noch sitzen kann und wütend wird.
»Halt den Mund, Ed!«
Eddy Swartz senkt den Kopf. Mit Eddy angesprochen zu werden, das ist gut, aber einfach Ed genannt zu werden, das ist schon übler.
Tonio, ein Mexikaner mit langen Haaren und traurigen Augen, dem die Juaristas einmal die Eltern aus Versehen umgebracht haben, bekommt den Schluckauf.
Nur Saguaro, ein Indianer vom Stamm der Chihuahuas, ein Mann mit einem untrüglichen Verstand für Pferde, richtet sich etwas auf und sagt hart und singend: »Boss, warum du wütend? Er hat gekämpft für Saguaro. Wo kämpfen ein Weißer für Indianer?«
»Diese Narren hätten sich gefälligst sagen sollen, dass ich euch alle drei brauche. Also – keinen Kampf. Nun, wie willst du jetzt reiten können, Eddy, du Narr?«
»Festgebunden!«
»Den Teufel wirst du tun, du wirst bei Bill auf dem Wagen sitzen, verstanden? Saguaro, warum hast du es diesem dicknasigen Charlie nicht gegeben?«
»Nicht meine Zeit.«
Der Indianer, ein untersetzter, breitschultriger Mann mit breiten Füßen und schweren Lidern über den Augen, sieht aus dem Fenster in den Hof des Hauses. »Und du, Tonio? Warum hast du Eddy nicht zurückgehalten?«
»Der Hundesohn Charlie hatte Saguaro beleidigt. Saguaro ist so gut wie jeder von uns. Ich würde auch noch gezogen haben.«
»Und tot sein, was? Habt ihr den Burschen nicht an der Nase erkannt?«
»Zu spät.«
»Natürlich, machen nicht die Augen auf. Und mit so einem Rudel Narren geht man auf den Trail. Saguaro, du wirst Charlie vielleicht wiedersehen. Dann bleibt das Messer in deinem Gürtel stecken, verstanden?«
Diese Warnung muss sein. Der Indianer ist durch das jahrelange Zusammenleben mit Weißen beinahe selbst im Denken und Fühlen zu einem Weißen geworden. Die Behandlung, die man ihm ständig hat angedeihen lassen, hat seinen Charakter verändert. Er kommt sich wie ein gleichberechtigter Partner aller Weißen vor. Und darin hat er sicher recht, denn erstens schläft er mit ihnen, zweitens aber versorgt er alle Männer an einer Herde ständig mit frischen Pferden. Er hat seine Augen überall und sorgt selbst dafür, dass keiner der Cowboys sein Pferd überfordert. Saguaro ist in die Rolle eines Freundes aller hineingewachsen, obwohl er erst einundzwanzig Jahre jung ist.
Jetzt blickt er auf den Boden, dumpf, wild.
»Ich bin nicht schmutziger Bastard. Ich habe andere Haut, aber ich nicht schmutziger Bastard, Boss.«
»Nein, das wissen wir doch alle, Saguaro. Lass einen Narren und Krachsucher reden, wir denken doch anders darüber. Du darfst nicht auf ihn losgehen, hörst du? Wenn du ihn erwischt und er erwischt dich nicht – was reiner Zufall sein würde, dann hängen sie dich auf. Ein Indianer hat keinen Weißen umzubringen, selbst wenn der Weiße der größte Lump auf Gottes weiter Welt ist. Klar, Saguaro?«
»Nicht dasselbe Recht, weil andere Haut, eh?«
»Das weißt du doch, Saguaro!«
»Indianer auch kämpfen für Weiße, dann umbringen Weiße und bekommen Orden. Warum nicht dasselbe, wenn ich Dicknase zeigen mein Messer?«
»Weil kein Krieg ist, Saguaro!«
»Dann ich machen Krieg mit Dicknase.«
»Zum Teufel, du machst keinen Krieg mit Dicknase«, sagt Trevor heiser. – »Doc, bist du fertig?«
»Nur noch einen Knoten und ihm das Hemd überziehen, Trevor. Es ist keine schwere Wunde, die Kugel hat ihn sehr hoch erwischt. Ich habe es zufällig gesehen, Ed hat zuerst zum Revolver gegriffen!«
Danach zieht Eddy mithilfe Tonios sein Hemd über, steckt den Arm in seine Weste und grinst schon wieder unternehmungslustig.
»Boss, ich könnte einen Drink vertragen!«
»Du kannst einen Tritt bekommen, Eddy, das sage ich dir. Ist Charlie euch absichtlich in den Weg gekommen?«
»Klar, es wird Absicht gewesen sein, denn er ist genau auf uns zugeritten, abgestiegen und dann auf die Tür des Store zugekommen. Und da musste er auf Saguaro treffen. Er hat genau gewartet, bis Saguaro mit den beiden Tonnen vom Wagen zurückgekommen ist. Natürlich kann er das auch anders hindrehen, wie?«
»Charlie ist nicht dumm. Seht euch also in Zukunft etwas vor. Habt ihr die Nasenspitze von Slim gesehen?«
»Kein Stück«, antwortet Tonio düster. »Der Kerl ist nicht da. Hattest du etwas anderes erwartet?«
»Nein, nichts. Gehen wir. Los, raus mit euch!«
Also gehen sie hinaus, kommen zum Wagen und sehen sich um. Eddy ist vorher geritten, Saguaro hat gefahren. Zögernd hält Eddy Swartz vor seinem Pferd an.
»Eddy, auf den Bock neben Saguaro.«
»Aber – ich kann …«
»Auf den Bock, du Narr!«
»Ja, Boss.«
Eddy steigt brummend und mit der Hilfe der anderen beiden auf, Tonio nimmt dann sein Pferd. Auch Trevor will zu seinem Pferd gehen.
In dieser Sekunde passiert es!
Ein Mann hat es verstanden, einen Deputy auszutricksen und ihn in eine falsche Richtung zu locken.
Jetzt ist dieser Mann da, obwohl ihm Deputy Parker den Aufenthalt in der Stadt verboten hat. Und wo der Deputy ist, das kann man nur raten. Der Deputy ist weit weg, irgendwo auf den Rio Hondo zu.
Es ist vielleicht Zufall, dass Trevor Joslyn in diesem Augenblick wieder an Mary Anne und den Saloon denken muss, an jene goldenen Initialen an der Tür und an die Tage und Nächte in dem Saloon, oben in den Räumen.
Er blickt hin, nur in der Hoffnung, dass der Geist Mary Annes auftaucht, denn Mary Anne hat den Saloon verpachtet, sie ist nie mehr dort.
In diesem Moment sieht Trevor, der von den oberen Fenstern nach unten auf den Vorbau blickt, die eine Tür aufgehen.
Er ist im ersten Augenblick nur erstaunt, dass der Mann mit der dicken Nase hier ist, und Parker fehlt.
Die Schwingtür geht auf, die vergoldeten Initialen funkeln einmal in der Sonne.
Dann kommt der Mann mit der dicken Nase mit dreister Selbstverständlichkeit in die Sonne hinaus. Diese bescheint ihn zuerst nur bis an die Oberschenkel, dann aber, in seiner fließenden Bewegung, erfasst sie seine beiden Revolverhalfter, die kurze schwarze Weste, die reichlich bestickt ist und den breiten Waffengurt mit den blinkenden Messinghülsen der Patronen.
Auf dem Vorbau des Saloons, in dem einmal Mary Anne zu Hause gewesen ist, steht James Charlie. Und er sieht Trevor mit seinen eiskalten Augen durchdringend an.
Die Sache ist noch lange nicht zu Ende.
Sie fängt jetzt erst richtig an.
Und Trevor wird nicht weglaufen.
*
Joslyn sieht drüben Reverend Atchinson stehen bleiben, einen hageren, von der Kanzel wetternden Mann, der niemals ein Blatt vor den Mund nimmt.
Vor dem Store von Hamilton sagt eine Frau etwas zu ihrem Mann, ehe sie beide in den Store hasten. Drüben packt eine andere Frau ihr Kind und zerrt es heftig in die Sicherheit des Hausflures zurück.
Vor dem anderen Saloon aber, der linker Hand neben dem Store liegt, dreht sich ein Mann scharf auf dem Absatz um und ruft etwas in die offene Tür hinein.
Im nächsten Augenblick kommen auch die ersten Männer heraus.
Steve McLaine erscheint neben Wesley Hardin und Dutch. Die anderen bleiben hinter der Tür und an den Fenstern.
Rechts rasselt plötzlich der eiserne Laden von Bigler vor das Schaufenster mit den Anzügen und Hüten. Männer rennen wie unter Zwang und in Panik davon, Frauen flüchten. Auf dem Bock des Covered richtet sich Saguaro auf und sagt, nach einem Blick über die Plane hinweg rückwärts: »Dicknase!«
Nur ein Wort, aber es reicht aus, um Eddy hochkommen zu lassen.
Tonio hinter dem Wagen bewegt sich nicht mehr. Er hat den Mann auf dem Vorbau von Mary Anns Saloon längst gesehen.
Trevor Joslyn aber braucht nur vier, fünf Atemzüge, dann weiß er, dass er hier niemals weglaufen kann. Zwar könnten sicher einige Leute verstehen, wenn er nun einfach anreiten würde, aber einer seiner Männer ist angeschossen worden. Es gibt hier sehr einfache und vollkommen unkomplizierte Gesetze, die nicht einmal schriftlich niedergelegt sind. Ein Herdenboss, ein Vormann, oder wer immer sonst Männer führt und führen will – er muss für seine Männer sorgen, er muss sie verteidigen und sie im Notfall auch rächen.
Dies alles weiß auch Trevor. Und darum nimmt er langsam die rechte Hand vom Zügel, legt sie auf das Sattelhorn und steigt langsam wieder ab.
Unter dem Pferdehals hindurch wirft er einen schnellen Blick auf Charlie, der sich wirklich bewegt. Und bereits in dieser Bewegung drückt sich alle Vorsicht Charlies aus. Dicknase Charlie weicht augenblicklich mit einer schnellen Bewegung in die Deckung der einen Tragstütze zurück. Ein Mann, der so auf Sicherheit bedacht ist, dass er jeden Überraschungsangriff ausschalten möchte – einen Angriff mit einem Gewehr, denn Trevor Joslyn könnte sein Gewehr ziehen und schießen. Vielleicht würde ein anderer Mann es tun, ein Lump vielleicht, aber nicht Trevor. Hierin irrt sich Charlie, doch er ist vorsichtig, er vermeidet jedes Risiko.
Joslyn erkennt es in einem Moment und bleibt stehen. Hier beginnt er bereits seinen Mann gründlich zu verwirren. Er verlässt seinen Standort nicht gleich, sondern sagt kurz und knapp zum Wagen hin: »Jeder bleibt an seinem Platz! Das ist ein Befehl! Niemand mischt sich ein, solange ich es nicht will. Wer weiß, wo Parker stecken mag, dass der Bursche wieder hier auftauchen kann. Ich werde ihn mir ansehen.«
»Vorsicht, Trevor«, japst Eddy keuchend. »Der Kerl ist so gefährlich wie eine Klapperschlange. Er zieht links eine Idee schneller.«
»Ich weiß es. Kennt er mich nicht?«
Darin liegt alles, was ein Mann sagen kann. Sie alle haben es erlebt, dass ein Mann stehen geblieben ist, nachdem er bereits verwundet wurde: Trevor Joslyn. Sie haben es erlebt, dass Joslyn immer und in jedem Fall die Nerven behalten hat. Und darin liegt zu oft die Entscheidung eines Kampfes.
»Boss, sei wachsam, er trickst dich vielleicht«, warnt jetzt auch Tonio. »Muss das sein? Du hast gesagt, dass keiner von uns zu kämpfen hat, ehe die Herde …«
»Kann ich weglaufen, nachdem er Ed angeschossen hat?«
Damit macht Trevor seine Jacke auf und geht hinter dem Pferd her. Sie sehen es alle, dass die Jacke aufgeht und an der linken Seite der Kolben seines schweren Revolvers, von dem sie wissen, dass er einmal als Preis in einem Rodeo-Schießen dem besten Schützen übergeben worden ist: Trevor Joslyn.
Und dann geht Trevor auch schon los. Er geht mit langen ausgreifenden Schritten zuerst auf die Mitte der Straße zu, biegt dann aber mit einer jähen Wendung nach rechts um und marschiert nun auf den rechten Gehsteig los.
Es ist der gleiche Gehsteig, der auch zum Vorbau von Mary Annes Saloon führt. Niemals hat einer der Einwohner den Saloon bei seinem richtigen Namen genannt. Er hat immer Mary Annes Saloon geheißen. Und nun steht Dicknase Charlie auf dem Vorbau dort. Ein Mann, der in dieser Minute den nächsten Schreck bekommt, der nur durch Kaltblütigkeit zu beeindrucken ist.
Niemand sucht den Kampf auf einem Gehsteig, jeder geht auf der Straße. Trevor Joslyn aber ist auf den Gehsteig gegangen und kommt schnell und ohne auch nur einmal zu zögern auf seinen Herausforderer zu.
Dicknase Charlie kann nicht mehr ausweichen, er kann auch nicht mit einem leichten oder überheblichen Grinsen seinem Mann auf der Straße entgegentreten – er muss vom Gehsteig, er muss herunter oder in den Saloon zurück.
Das wird dann wie eine Flucht aussehen. Eine Blamage wird es sein, darum muss er bleiben und reden. Charlie ist nervös geworden.
»Komm vom Gehsteig«, ruft Charlie heiser und zornig. »Das ist ein verdammter Trick, Joslyn! Kommst du herunter?«
Joslyn ist ihm auf fünfzig Schritt nahe und sagt knapp und sanft: »Geh du doch oder lauf weg, Großmaul. Es wird besser für dich sein! Lauf doch!«
»Du verdammter …«
Dicknase Charlie will stehen bleiben, aber er kann nicht, er hat nicht dieselben Nerven, das beweist sich jetzt. Er muss herunter auf die Straße und sagt, wütend wie er ist: »Du Feigling willst ja nur für mich eine schlechtere Position!«
»Ich? Du bist schon so oft weggelaufen, dass es auf einmal mehr auch nicht ankommt, Dicknase«, erwidert Joslyn kühl und regt Charlie durch die Bemerkung über seine Nase noch mehr auf. »Renn weg und gibt deinem Boss das Geld zurück. Nun – wie ist es?«
»Ich werde dich durch und durch schießen, dass die Sonne durch dich scheint, du verdammter Bursche. Kommst du jetzt bald herunter?«
»Warum sollte ich, wenn du wegläufst?«
Hinten am Wagen sagt Eddy schnaufend: »Er macht ihm alle Zähne locker, dass sie schmerzen. Seht ihr das? Das hat Dicknase nicht erwartet, jetzt wird er wütend und verliert die Übersicht. Pass auf, diese Sache gewinnt Trevor mit nur einer Hand!«
»Sei nicht so sicher, er kann … Achtung, er ist nahe genug, um Charlie …«
Tonio kommt nicht weiter. Sie kennen Trevors Art, einen Mann in die Enge zu treiben, der sich absolut schießen will, nur zu gut. Und genau das macht Trevor jetzt. Er ist Charlie auf etwa dreißig Schritt nahe, springt urplötzlich los und beginnt auf dem Gehsteig zu rennen.
Der bestürzte Charlie aber weiß damit nichts anzufangen. Er sieht seinen Gegner nur rasend schnell auf sich zulaufen und wird noch weiter in die Enge getrieben. Die Entfernung verringert sich zu schnell. Trevor Joslyn kommt und bleibt dann jäh hinter der nächsten Tragstütze stehen – jetzt nur noch knappe achtzehn Schritt entfernt.
Dann macht Joslyn einen wilden Satz nach links auf die Fahrbahn und steht nun breitbeinig im Staub.
»Well«, sagt er auf seine immer noch sanfte Art. »Verschwinde, du Narr, wenn du nicht sterben willst. Dies ist die letzte Chance, die ich dir lasse: Verschwinde oder kämpfe fair. Sieh her, ich werde meine Jacke …«
Er sieht bereits die wilde Wut in Dicknase Charlies Gesicht, und die Hand Charlies nach unten sinken. Und da macht seine Linke eine blitzschnelle Bewegung zum Jackenflügel.
Vielleicht sieht das wie der Ansatz zum Ziehen des Revolvers aus, aber seine Hand trifft nur den Jackenflügel. Der Stoff fliegt nach hinten. Charlies Hand zuckt herunter zum Kolben und klatscht gegen die Walnussschalen des Griffes.
In der nächsten Sekunde – Charlie hat die Hand einwandfrei zuerst am Revolver – kommt Trevor Joslyns linke Hand auch an den Colt und zieht ihn. Dann jedoch sieht Charlie die blitzschnelle und ruckende Bewegung von Trevor Joslyns rechter Hand. Und in dieser Sekunde erkennt er, dass er geblufft worden ist. Sein eigener Trick, die rechte Hand zuerst zu gebrauchen, kommt nicht mehr zur Ausführung.
Dicknase Charlie muss mit aller Schnelligkeit, zu der er fähig ist, links ziehen. Und er zieht nun.
Trevor Joslyns Rechte aber zuckt einmal unter die offene Jacke. In der nächsten Sekunde liegt der zweite Revolver in der Hand. Joslyn hebt die Hand, erkennt, dass Charlie wirklich schnell wie der Blitz ist und zaudert nicht mehr. Er muss schießen, denn sonst bringt der von Slim Dorlanay angeworbene Revolverheld ihn um.
Im gleichen Augenblick bricht auch schon der Schuss aus Trevors Revolver. Es grollt durch die breite Straße, hallt von den Hauswänden wider und wabert als Echo zurück.
Während James Charlie zusammenzuckt und sich fast schwerfällig nach links dreht, rennt Joslyn auch schon los. Es sieht furchterregend aus, als er mit wilden Sätzen auf Charlie zuspringt. Es wirkt wie der Lauf eines Selbstmörders, aber auch das täuscht. Zwar schießt Joslyn nicht mehr, doch jetzt feuert Charlie.
Seine Kugel reißt ein armlanges Spanstück aus dem Haltebalken vor Mary Annes Saloon. Sie fliegt dann hoch und surrt über die Köpfe der sich zu Boden werfenden Neugierigen durch eine Scheibe, die klirrend zerbricht.
Dann will Charlie herum, aber er knickt jetzt links ein. Und Joslyn kommt. Er kommt in drei, vier wilden Sprüngen herangestürmt, stößt jäh seine linke Hand heraus, vor die linke Schulter des Revolvermannes.
Dieser Stoß bringt Charlie ganz aus dem Gleichgewicht und wirft ihn endlich in den Staub.
Trevor macht nur noch einen kurzen Satz, sieht den linken Revolver des angeworbenen Schießers in den Staub wirbeln und setzt dann seinen rechten Fuß auf den Boden.
Unter dem Fuß aber liegt Charlies rechter Revolver.
Der Druck klemmt die Finger des Revolvermannes am Boden fest. Aus dem Revolver bricht eine Feuerlanze unter dem Fuß von Trevor Joslyn durch. Die Kugel reißt eine meterlange Bahn durch den Staub der Straße, ehe sie sich abhebt und gegen den Himmel davonschwirrt.
Charlie liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem Loch in der Hüfte auf der Straße. Seine rechte Hand ist blockiert, sie kann nichts mehr tun. Und dann treffen sich ihre Blicke. Kühl und ganz ruhig, mit einem leicht bitteren Zug um die Mundwinkel, so sieht Joslyn auf den am Boden liegenden und heftig keuchenden Mann hinab. In der darauffolgenden Sekunde hebt er den rechten Fuß leicht. Sofort reißt Charlie die Hand weg und mit ihr den Revolver, kommt aber zu nichts mehr.
Joslyn macht es kurz und rau. Er lässt seinen Fuß wieder nach oben schnellen. Der Tritt wirbelt auch den zweiten Revolver Charlies davon, der irgendwo am Gehsteig zu Boden fällt.
Es ist für jeden der Männer, die hier zusehen, beinahe unbegreiflich, obwohl sie Trevor genau zu kennen glauben. Trevor tritt jetzt einen halben Schritt zurück. Sein Revolver deutet nach unten auf den kreidebleichen Charlie. Und dann fragt Joslyn knapp: »Hast du genug, Mister?«
Charlie verfärbt sich noch mehr. Er sieht genau in die Mündung des Revolvers. Und er denkt natürlich das, was jeder harte und nicht viel fragende Revolvermann denken muss: Bei dem geringsten Widerstand wird Joslyn schießen.
»Ja«, sagt er gepresst und kaum hörbar. »Hör auf, ich kann nicht mehr, meine Seite – meine Seite! Der Schmerz …«
»Er wird dich nicht umbringen. Du hast es so haben wollen, jetzt beschwere dich nicht und höre auf zu jammern … Augenblick! Liegst du still!«
Charlie bewegt leicht den rechten Arm, dabei spannt sich seine Weste über der Brust. Joslyn bückt sich blitzschnell.
Es ist nur ein Ruck, der Charlie die Revolvermündung auf die Westenseite links setzt, dann greift Joslyns freie Hand zu.
Noch ein Ruck, die Hand taucht unter der Weste mit einem Derringer auf und hebt die Waffe hoch.
»Hast du noch ein Schießeisen, dann sage es lieber gleich, Dicknase. Es wird sonst schlimm für dich, verstanden?«
»Ich – ich habe keinen«, stottert Charlie und sinkt flach zurück. »Ich schwöre …«
»Gut, hast du gelogen, dann bestelle dir einen Platz auf dem Boot Hill. Ich mag es nicht, wenn jemand von hinten schießt. Kannst du aufstehen oder soll ich dir …«
Er will sagen, ob er ihm helfen soll, aber er verstummt mit einem knappen Räuspern.
Trevor Joslyn hebt den Blick über Charlie hinweg an und sieht nun drüben am Anfang der Straße hinter der Schmiede den Wagen kommen. Er erkennt auch Nat Parker neben dem Wagen, aber der Wagen ist wichtiger als Parker, der augenscheinlich gerade den Wagen überholt hat und nun im Galopp herankommt.
Trevor schließt einen Moment die Augen. Er sieht diese Frau auf dem Bock, ihr blondes Haar und den sanften Schwung ihrer Augenbrauen. Er erinnert sich nicht mehr an die Nase. Er sieht sie nun, und er denkt an jene Tage, an denen er sie – eine alberne Angewohnheit – mitten auf die Nasenspitze geküsst hat.
Mary Anne Sherburn ist erleichtert, aber sie beherrscht sich in der folgenden Sekunde bereits wieder. Die langen schwarzen Handschuhe über ihren schlanken Händen, dieses Kleid, über dem sie einen Spitzenumhang trägt – das alle verrät, dass sie es geschafft hat.
Manche Frauen erreichen alles, denkt Trevor bitter. Sie schaffen es, einen Mann verrückt zu machen, ihn zu locken und schließlich zu ruinieren. Sie hat die oberste Stufe der Leiter erreicht, ihr Lebensziel.
Warum ist sie gekommen?
Er hebt den Kopf, als der Staub vor den Hufen von Parkers Pferd in einem Schwall in die Luft fliegt und ihn und Charlie überschüttet.
»Dieser – dieser verdammte Trickser«, sagt Parker und hat alle Mühe, seine Worte herauszubekommen. »Was hatte ich dir gesagt, Charlie, was, he? Du Bursche, du hast mich getrickst! Ist er auf dich losgegangen, Trevor?«
»Es sieht so aus«, bemerkt Trevor sparsam. »Es ist eine faire Sache gewesen, Nat. Kein Grund, sich aufzuregen!«
»Für dich nicht«, erwidert Parker eingeschnappt. »Für dich ist nichts aufregend genug, aber für mich, mein Freund. Ich hatte diesem Burschen gesagt, dass ich keinen Schießer und keine Schießerei in der Stadt haben will, und er darum verschwinden solle. Und wo ist er jetzt? – Hier! Halunke, steh auf, sonst mache ich dir Beine. Du kommst so schnell ins Jail, dass du es gar nicht glauben wirst. Ich werde dir helfen, mich an der Nase herumzuführen, Charlie. Steh auf!«
Er steigt wütend ab und beugt sich über Charlie. Und es ist niemand da, der seine Wut nicht versteht. Schließlich hat ihn Charlie wirklich an der Nase herumgeführt.
Parker packt Charlie am Kragen, stellt ihn auf die Beine und zwingt ihn zu gehen, sagt aber nach zwei Schritten: »Trevor, beschuldigst du ihn des Mordversuchs?«
»Nein!«
»Was, zum Teufel – nein? Er hat doch versucht …«
»Er ist nicht groß genug dazu gewesen«, erwidert Trevor Joslyn kühl. »Von mir aus kannst du ihn laufen lassen!«
»Laufen …? Trevor, bist du verrückt?«
»Nein, ich denke nicht, Nat. Mach mit ihm was du willst«
»Du bist und bleibst – ein Narr!«
Und damit stößt Parker Charlie hart vor sich her und treibt ihn auf das Office zu.
Jetzt kommen die Leute auf die Straße. Saguaro läuft auf seinen leicht gekrümmten Beinen vom Wagen heran, Tonio folgt ihm.
Doch sie sind nicht eher am Vorbau des Saloons, als der Wagen mit Mary Anne auch dort eintrifft.
»Du – du, Trevor«, sagt Tonio keuchend. »Trevor, warum hast du ihm eine Chance gelassen? Hast du nicht seine Blicke gesehen? Dieser Bursche vergisst dir das nie. Ich sage dir, du siehst ihn wieder, und dann …«
»Mr Joslyn!«
Diese Stimme ist hinter Trevor, der sich umgedreht hat und zu seinen Leuten blickt, Mary Anne also den Rücken zuwendet. Er hört ihre Stimme und registriert instinktiv, dass diese Stimme etwas härter als früher klingt, nicht mehr so jung und nicht mehr so weich. Er kann sich noch gut erinnern, dass er immer hinten vom Hof aus in den Saloon gekommen ist, kaum einmal von vorn. Niemand in dieser Stadt weiß etwas von dem, was einmal zwischen ihm und Mary Anne war. Und wenn es doch jemand geahnt hat, geredet wird niemals einer haben.
»Ja?«, fragt er langsam und wendet sich zurück. »Hallo, Mrs Sherburn …«
Er studiert die Linien ihres Gesichtes. Er entdeckt keine Falte und muss feststellen, dass sie eher noch schöner geworden ist. Sie schlägt jetzt den Schleier zurück, ihre Augen funkeln einmal, aber dann erlischt dieses Funkeln.
»Mr Joslyn, Sie leiten das Treiben der Sichel-Ranch und der anderen kleinen Leute, hörte ich? Ich muss mit Ihnen reden, Joslyn, die Sache ist wichtig.«
»Ich wüsste nicht – nun gut, Madam.«
Ich werde sie fragen, denkt Trevor, ich werde sie fragen, warum sie gekommen ist, warum sie ihre Pferde gejagt hat und warum sie Angst hatte …? Angst um mich. Wie kühl sie ist, wie ausgefüllt von ihrer Rolle als Frau des reichsten Mannes in dieser Gegend. Nun gut …
»Tonio, wartet auf mich, es wird nicht lange dauern«, sagt er über die Schulter hinweg und geht los, tritt neben den Wagen und bindet die Pferde an den Balken, aus dem das Stück Holz fehlt. Dann geht er zurück neben den Bock und streckt die Hand aus. Die Leute sehen zu. Er hat einen Augenblick die Furcht, dass sich Mary Anne durch irgendeine Bewegung verraten könnte, aber sie bleibt ganz die stolze, hochmütige Besitzerin der größten Ranch in diesem Gebiet. Sie stützt sich nur leicht auf seinen Arm.
Ihr Kleid rauscht einmal, der Ring an ihrem Finger funkelt sogar durch das Netzgewebe ihres Handschuhes. Dann ist Mary Anne Sherburn herabgekommen und geht einen halben Schritt vor ihm auf den Saloon zu.
»Hallo«, sagt sie leicht zu den Männern dort, die sie gaffend betrachten. »Hallo, Hardin – Dutch.«
»Hallo …, Madam!«
Früher haben sie einfach Mary Anne zu ihr gesagt, jetzt wirken sie betreten, irgendwie zurückhaltend, alle jene Männer, die einmal bei ihr am Tresen gestanden haben. Sie ist die Frau des reichsten Mannes dieser Gegend. Die Schranke ist da, aber wahrscheinlich hat sie diese Schranke selbst errichtet. Trevor hat genug davon gehört. Sie kommt selten in diese Stadt und hat den Saloon hier nie wieder betreten.
Schon ist sie durch die Tür, die Marlow, der derzeitige Pächter, vor ihr aufreißt. Nicht einmal dann, als sie den Saloon verpachtete, ist sie in ihre alte Umgebung zurückgekehrt.
»Mr Marlow, ich brauche einen Raum, in dem ich ungestört mit Mr Joslyn reden kann«, sagt Mary Anne Sherburn herrisch und kühl. »Nun?«
»Sofort, Madam. Am besten – oben, das eine Zimmer – es steht noch so, wie Sie es gewollt haben. Ich …«
Gene Marlow stottert, hastet vor ihr her und reißt die Tür zum Gang auf. Die Männer starren Mary Anne Sherburn nach, als sähen sie eine Fremde, deren Erscheinung etwas Unwirkliches an sich hat. Und Trevor, der diese Blicke auffängt, erkennt noch eine Kleinigkeit mehr.
Alle diese Männer fragen sich jetzt, was Mary Anne von ihm will – und wissen die Antwort: Trevor treibt für die kleinen Leute, die von Adam Sherburn über die Schulter angesehen werden. Sherburn hat vor mehr als drei Wochen bei Trevor angefragt und eine Absage bekommen, um Slim Dorlanay einzustellen. Was wird jetzt? Versucht Mary Anne etwa, im Auftrag von Sherburn Trevor Joslyn zu kaufen? Will sie ihn davon abbringen, für die kleinen Leute zu treiben?
Nichts davon, denkt Trevor, gar nichts in dieser Richtung. Sie hat nicht umsonst ihre Pferde so gejagt, sie hat erwartet, mich tot vorzufinden, aber ich lebe noch.
Wer weiß, was sie Adam erzählen wird, Adam, bei dem ich einmal Vormann gewesen bin.
»Ich finde den Weg allein, Marlow«, sagt Anne da vor ihm. »Den Schlüssel …«
»Hier, hier, Madam!«
Marlow hastet zum Schlüsselbrett und nimmt den Schlüssel herunter, reicht ihn Mary Anne. Sie nimmt ihn, nickt kühl und geht dann die Treppe hoch. Ihre linke Hand hebt den Rock etwas an.
Verrückt, denkt Trevor, einfach verrückt ist das.
Dann sind sie oben. Sie geht zielsicher auf das letzte Zimmer hinten links im Flur zu, steckt den Schlüssel in das Schloss und dreht ihn um.
Erst dann sieht sie sich um und tritt ein, als sie Trevors erstaunten und ungläubigen Blick bemerkt. Dies ist ihr altes kleines Zimmer, die Uhr steht auf dem Sims, sie tickt. Die Sessel stehen noch so wie damals vor vier Jahren. Drüben liegen die Kissen noch auf dem Sofa. Kein Staub, nichts, das verrät, dass hier seit vier Jahren nie ein Mensch gewesen ist.
»Mach die Tür zu.«
»Ja«, sagt Trevor heiser. »Mach die Tür zu – von außen. Das hast du gesagt, vor vier Jahren. Erinnerst du dich? Der letzte Abend, die letzte Stunde …«
Sie tritt an das Fenster, hört das Schließen der Tür und zerknüllt ihren rechten Handschuh zwischen den Fingern.
»Du bist also zurückgekommen.«
»Ja, eines Tages muss man vergessen lernen.«
»Du lügst, Trevor, du hast nichts vergessen. Dieses Zimmer hier ist noch so wie damals. Sie sagen, dass ich nicht hier gewesen bin. Aber es ist nicht wahr. Ich bin oft den gleichen Weg gegangen, den du damals gekommen bist, heimlich, als wäre dies nicht mein Haus. Ich habe nichts vergessen können – nichts!«
»Jemand beginnt mir leidzutun, Lady.«
»Ich? Ich würde dir nicht leidtun, niemals. Du hasst mich, aber du hängst an mir, wie? Gib es zu, Trevor.«
»Ich hänge nicht an dir. Es gibt noch andere Frauen auf dieser Welt, andere, die genauso lachen, genauso scherzen und spielen können. In Mexiko …«
»Hör auf, Trevor, hör auf.«
Sie dreht sich jäh um und sieht ihn voll an. Der Zorn ist in ihren Augen und auch Gekränktsein. So ist sie immer gewesen. Sie hat immer geglaubt, dass niemand ihr etwas wegnehmen und sie alles haben könnte, was sie sich wünschte.
»Du kannst hundert dieser Ladys besessen haben, aber an mich hast du gedacht, Trevor.«
»Du irrst dich, Anne. Du irrst dich genauso wie vorhin. Ich lebe noch, ich bin nicht tot. Dieser Bursche hat es nicht geschafft.«
»Ich hörte die Schüsse und – Trevor, du bist älter geworden, männlicher und größer. Wenn ich hier gesessen habe, dann habe ich an dich gedacht, dann ist es mir gewesen, als wärest du durch das Zimmer gegangen. Und machte ich die Augen auf, dann war ich doch allein. Trevor …«
Sie kommt schnell auf ihn zu und fasst ihn an beiden Oberarmen. Er steht still, sieht sie an und lächelt sanft und nachsichtig.
»Woher hast du gewusst, dass Charlie auf mich warten würde, Anne?«
Sie zuckt zusammen, ihr Griff an seinen Armen verstärkt sich eine Sekunde.
»Ich habe …«
»Du brauchst nicht zu schweigen, ich weiß, dass du Bescheid gewusst hast. Also, wie hast du es erfahren?«
»Slim hat mit Adam gesprochen, Trevor«, erwidert sie und senkt den Blick. »Ich habe oben auf der Balustrade gesessen und zugehört. Sie hatten keine Ahnung von mir.«
»Also Adam …! Das hätte ich nicht gedacht.«
»Du irrst dich, Adam hat nichts damit zu tun«, sagt sie hastig. »Er hat unten mit Slim Dorlanay über den Trail gesprochen und natürlich auch über dich. Slim hat gelacht und gesagt, du würdest nie auf den Trail gehen, weil auf dich jemand in der Stadt wartet. Adam ist genauso erschrocken gewesen wie ich und hat beinahe geflucht, doch Slim hat gemeint, es würde keinen anderen Weg geben, um dich aufzuhalten.«
»Und Adam ist damit zufrieden gewesen, wie?«
»Nein, nein, zum Teufel. Er hat ausdrücklich gesagt, dass er schmutzige Dinge nicht mitmacht, aber ändern …«
»Natürlich, ändern hat er nichts mehr können. Und außerdem hat er sein Geld gesehen, wie? Ich kenne Adam doch, mir brauchst du nichts über ihn zu sagen. Geht es um sein verdammtes Geld, dann geht er auch über Leichen. Du bist losgefahren, um mich zu warnen?«
Einen Augenblick schweigt sie, dann sagt sie stockend: »Ich – ich wollte nicht kommen. Du bist lange genug hier und hast nicht einmal einen Besuch auf der Ranch gemacht, von der du damals weggegangen bist, Trevor! Ich bin zu stolz gewesen, um zu kommen, zu dir zu kommen, Trevor, aber unter diesen Umständen …«
»Was gewesen ist, das ist längst vorbei, Anne. Es hilft nichts, sich ein Zimmer aufzuheben, die Erinnerungen zu beschwören, denn sie kommen niemals wieder. Danke dafür, dass du mich warnen wolltest, aber ich bin noch immer allein mit meinen Dingen fertiggeworden, auch hier. Anne, ich habe einmal geglaubt, dass diese Welt sterben müsste, aber sie ist nicht gestorben. Kein Weg zurück!«
»Du hast mich nicht vergessen können, Trevor. Sage, dass du immer an mich gedacht hast. Trevor – sieh mich an, bin ich hässlich? Trevor, niemand wird von uns wissen, wenn …«
Sie kommt plötzlich in seine Arme und klammert sich an ihm fest.
»Du bist verheiratet«, sagt er bitter und macht sich mit einem Ruck los. »Hast du immer noch nicht gelernt, dass man nicht alles bekommen kann? Du hast mich einmal fortgeschickt. Ich bin gegangen und jetzt wiedergekommen, aber nicht zu dir! Da sind einige Leute, die mich nicht vergessen haben, die mich brauchen. Alles, was du bereust, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Man heiratet nicht einen wandelnden Geldsack, wenn man anständig genug ist. Gib es auf, Anne.«
»Trevor, du belügst uns beide, du denkst wie ich, du fühlst wie ich. Adam ist ein großer Mann, aber ihn lieben? Trevor, lass es so wie früher sein.«
Sie kommt wieder auf ihn zu, fasst nach seinem Arm und lehnt sich an ihn. Er steht steif und starr vor ihr, den Blick nach dem Fenster gerichtet und weiß es jetzt genau: Sie hat alles haben wollen und nichts gefunden, was sie innerlich zufriedenstellen konnte.
Vielleicht liebt sie ihn wirklich, doch wenn sie denkt, dass sie ihn noch einmal heranpfeifen kann, nachdem sie ihn wie einen Hund weggeschickt hat …
»Schon gut, Anne«, sagt er leise. »Manchmal bist du mir wie ein verzogenes Kind vorgekommen, verspielt, störrisch und eigensinnig. Tut mir leid für dich, Anne, aber es gibt wirklich keinen Weg mehr zwischen uns. Du bist Adams Frau geworden, nicht meine.«
»Er hat ein Dutzend Freundinnen, Trevor. Er kennt nur seine Geschäfte, weiter nichts. Ich bin für ihn nur ein Schaustück. Trevor, ich will ihn genauso betrü…«
»Was ist das?«, fragt Trevor Joslyn zischend und wendet sich jäh um. »Da – an der Tür.«
»Nichts. Was soll sein, Trevor? Du könntest alles haben, wenn du willst. Trevor, ich habe dich nie vergessen und …«
In diesem Augenblick reißt jemand die Tür auf und stürmt mit einem Satz in den Raum.
Der Mann ist groß, breitschultrig und blondhaarig. Ein großer gewichtiger Mann, dessen helle Augen mit einem furchterregenden Ausdruck zuerst auf Mary Anne gerichtet sind.
Der Mann ist kreidebleich und sieht Annes Hand langsam von Trevor Joslyns Arm abgleiten. In der nächsten Sekunde ballt der Mann beide Fäuste, kommt dann keuchend herum und wirft die Tür mit einem wilden Ruck ins Schloss.
»Das also«, sagt Adam Sherburn mit einer Stimme, die wie zerborsten klingt. »Das also ist es gewesen. Habe ich es doch die ganzen Jahre geahnt, habe ich es doch geträumt und vor mir gesehen. Sie fährt weg, sie hat es auf einmal so eilig. Ah, so ist das. Und ich Narr, ich denke die ganzen Jahre – ich denke, dass sie in mir etwas anderes sehen wird als nur den Mann mit dem dicken Geldsack. Hierher ist sie gefahren, zu diesem dreckigen kleinen Viehtreiber, der …«
Er keucht einmal scharf, dann macht er den nächsten Satz und holt in wildester Wut aus.
»Adam, du irrst …«
Weiter kommt Trevor nicht, denn Adam schlägt voll blinder Wut zu. Ein schwerer langsam kommender Hieb, der einen Ochsen umwerfen könnte, würde er ihn treffen?
Trevor duckt sich jäh, wirbelt zur Seite herum und taucht unter der heranschießenden Faust weg.
Der Hieb verfehlt ihn, die Wucht des fehlgehenden Schlages reißt Adam Sherburn nach vorn und lässt ihn durch das Zimmer bis an die Wand taumeln. Dort dreht sich Adam mit fast irrer Wut in den Augen um, erblickt den leichten Stuhl an der Wand und reißt ihn mit einem Ruck über seinen Kopf.
»Ich bringe dich um, du Schuft«, faucht er gurgelnd und kaum noch verständlich. »Ich bringe dich …«
Er stürmt wie ein Rasender auf Trevor zu, schlägt den Stuhl herunter und mitten über den Rücken von Trevor, der sich abduckt.
»Du Narr«, sagt Trevor bitter »Ich habe dich nie betrogen und werde es nicht schlucken, von dir verdächtigt zu werden. Adam – tut mir leid!«
Er fängt den Anprall des zerbrechenden Stuhles auf, holt dann links aus und setzt den ersten Hieb an. Er hört irgendwo links Anne heiser und schreckhaft japsen, aber jetzt wird auch er wütend und keilt noch einmal aus. Diesmal trifft er den zurücktaumelnden Adam Sherburn voll. Adam dreht sich ächzend nach links, Trevor taucht herum und schlägt zum dritten Mal zu.
Nach diesem Konter geht Adam Sherburn mit leeren Blicken zwei Schritte zurück, stürzt dann rücklings über das Sofa und bleibt reglos auf ihm liegen.
Er bewegt sich aber gleich wieder, ein Mann, den man mit einem Hammer niederschlagen muss, wollte man ihn zu Boden bringen.
Anne Sherburn sagt keinen Ton. Sie steht nur mit hochgerissenen und vor den Mund gepressten Händen am Tisch und sieht furchtsam auf Adam und Trevor.
Trevor macht zwei schnelle Schritte nach vorn, bleibt dann vor dem Sofa stehen und zieht seinen Revolver unter der Jacke heraus. Er macht es keine Sekunde zu spät, denn Adam Sherburn greift nach seiner Hüfte, schüttelt wild den Kopf und wird dann erst steif.
»Adam«, sagt Trevor Joslyn düster. »Ich möchte dich wahrhaftig nicht umbringen müssen. Liege besser still und werde wieder normal. Du verdammter Idiot bist selbst daran schuld, wenn deine Frau von ihren Erinnerungen nicht loskommt. Das wirst du endlich begreifen müssen. Hörst du jetzt zu, oder soll ich dir den nötigen Verstand langsam in deinen verrückten Kopf hämmern? Adam, bist du jetzt friedlich?«
Adam Sherburn rutscht ein Stück höher, legt die Hand auf die Sofalehne, anstatt sie am Revolver zu halten und sagt gallenbitter und finster: »Dafür stirbst du, das verspreche ich dir! Hast du ein Glück, das ich etwas ahnte und meine Leute unten gelassen habe, hast du ein Glück! Darum dieses Zimmer, darum dieser ganze verfluchte Bau, von dem sie nie losgekommen ist. Ich Narr – ich Narr, ich werde euch alle beide …«
»Du wirst gar nichts, höchstens anfangen, dich zu schämen, Adam«, unterbricht ihn Trevor eisig. »Du musstest das schönste Mädel aus dieser Ecke einfach haben, aber danach hast du dich nicht mehr viel um sie gekümmert, du Narr. Du hast dein Leben weitergelebt wie vorher und dich den Teufel um die Gedanken dieser Frau gekümmert. Deine Geschäfte, Adam, sie sind dir wichtiger gewesen als deine Frau. Dafür bezahlst du jetzt, mein Freund. Eine Frau, die nur dem Namen nach einen Mann besitzt, wird sich in die Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit flüchten müssen, weil sie keine Zukunft sehen kann. Du Narr, jetzt hast du es. Ich hoffe nur, du bist schlau genug, um es einsehen zu können.«
»Ich habe mich nicht … Mensch, du Hungerleider, wie redest du mit mir? Hat sie nicht alles besessen, was eine Frau nur haben kann? Fehlt ihr etwas, he?«
»Ein Mann, Adam – du! Sie hat sich in ihre Erinnerungen geflüchtet, sie hat sich eingebildet, dass irgendwer sie braucht und einer sie nicht vergessen kann, sie nicht als ein Stück Sache behandelt – ich! Weißt du, dass sie Liebe braucht, Adam? Und was hast du ihr gegeben? So wenig, dass sie träumen musste. Dazu hast du sie auch noch betrogen.«
»Mensch, ich bringe dich um, ich schicke dir so viel Ärger an den Hals, dass du deines Lebens nicht mehr froh wirst! Wie redest du denn mit mir? Sie hat sich dir an den Hals werfen wollen – dir, einem Habenichts! Das verstehe ich nicht – nicht zu fassen!«
»Du kannst es nicht verstehen, das weiß ich, aber du wirst es verstehen müssen, Adam. Du hast sie nur enttäuscht. Da hat sie noch einen Zipfel von ihren – alten Träumen erwischen wollen. Mach nur so weiter, eines Tages läuft sie dir davon. Dann werden die Leute über dich lachen und mit Fingern auf dich zeigen. Sie braucht jemanden, der sie versteht, mit dem sie reden kann. Nicht über Geschäfte, Rinder, Preise und deinen ganzen anderen Tagesunsinn. Einen Mann braucht sie, keine Rechenmaschine. Sie wird dir weglaufen, Adam – weglaufen!«
»Was – was? Weglaufen – mir? Bist du irr? Anne, du wirst mir doch nicht weglaufen wollen? Anne …«
»Doch, genau das werde ich! Liebe deine Zahlen weiter, vielleicht wirst du mit ihnen glücklicher. Du verdammter Narr, ich habe dich vom Fenster aus kommen sehen. Komm her und sieh auf die Straße, dann kannst du dein Pferd sehen. Ich werde weglaufen – ich werde …«
»Du hast mich kommen sehen? Dann hast du nur so getan, als wenn …«
»Ich habe nicht so getan. Ich werde mit dem erstbesten Mann weglaufen, Adam. Hörst du, ich werde auf dein ganzes Geld pfeifen und …«
»Anne, das darfst du nicht, du kannst mich doch nicht allein lassen! Du kannst mich doch nicht … Ich liebe dich doch!«
Großer Gott, denkt Trevor bestürzt, sie muss ihn wirklich gesehen haben. Und dann hat sie so laut gesprochen, dass er es hören musste, hat gemeint, da draußen sei nichts, als ich etwas hörte.
Sie bekommt immer noch alles, was sie haben will, sie versteht es immer noch! Ich bin beinahe auf ihr prächtiges Spiel hereingefallen! Ganz sicher hat sie mich warnen wollen, weil sie irgendwie doch an der alten Zeit hängt, aber es ist wirklich nur eine ihrer verträumten Spielereien gewesen, das mit dem Zimmer hier. Weiter aber auch nichts, denn sie würde niemals so verrückt sein, ihren reichen Burschen Adam sausen zu lassen. Nun gut, was kann es ihr schon tun, dass Adam nun etwas von der Zeit vor seiner Ehe mit ihr weiß? Es wird ihn nur eifersüchtig machen können, gerade das, was sie braucht, um ihm seine Streiche abzugewöhnen. Dieses gerissene kleine Biest!
»Adam, ich werde weggehen, heute noch!«
»Nein, nein, ich lasse es nicht zu. Ich werde dich lieber umbringen, als dass ich dich gehen lasse! Anne …«
»Da hast du ihn«, sagt Trevor Joslyn bitter und sieht Anne grimmig an. »Du hast ihn wirklich, mein Kompliment, Lady. Und du, du Narr, Adam, du kannst froh sein. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich wirklich etwas aus dir machen würde. Streitet euch weiter, aber ohne mich!«
Er dreht sich um und geht auf die Tür zu. Und er hört Adam hinter sich keuchend sagen: »Wir sprechen uns noch. Ich lasse dich auf den Mond jagen, du Habenichts – auf den Mond! Geh, geh schnell, ehe ich es dir gleich besorge!«
»Pass auf, dass du keinen Fehler machst«, erwidert Trevor kühl. »Adam, ich werde auch mit dir fertig, das weißt du nur zu genau. Fang nichts an, was dir eines Tages leidtun könnte. Das ist eine Warnung, mein Freund. Ich sage sie dir nur einmal! Viel Spaß, Mister.«
Und damit geht er hinaus und über die Treppen nach unten. Er weiß in dieser Minute, dass er nie mit Anne glücklich gewesen wäre. Und es ist wie eine Erleichterung für ihn. Der letzte Rest jenes alten Gefühls für sie ist verschwunden. Die Erinnerung wird von dieser Minute an sterben und zur Bedeutungslosigkeit absinken.
Er geht durch den Saloon, sieht die erstaunten Blicke der Männer und sagt kein Wort, ehe er nicht draußen bei seinen Männern ist. Einige der Reiter, die mit Adam gekommen und unter ihm geritten sind, als er noch Vormann auf der Sherburn-Ranch gewesen ist, nicken ihm zu. Er nickt genauso freundlich zurück, steigt dann auf sein Pferd und nimmt es herum.
»Wir reiten. Fahr an, Saguaro«, sagt er sanft wie immer. »Hallo – Jungens!«
Das gilt den alten Partnern der Sherburn-Ranch und der Gruppe um McLaine und Dutch.
Er schweigt sich aus und blickt sich nicht mehr um, als sie aus der Stadt kommen.
*
Es ist Saguaro, der stillschweigend von hinten kommt und ein Pferd an der Longe hinter sich führt.
Saguaro sieht mit seinem vor den Mund gezogenen Halstuch und dem alten Armeehut mit der einen Feder hinter am Band wie ein verkappter Bandit aus. Der Staub bedeckt ihn, der Schweiß hat tiefe Furchen in sein Gesicht geschnitten, das vom Staub überzogen ist.
»Boss«, sagt der Indianer kehlig. »Boss, du jetzt nimmst besser frisches Pferd, Slim-Schuft ist dort?«
Er fragt mit einem kleinen boshaften Unterton. Einen Augenblick fragt Trevor sich, ob Saguaro James Dicknase immer noch nicht vergessen hat. Es sieht beinahe so aus, obwohl seit dem Kampf vierzehn Tage vergangen sind und sie mit der Herde kurz vor dem Red River stehen.
Trevor Joslyn hat dreißig Männer außer dem Koch, der mit seinem Wagen Meilen voraus ist und sicher schon das Abendessen fertig haben wird, wenn sie endlich an den Duck Creek kommen.
Vierzehn Tage, denkt Trevor. Und nichts passiert. Zweimal sind die Rinder durchgedreht, aber die Boys sind in Ordnung und haben sie halten können. Geregnet hat es auch noch nicht, Wasser ist wenig da, aber die verdammte Sonne, sie macht uns schwer zu schaffen.
Er wendet sich um. Saguaro zieht sein Halstuch herunter und spuckt einige Staubkörner aus. Der Indianer blickt nach Westen, aber sehen kann man nichts von Adam Sherburns Siebentausend-Kopf-Herde, die dort nach dem Red River zieht.
»Macht er wieder Wettlauf, Slim-Schurke, Boss?«
Saguaro redet nie anders als auf diese Art von Slim Dorlanay. Er nennt ihn Schuft oder Schurke, und er spuckt oft verächtlich aus, sobald er seinen Namen nennt.
»Er wird versuchen, zuerst am Red River zu sein, Saguaro«, sagt Trevor langsam und steigt auf das bereits gesattelte Pferd über. »Kein Wettrennen, ich glaube das nicht. Wir sind die ersten beiden Herden, die über den Trail gehen. Er hat es nicht nötig, seine Herde zu jagen, aber scharf treibt er sie – wie immer.«
»Er am Ende zwei Tage Vorsprung, bekommt besser Geld für seine Herde, Boss. Vielleicht machen schneller wir, he?«
»Ihr denkt alle zu verrückt, Saguaro, ich treibe nicht schneller.«
Trevor lächelt leicht. Der Indianer zwinkert mit den Augen und grinst auch.
»Du hast Trick in Ärmel, ich wette. Zwei Männer Feinde, jeder beweisen, dass er ist besser wie anderer. Du zuerst da, ich weiß!«
»Du bist verrückt, der Kerl ist mir vollkommen gleichgültig. Soll er doch zuerst da sein!«
Saguaro starrt ihn an, grinst nicht mehr und fragt erstaunt: »Du lässt gewinnen Slim-Schuft?«
»Ja! Wenn es so sein soll!«
»Freiwillig schlagen lassen?«
»Warum nicht? Soll er doch schneller treiben, er hat sicher den verrückten Ehrgeiz und wird seine Stiere wie immer mager haben, ehe er in Sedalia ist. Zerbrich dir nicht deinen Kopf über das, was ich tue, Saguaro. Ab morgen sind wir im Indianerland, dann geht es vielleicht nicht mehr so einfach mit dem Trail vorwärts.«
Der Indianer schüttelt den Kopf. Das sagt eigentlich alles. Er spricht den Dialekt der Choctaws, durch deren Gebiet sie müssen. Er hat keine Angst vor seinen roten Brüdern.
Sie haben alle gegessen, liegen oder hocken an den Feuern, rauchen, würfeln hier und da und hören sonst dem leisen Banjospiel von Bustamente zu.
»Dreimal – dreimal sechs Augen – sieh her, Jacco«, sagt einer der Mexikaner, die an der Herde treiben. »Da hast du achtzehn Augen. Wirst noch deinen letzten Hosenknopf verlieren, wenn du …«
Er bricht plötzlich ab, seine Hand zittert heftig, der Becher fällt auf die Satteltasche, die sie als Würfeltisch benutzen.
Es passiert ganz plötzlich und geht so schnell, dass es kaum einer von ihnen begreift.
Ramon, der Mexikaner, verliert den Becher, krümmt sich zusammen und wird kreidebleich. Auf seiner Stirn erscheinen dicht bei dicht dicke Schweißtropfen. Er presst beide Hände vor den Magen, dann sieht er aus hervortretenden Augen die anderen an und rollt auf die Seite.
Seine Beine bewegen sich, er tritt aus und röchelt schrecklich.
»Ramon! Ramon …«, sagt Jacco, sein Mitspieler, entsetzt. »He, Ramon, was hast du? Was ist? Eine Schlange – eine Schlange hat ihn gebissen!«
Seine heiseren erschreckten Rufe jagen sämtliche Männer hoch. Messer fliegen aus den Scheiden. Zwei, drei der Männer reißen Äste aus dem Feuer und leuchten augenblicklich den Boden ab.
»Vorsicht«, sagt Trevor scharf, der jäh von der anderen Seite des Wagens heranläuft. »Vorsicht, passt auf. Wenn das eine Schlange ist, dann steckt sie sicher unter den Decken. Schlangen haben es gern warm. Die Decke hoch, auf der Ramon gesessen hat, schnell! Saguaro …, Saguaro komm schnell her, Ramon muss von einer Schlange gebissen worden – Jack, was ist mit dir los? Jack …«
»Mein Magen – mein Magen«, keucht Jack Calhoun, einer der Männer aus seiner Stammmannschaft. »Trevor – mein Magen! Großer Gott …«
Er, der wie alle anderen aufgesprungen ist und einen brennenden Ast in der Hand hält, krümmt sich jäh zusammen. Er torkelt wie betrunken drei Schritte weiter, geht dann in die Knie und fällt um. Er rollt auf die Seite, stöhnt und würgt. Auf seiner Stirn steht der Schweiß in dicken Perlen, es ist nicht anders als auch bei Ramon. Jetzt tritt auch er schon mit den Füßen aus, dann beginnt er im Verein mit Ramon heiser zu schnaufen und sieht Trevor aus hervortretenden Augen Hilfe suchend an.
»Mein Gott – mein Gott, ich bin vergiftet«, schreit in diesem Augenblick einer der neuen Männer auf und wankt auf den Wagen zu. »Ich bin vergiftet! Helft mir – helft mir, ich kann nicht mehr gehen – ich ersticke – ich ersticke!«
Von hinten rennt Saguaro jäh heran, reißt den Mann an seiner Schulter hoch, blickt ihm ins Gesicht und greift zu seinem Messer.
Gleich darauf steckt er dem vor Frost und Furcht zitternden Mann sein Messerheft weit in den Hals hinein.
Der Mann krümmt sich zusammen, erbricht sich und bleibt danach wie tot am Boden liegen.
In diesen wenigen Augenblicken stürzen an der Herde drei, vier Männer unter wildem Stöhnen aus den Sätteln, liegen im Gras und können nicht einmal um Hilfe brüllen.
An den Feuern bricht mit einem Schlag die Panik aus. Männer lauschen buchstäblich in sich hinein, sehen sich an und haben plötzlich die nackte Furcht in den Augen.
Vergiftet – vergiftet!
Jeder denkt es, jeder stiert den anderen mit der gleichen erwartungsvollen Furcht an. Und dann krümmt sich hier einer zusammen, dort ein anderer. Sie torkeln über den Boden, fallen hin und sehen Saguaro kommen.
Trevor fühlt urplötzlich ein ziehendes, lähmendes Gefühl im Magen, er reißt den Mund auf, sieht Saguaro kommen und hört ihn schreien: »Steckt euch Finger in den Mund, damit ihr erbrechen könnt. Erbrecht euch – schnell. Das müssen heraus. Ich wissen schon, was ist – keine Angst, ihr nicht kaputt. Hör auf zu schreien, Larry, hör auf, Idiot. Das Gift …, Gift von Schlange und Cholla…, schnell, herausbrechen, schnell! Ich einmal gebissen von Klapperschlange …, mir nichts tun, schnell, Boss, ausbrechen alles, was gegessen … Schnell!
Jetzt hast du, Boss, jetzt hast du! Schlagen tot Schlangen, ehe sie beißen können, das sagen Indianer. Jetzt hast du. Teufel Slim-Schuft alle vergiften lassen. Drei Männer, ich gesagt, drei Männer nicht gut. Slim-Schuft sie geschickt. Der Teufel alle vergiften. Das sein Arbeit von Slim-Schurke, du merken? Jetzt du wissen, warum er treiben schnell, he?«
Trevor ist es, als wollte sein Magen herausquellen. Und während er in einer Art von Bewusstseinsstörung seinen Geist aufzugeben droht, bleibt ihm doch der Satz im Gedächtnis: »Jetzt du wissen, warum er treiben schnell, eh?«
*
Es wirft ihn beinahe wieder zu Boden. Der Anfall kommt und lässt ihn rennen. Schweiß bricht ihm aus allen Poren. Dabei jagt ein Frostschauer nach dem anderen über seine Haut. Sie haben samt und sonders Brechdurchfall und rennen hinter die Büsche, kaum dass sie mit Mühe und Not die Feuer wieder erreicht haben.
Aber sie können reden und laufen, obwohl ihnen hundeelend ist und die Sache keine zwei Stunden hinter ihnen liegt.
Wenn sie reden, dann nicht im üblichen Sinne, sie fluchen alle.
Selbst der ruhige und durch nichts zu erschütternde Wes Turner, der nun, mit Trevor von den Büschen kommend zum Wagen zurückwankt, flucht fürchterlich. Ihnen zittern alle die Knie, sie sind nicht fähig, die Herde zu bewachen, obwohl sie es immer wieder versuchen. Die einzige Möglichkeit ist noch, dass sie sich ihren Platz an der Herde auswählen, dicht an den Tieren bleiben und singen und grölen, solang sie die Pause zwischen den Anfällen genießen können. Im Sattel zu sitzen, das ist unmöglich. Sie sind beinahe schlagartig alle so schwach geworden, dass sie kaum stehen und gehen, geschweige denn die Kraft aufbringen können, sich in die Sättel zu ziehen.
»Wes, das bleibt vielleicht nicht die letzte Teufelei. Saguaro hat gemeint, wir hätten eine ganze Woche damit festliegen können – die liegen wir fest, wenn er keine Medizin bringt. Nun, zum Henker, dieser Schuft Slim wird noch mehr anstellen, wenn wir zu schnell nachkommen. Pass du hier ein wenig auf – wenn jetzt einer an die Herde geht, dann …«
Sie sehen sich nur an und wissen es beide. Geht jetzt jemand an die Herde, kommen Viehdiebe oder jagen plötzlich einige Reiter wild schießend vorbei, dann bräche eine Panik unter den Rindern aus, die eine Katastrophe bedeuten würde.
Die Mannschaft ist nicht in der Lage zu kämpfen, oder eine durchgehende Herde aufzuhalten.
»Das wäre«, sagt Wes abgehackt, »das wäre das Ende der Teufelei, was? Schießen kann ich noch, aber reiten …, nicht mehr. Versuch, ob du in den Sattel kommen kannst.«
Trevor torkelt los, kommt schwankend zum Seilcorral und sieht das gesattelte Pferd des Jungen dicht neben dem fest zugedeckten und frierenden Jesse stehen.
»Na, Junge, schöne Geschichte, was? Ich nehme mal deinen Gaul, muss versuchen, in den Sattel zu kommen. Geht es dir ein wenig besser?«
»Ja«, erwidert Jesse Tyler und klappert leise mit den Zähnen. »Boss, es geht schon wieder.«
Trevor zieht das Pferd herum, beugt sich vor und klinkt den Sperrhaken des Corrals aus.
Er nickt dem Jungen zu und reitet an. Niemand, der ihn sieht, erkennt etwas von dem, was an Gedanken durch seinen Kopf geht. Er reitet an den ersten seiner Männer vorbei, er sieht einige der neuen Männer, die er eingestellt hat, gute Reiter, die ihre Pflicht getan haben. Beinahe vergisst Trevor, dass er schwach und ziemlich elend ist.
Er denkt an das Gift und daran, dass er morgen früh ein Experiment machen wird. Eines der Mavericks soll morgen früh eine Ladung Zucker fressen. Ein Stier würde vielleicht eine Ladung Giftzucker verdauen, ein Maverick wird das nie verkraften können, ohne die gleichen Erscheinungen zu zeigen wie ein Mensch.
Es wird niemand dabei sein, der dieses Experiment sehen kann, niemand, der eine Ahnung von dem Versuch hat.
Vielleicht, denkt Trevor Joslyn voller Furcht und halber Wut, vielleicht wird nicht nur das Maverick den Zucker fressen …, vielleicht auch ich, was? Und bleibe ich gesund, dann weiß ich einige Dinge mehr, als für jemanden gesund sein wird.
Er schließt einen Moment die Augen und beißt heftig die Zähne aufeinander.
Was ist, wenn keiner der drei Männer, die in das gestrige Camp gekommen waren, etwas mit dem Gift zu tun haben?
Was ist, wenn jemand nur die Anwesenheit von drei Männern ausgenutzt hat, um selbst unerkannt zu bleiben?
Dann, denkt Trevor Joslyn, dann habe ich einen Mann in meiner Mannschaft, der seine Bezahlung nicht von mir, sondern von Slim Dorlanay bekommen hat.
Dann habe ich …
Er zaudert selbst vor dem Gedanken, er weigert sich einfach zu glauben, dass unter seinen Männern einer sein soll, der kaltblütig die anderen vergiftet – und sich selbst mit.
Oder doch nicht sich selbst?
Kann es nicht sein, dass einer unter ihnen ist, der nur schauspielert, der nur so tut, als hätte auch er von dem Gift genommen? Wenn er dieses Zeug wirklich in den schon ohnehin starken und bitteren Kaffee geschüttet hat, muss er den Kaffee dann unbedingt getrunken haben?
Muss er nicht!
Eine Handbewegung – Kaffee rinnt aus dem Becher in das dürre Gras.
Und ein dreimal verdammter Schuft wälzt sich wie die anderen auf dem Boden, rennt wie die anderen hinter die Büsche, tut so, als hätte er sich erbrochen und spielt alles mit, um unentdeckt zu bleiben!
Der Gedanke ist schrecklich, aber er ist da und lässt Trevor nicht mehr los.
Er macht seine Runde um die Herde, muss zweimal aus dem Sattel und kommt doch immer wieder hinein. Er ist hart genug, um sich zu zwingen, hart genug, um härter zu sein als die anderen.
Er weiß mit plötzlicher Sicherheit, dass einer unter seinen Männern ein schmutziger Vergifter ist. – Doch wer ist es?
Trevor Joslyn ist sicher, einen Verräter in der Mannschaft zu haben.
Und Verräter – Verräter erschießt man.
Dies ist die Aussicht für den nächsten Tag: Er muss den Verräter finden, ehe noch mehr passiert.
Er hat ihn zu finden.
*
Saguaro kauert auf dem Küchenwagen und verabreicht die dritte Ladung Tee an jeden Mann der Mannschaft. Es ist neun Uhr früh. Der Tag ist mit einem rostroten Himmel gekommen, der die Männer weit um die Herde verstreut gesehen hat. Sie haben auf Trevor Joslyns Anweisung hin die Gewehre mitgenommen und einen Ring um die Herde gebildet. Männer, die immer wieder von den Anfällen des Brechdurchfalles heimgesucht werden und doch wenigstens auf ihren Posten sind, bereit, jeden Gegner mit Kugeln zu empfangen.
Einigen geht es um diese Zeit schon besser, der Tee – ein fürchterlich bitteres Zeug, von dem Saguaro behauptet, dass es pulverisierte Galle enthält schmeckt widerlich, aber sie trinken. Die Stimmung aber ist auf den Nullpunkt gesunken. Zwar äußert sich diese gereizte, beinahe bösartige Stimmung nicht bei den alten Partnern Joslyns, aber bei den anderen sechzehn Mann ist sie deutlich spürbar. Die Männer fluchen nur noch, wenn sie jetzt auch reiten können. Aber sie haben kaum geschlafen, kaum gegessen, sie rauchen nur die dreifachen Tabakmengen als sonst. Hunger, Brechdurchfall und wenig Schlaf machen sie zu gereizten Löwen. Sie brüllen sich gegenseitig ohne jeden ersichtlichen Grund an und fluchen dauernd.
Trevor beobachtet sie kühl und wachsam. Er kann reiten. Wes Turner, genauso hart wie er, schafft es auch. Dann hält noch Saguaro die Augen auf. Und selbst dem Koch geht es besser.
Trevor sieht die Männer zum Wagen kommen, den heißen Tee schlürfen und beobachtet sie verstohlen.
Trevor aber zieht sich auf den Wagen, kauert sich neben Bill Lawson an die andere Seite der Sitzbank und sagt nach einem Blick in die Runde: »Passt ein wenig auf. Du auch, Tonia. Die Stimmung ist verdammt schlecht geworden. Das kann nur ein Anfang gewesen sein, das dicke Ende kann noch kommen. Ist das alles Holz, Bill?«
»Ja, Boss. Du meinst doch nicht, dass die Burschen weglaufen werden, was?«
»Verrückt wird man immer dann, wenn man nicht genug essen und schlafen kann. Passt also auf. Saguaro, du reitest nach links um die Herde. Tonio, du nach rechts. Eddy, was macht deine Wunde?«
»Alles in Ordnung, Trevor«, erwidert Swartz. »Nun gut, dann werden wir aufpassen. Und du?«
»Ich werde mal nach verlaufenen Rindern sehen. Sind genug in der einen Nacht weggekommen!«
Die Männer verschwinden. Er wartet, bis sie außer Sichtweite sind und greift dann nach dem Zuckersack.
»Wo willst du mit dem Sack hin, Boss?«, fragt Bill Lawson heiser. »Wenn du nichts von dem Kalb gesagt haben würdest, das den Zucker schlecken soll – ich hätte ihn schon weggeschüttet. Willst du …«
»Nun ja«, meint Joslyn, »aber halte den Mund.«
Bill nickt nur. Trevor klemmt sich den Sack unter den Arm, nimmt sein Pferd und reitet los.
Er tut so, als suche er die Spuren von verlaufenen Rindern, entdeckt gleich die Fährte eines Mavericks und reitet ihr nach. Nicht weit vom Camp entfernt, im Einschnitt des Baches, der sich hier durch den kiesigen Untergrund seinen Weg gebahnt hat, findet er das Kalb zwischen den Uferbüschen.
Das Maverick frisst das unter den Büschen wachsende Gras und will weglaufen, als er sich nähert.
Es dauert keine drei Minuten, dann hat Trevor es eingefangen, bringt es dicht an den Bachlauf und nimmt seinen Hut. Er füllt den Hut beinahe halb voll Zucker, schöpft dann Wasser und verrührt alles mit der Hand. Schließlich gibt er dem Maverick zu saufen. Das Tier säuft den Hut leer, grast dann friedlich weiter und blökt manchmal.
Es vergehen drei Minuten, zehn, zwanzig – nichts geschieht. Das Maverick frisst seelenruhig weiter, käut wider und glotzt Trevor aus seinen schwarzbraunen Augen manchmal dreist an.
»He, warum fällst du nicht um?«, fragt Trevor verstört. »Du müsstest doch schon längst umgefallen sein, glotzendes Ungeheuer? Nichts, gar nichts passiert. Warten wir noch fünf Minuten, vielleicht ….«
Aber es gibt kein Vielleicht. Das Maverick bleibt auf den Beinen. Es zeigt keinerlei Anzeichen einer Vergiftung.
»Alle Wetter«, brummt Trevor schließlich und stiert auf den halb geleerten Zuckerbeutel. »Das ist ja nicht zu glauben! Der Zucker kann es nur sein, denn von allem anderen hat Bill gekostet, nur von dem Kaffee nicht … Halt! Das Kaffeepulver!«
Er sitzt eine halbe Minute bestürzt am Boden, dann greift er entschlossen in den Beutel, nimmt sich eine Handvoll Zucker und steckt den Zucker in den Mund.
Er kaut, mahlt mit den Zähnen, bereit, den Zucker auszuspucken, sobald er einen bitteren Geschmack bemerkt. Aber es kommt kein bitterer Beigeschmack.
»Ich Narr«, sagt er schließlich heiser. »An den Kaffee hätte ich auch denken können. Also zurück.«
Er nimmt den fast leeren Sack, reitet zurück und nimmt das Maverick gleich mit. Allerdings lauscht er unterwegs manchmal den grummelnden und bullernden Geräuschen in seinem Bauch, doch stellt sich nichts von einer Vergiftung ein.
Er bringt das Maverick in die Herde zurück, reitet zum Wagen und klettert auf den Bock.
Vor Bills Augen greift Trevor in den Sack, holt sich eine Handvoll Zucker heraus und stopft sie sich in den Mund.
»Ha – halt«, japst Bill entsetzt. »Bloß nicht – nicht!«
»Der Zucker ist in Ordnung, du Narr«, erwidert Trevor grimmig. »Es muss der gemahlene Kaffee sein. Wo hast du die Büchse, Bill?«
»Aber – der Sack war doch halb aufgebunden und …«
»Eben, dadurch hast du dich bluffen lassen, Mensch. Wo hast du die Kaffeebüchse?«
»Hier – hier! Was – nicht der Zucker? Dann bin ich – ich bin – vergiftet!«
Bill verdreht entsetzt die Augen und stiert Trevor furchtsam an.
»Was – was bist du, Bill?«
»Vergiftet«, lallt Bill und sinkt vom Sitz nach hinten. »Oh, ich habe Kaffee gefressen. Kaffee gefressen, weil es gut gegen Durchfall sein soll. Oh, mein Bauch!«
»Ist dir schlecht? Mensch, ist dir schlecht? Antworte!«
Er packt Bill am Kragen und hebt ihn hoch. Bill glotzt ihn an, betastet seinen Bauch und sagt nach einer Pause: »Ist nichts mit meinem Bauch, nicht schlecht, nein!«
»Und du hast aus der gleichen Kaffeedose genommen, aus der du gestern den Kaffee aufgebrüht hast?«
»Ja!«
Trevor angelt nach der Kaffeedose, auf die Bill mit zitternder Hand deutet, nimmt den Löffel, stopft sich einen gehäuften Löffel Kaffee in den Mund und kaut.
»Schmeckt wie Kaffee und sonst nichts. Wann hast du angefangen, Kaffee zu essen, Bill?«
»Oach, vor mehr als zwei Stunden!«
»Dann würdest du also jetzt praktisch halb tot, wenn nicht ganz tot sein müssen, he?«
»Was – halb tot, ganz tot. Oah, mein Bauch …, fürchterlich!«
»Du hast doch keine Schmerzen, was? Also nimm dich zusammen, ich habe auch welchen gegessen. Bill, jetzt denkst du einmal scharf nach. Du hast doch nicht zuerst die Vergiftung erwischt, eher zuletzt. Hast du irgendeine andere Speise vorher probiert? Hast du alles probiert, Bill?«
»Alles! Aber – aber, wenn nun kein Zucker und kein Kaffee vergiftet worden ist – was ist es dann, Boss?«
»Siehst du, das Gleiche frage ich mich auch, mein Freund. Saguaro sagt, dass es ein Kristall sei, mit dem wir vergiftet worden sind, Kristall kann man in die Suppe werfen, aber die hat nicht bitter geschmeckt. Sonst haben wir nichts, was suppig gewesen ist, wie? Wann hast du die Suppe fertig gehabt, Bill?«
»Oach, ’ne halbe Stunde vor den Steaks ungefähr. Habe gegessen und nichts gemerkt. Boss, es ist der Kaffee gewesen, ich lasse mich hängen, wenn es nicht der Kaffee gewesen ist. Der hat so verrückt bitter geschmeckt. Ist noch ein Rest davon da!«
»Warum sagst du das nicht gleich. Her damit …, gib schon her, ich werde ihn probieren.«
»Boss, um Gottes willen, lass das sein«, ruft Bill Lawson entsetzt und will den Topf festhalten. »Wenn er vergiftet ist, dann fällst du um. Und wir brauchen dich alle. Boss – lass sein!«
Trevor nimmt ihm den Topf weg, sieht sich um, steigt dann vom Wagen und – bleibt durch den Wagen gedeckt. Er blickt kurz zur Remuda hin, nimmt dann den Topf in beide Hände und sagt knapp: »Ich lasse einen Gaul saufen. Saguaro hat gesagt, dass das Zeug selbst einen Gaul umwirft. Also werden wir es gleich haben. Der Junge ist nicht da, also los!«
»Ich komme mit!«, sagt Bill heiser. »Das will ich sehen, verdammt.«
Gemeinsam gehen sie zur Remuda, sehen niemand in der Nähe, da die Remuda hinter den Büschen im Seilcorral steht und setzen den Topf einem der Pferde vor. Die beiden Traufen, in denen Wasser ist, haben große Flecken, die beiden Eimer und die Trage fehlen, also holt Jesse wohl gerade vom Bach Wasser.
Der Topf steht vor dem einen Braunen, der den Hals lang macht und säuft.
»Er säuft den ganzen Rest aus«, sagt Bill gedämpft und mit düsterer Erwartung in der Stimme. »Boss, sie mögen Zucker und Zuckerwasser. Der säuft alles leer und …«
In diesem Augenblick geschieht es. Der Gaul keilt jäh aus, trompetet dann einmal und steigt. Danach fällt er auf die Seite, stößt die Hufe keilend aus und hat Schaum vor den Nüstern.
»Fünf Liter mindestens«, sagt Trevor heiser und starrt auf das braune Pferd. »Da, er steht auf – er will hoch und wird … Donner, er schafft es, aber er wankt wie betrunken hin und her.«
Der Gaul steht nur eine knappe Minute, dann kracht er wieder auf die Seite, liegt mit pumpenden Flanken still und wiehert klagend.
»Bill, hole Saguaro her, er wird ihm helfen. Dem Gaul macht das nicht viel aus, aber hole mir Saguaro trotzdem. Ich komme mir ziemlich gemein vor, ihm den Topf vorgesetzt zu haben. Geh, geh schnell, Bill!«
»Ja, Boss. Alle Teufel – nicht im Kaffee – nicht im Zucker, also – das verstehe ich nicht!«
Bill Lawson murmelt vor sich hin und rennt weg. Er ist kaum verschwunden, als sich Trevor umsieht, den Lagerplatz des Jungen betrachtet, der hinter einigen Büschen liegt und dann schnell zum Packen des Jungen geht.
Trevor Joslyn weiß nicht, warum er das macht, aber er hat den Packen vor Augen und die Worte des Jungen noch in den Ohren, dass es keiner der drei Männer gewesen sei.
Das kann ein Trick sein, ein Trick, weil er selbst auf dem Wagen gewesen ist, vielleicht eine Gelegenheit auskundschaften wollte und den Sack … Natürlich, vielleicht hat er versucht, den Sack aufzubinden. Außerdem – hat der Junge nicht immer Bill geholfen, Holz suchen?
Mein Gott, denkt Trevor, der Junge wird doch nicht … Ich traue keinem mehr. Verrückt, aber ich traue eben niemandem mehr im Camp. Wenn er nun versucht hat, den Sack zu öffnen? Wenn er es nicht schaffte, und … Er hat genügend Gelegenheit gehabt, um in den Kaffee etwas hineinzuschütten, genügend Gelegenheit!
Er reißt mit fliegenden Händen den Packen auf, sieht den Beutel aus Leder und löst den Knoten der Schnur.
Und dann starrt Trevor Joslyn auf die Scheine, die ihm förmlich entgegenquellen. Er hat das Geld in den Händen, viele Scheine. Hundert – zweihundert – vierhundertachtzig Dollar und etwas Hartgeld.
»Allmächtiger«, sagt Trevor ächzend und stopft das Geld in den Beutel zurück, knüllt es zusammen und wird ganz blass.
»Der verdammte Junge, dieser Judas. Und hier …«
Da ist ein kleiner Holzkasten mit irgendwelchen Initialen auf dem Deckel, mit Perlmutter eingelegt, ein kleines Schloss, aber nicht für eine Messerklinge haltbar genug.
Trevor Joslyn drückt sein Messerheft einmal nach unten, der Kasten springt auf.
Joslyns Augen schließen sich beinahe völlig. Da ist ein Schraubglas, dicht vor seinen Augen. In diesem Glas ist eine kristallbraune Masse, die leicht staubt, als er das Glas schüttelt. Tabletten, Pülverchen …, eine halbe Apotheke schleppt der Junge mit sich herum.
»Oh, verdammt!«, sagt Joslyn nur und fühlt in sich die wilde Wut aufsteigen. »Ich werde dich lehren, ich werde dich … Wer weiß, ob du überhaupt Barts Neffe bist – bist zu spät gekommen – in letzter Sekunde! Kommt alles hin, passt alles. Slim hat Pech gehabt, sein Mann hat mich nicht erwischen können, da musste er schnell jemanden haben, der hier den Trail mitmachte und uns den Gifttrank vorsetzte. Ich hänge dich auf. Ich werde dich …«
Er hört das Klirren der Ketten hinter sich, jener Ketten, die an der Holztrage baumeln. In die Haken der Kette wird an jeder Seite ein Eimer eingehängt.
Der Junge.
Trevor dreht sich jäh um, reißt seinen Revolver heraus und wartet in der Drehung auf den Knall. Doch es kommt keiner. Der Junge steht da, die Trage noch auf dem schmalen Rücken, die Eimer am Boden. Kein Revolver in seiner Hand.
Und der Junge sieht ihn groß und verstört an.
Er blickt mitten in Trevors Revolver.
»Zieh schon, dann geht es schnell«, sagt Trevor fauchend und kann hinter dem Jungen Saguaro und Bill angerannt kommen sehen.
»Nun, du Schuft, nun zieh doch! Zieh, dann brauche ich dich nicht aufzuhängen! Hat Slim dir genug über Barts Familie erzählt, du Halunke? Hat er das? Warum wirst du blass, he? Warum denn bloß? Zieh endlich.«
Der Junge sieht ihn an und wird kreideweiß.
»Trevor – ich – ich …«
Trevor packt die Wut, jener selten kommende Zorn, der ihn rasend machen kann. Er springt mit einem Ruck hoch. Der eine Eimer fliegt um, die Trage saust davon und Trevors linke Hand hat den angeblichen Jesse am Kragen erwischt.
»Ich bringe dich um!«, sagt Joslyn fauchend. »So wahr ich hier stehe, ich bringe dich um! Saguaro, sieh dir das an – sieh dir seinen Packen an.«
Saguaro wirkt in diesem Augenblick wie ein Tier.
Er hat sich geduckt und gleitet ohne ein Wort zu sagen um den Jungen und Trevor nach hinten.
Dann bückt er sich, während Bill Lawson die Hand nach dem Revolver senkt und jäh schweigt, als Saguaro den Beutel aufmacht und das Geld zu Boden flattert.
»Damnato«, brummt Saguaro heiser. »Damnato – viele Geld, was ich sehen – viele Geld! Und da! Braune Kristall – Kristall! Verflucht, du neben mir geritten, du gelogen, gesagt, du sein Partner, du mögen meine Boss. Und du ihn vergiften? Du alle Partner vergiften?«
Seine Faust hat sein Messer in der Hand.
»Nein«, sagt da der Junge schrill und voller Furcht. »Nein, nein, ich habe nicht gelogen, Saguaro, ich habe nicht …«
Seine helle Stimme überschlägt sich vor Furcht. Saguaro kommt auf ihn zu, in einer Hand das Messer, in der anderen das Schraubglas mit dem braunschwarzen Kristall.
»Und was sein das? Boss, lassen los den Hund, ich reden mit ihm, ich reden. Lassen los, Boss. Was das sein, Kid, was das sein?«
Und er hält ihm Messer und Schraubglas abwechselnd unter die Nase.
»Saguaro, da ist ein Becher, schütte Wasser hinein und die Hälfte des Zeugs aus dem Glas. Mach schnell, Saguaro!«
»Ah!«
Der Indianer nickt heftig, gleitet zurück und sagt im Gehen finster: »Das gerechte Strafe sein. Trinken halbe Glas voll Giftzeug, sein kaputt, gut – sehr gut! Rechte Strafe!«
Er füllt geschickt den Becher voll Wasser, schüttet das Kristall hinein und beugt sich dann vor.
»Komm, trinken! Schön machen auf … Machen du wohl auf deine Maul oder sollen ich nehmen die Messer, he?«
»Ist doch kein Gift – ist doch nur zum Gurgeln …, zum …«
»Lügen auch noch. Marsch, trinken!«
Saguaro packt seinen Kopf, stößt ihn zurück und gegen Trevor, der ihm beide Arme auf den Rücken reißt. Dann kommt Saguaro näher, immer näher, hebt den Becher an und hält ihn an die Lippen des Jungen.
»Was – was, du heulen? Jetzt du heulen, hä? Aber vorher vergiften alle.«
Der Junge macht den Mund auf, trinkt und bricht vor Furcht in Tränen aus.
»Weiter, weiter, mehr trinken!«, faucht der Indianer und packt ihn an der Brust. »Du wirst noch mehr nehmen von Teufelszeug und …«
Er erstarrt plötzlich, zieht seine Hand zurück und lässt den Becher fallen.
»Nombre de dios!«
»Saguaro, was ist?«, fragt Trevor grimmig. »Gib ihm den Rest auch noch zu saufen!«
»No – nein, nein!«
»Waaas?«
»Nicht anfassen, Boss!«
Saguaro weicht langsam zurück und schüttelt wild den Kopf.
»Boss, das sein … Nein, nein!«
»Was ist, Mensch, was hast du, du Narr? Dieser Lümmel hier heult und du … Was hast du, Saguaro? Mach weiter!«
»No! Denkt Saguaro das sein Partner und immer denken, sein Neffe von Bart Tyler. Denken – nein, verdammt – ist Mädchen!«
»Waaaas? Was ist das? Saguaro …«
»Sein Mädchen, sein Mädchen! Gerechtes Gott, ihm sein Mädchen!«
Der Indianer ist schmutzig grau im Gesicht und setzt sich vor Schreck hin. Bill reißt die Augen weit auf und Trevor Joslyn lässt die Arme des Jungen jäh los.
Der Junge aber – oder das Mädchen – sinkt zu Boden und vergräbt den Kopf schluchzend in den Händen.
»Mein Gott«, sagt Trevor entgeistert. »Saguaro – ein Girl? Mach mich nicht verrückt, Mann. – He, Sie – du, Mensch, jetzt rede: Was bist du? Junge oder Mädchen?«
»Ich bin – bin Suzanne Tayler, Trevor. Und in dem Glas ist hypermangansaueres Kalium, das nehme ich immer, weil ich so leicht Halsschmerzen bekomme. Zum Gurgeln – zum Gurgeln nimmt man das und …«
Jetzt heult sie noch dreimal schlimmer.
»Allmächtiger!«
Trevor Joslyn wankt langsam zurück und setzt sich rittlings auf den Eimer, bekommt einen nassen Hosenboden und fährt fluchend hoch.
»Was, zum Henker, soll das? Suzanne, sofort hörst du – hören Sie auf zu heulen. Ist das wirklich … Gib das Glas her, Saguaro!«
Er hat als Kind irgendwann einmal das Zeug bekommen, als auch er Halsschmerzen und dicke Mandeln hatte. Jetzt steckt er den Finger ins Glas, leckt und sagt brummend: »Kann stimmen. Hölle und Finsternis, was soll der Blödsinn hier? Welcher Idiot hat Sie an die Herde geschickt, Lady? Wozu das? – Ich werde verrückt, ich drehe durch.«
Er sieht sich hilflos um und zuckt dann heftig zusammen. Hinter dem Wagen ist ein Reiter aufgetaucht.
Der Mann sieht zu ihnen hin, erkennt das Glas in Trevors Hand und das Pferd am Boden.
In diesem Augenblick verändert sich das Gesicht Lacy Johnstons mit einem Schlag.
Lacy Johnston, der Mann am Wagen, sieht das auskeilende Pferd und dann Trevor mit dem Glas in der Hand.
Aber auch Bill sieht ihn und sagt mit überschnappender Stimme: »Lacy – Lacy war zuerst zum Wagen gekommen und wollte einen Feuerstein haben! Lacy – Lacy ist …«
Lacy Johnston fährt zusammen, reißt dann mit einem Fluch sein Pferd herum und verschwindet jäh hinter dem Wagen. Er, einer der Männer, die von Saengers, einem der kleinen Rancher vorgeschlagen worden war, reißt sein Pferd herum und ist weg. Der Wagen deckt ihn.
Trevor Joslyn fährt herum und macht drei, vier lange Sätze auf den Seilcorral zu. Dann fliegt er über die Seile hinweg und brüll hallend: »Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Lacy hat uns vergiftet! Haltet ihn!«
Er hört das Trommeln der Hufe und dann den belfernden krachenden Abschuss des Revolvers. Rinder muhen erschrocken, Männer brüllen.
Und rechts voraus taucht jäh Lacy Johnston auf seinem Gaul auf, den er wie ein Irrer antreibt. In der rechten Hand hält Lacy seinen Revolver.
Trevor Joslyn weiß, dass es nichts als Zufall ist: Sein eigenes Pferd steht gesattelt am Wagen. Er kennt sein Pferd und dessen Schnelligkeit, und er springt jetzt, nachdem Lacy schon über zweihundert Schritt entfernt ist, in den Sattel.
Dann treibt er seinen hochbeinigen ausdauernden Schimmel mit einem wilden Ruck an.
Er wird Lacy Johnston erwischen. Der Schimmel schlägt jedes andere Pferd mit Ausnahme von Saguaros Grauem. Jetzt dreht sich Lacy um, stößt einen Schrei aus und greift nach der Seite.
Es ist nur eine kurze Bewegung, dann hat Lacy Johnston sein Gewehr aus dem Scabbard gerissen und schwenkt die Waffe herum.
Trevor Joslyn erkennt deutlich jede Bewegung Johnstons. Er sinkt jäh flach auf den Hals des Schimmels herab und treibt das Tier stur geradeaus.
Dann hört er den Knall und in der gleichen Sekunde auch schon das Fauchen der Kugel über sich.
Lacy Johnston will sich nicht kampflos ergeben. Trifft er, dann hat er eine Chance zu entkommen.
Und da knallt es noch einmal.
Der Schimmel macht einen ruckartigen Satz!
Um ein Haar wird Trevor aus dem Sattel geschleudert. Die Kugel ist knapp vor den Hufen des Schimmels eingeschlagen und hat eine Dreckfontäne in die Augen des Pferdes geschleudert. Das Pferd versucht auszubrechen, doch lenkt Trevor es mit eiserner Gewalt zurück.
Er zieht noch nicht sein Gewehr, weil er weiß, dass es nutzlos wäre, jetzt zu schießen.
Und er kennt Lacy Johnstons Gewehr. Es fasst nur fünf Patronen.
Lacy wird getrieben und muss einsehen, dass er treffen muss, wenn er nicht erwischt werden will. Er jagt jetzt weiter in einem leichten Bogen nach links auf den dort aus dem hügeligen Gelände aufwachsenden Kamm zu. Seine Absicht ist klar: Er will, obwohl er jetzt Zeit verliert und Trevor ihm näherkommen muss, über den Hang.
Dort wird er halten und warten, um einen sicheren Schuss abzufeuern, der Trevor aus dem Sattel holen muss.
Trevor erkennt Lacys Absicht sofort. Bis zum Hang sind es noch gut dreihundert Schritt, bei dem rasenden Galopp der beiden Pferde keine große Entfernung. Lacy gibt noch einen Schuss ab, aber auch diese Kugel streicht am Schimmel Joslyns vorbei und reißt irgendwo hinten den Boden auf.
»Noch zwei«, sagt Trevor zwischen den Zähnen und hat den harten Reitwind mitten im Gesicht »Er schießt nicht mehr, wetten? Ich muss ihn etwas nervös machen und in dem Glauben lassen, dass ich mitten in seine Falle hineinreiten werde.«
In einem Augenblick hat Trevor Joslyn sein Gewehr hoch, er zielt kurz und drückt ab.
Das Pferd von Johnston macht einen hastigen steilen Satz in die Luft, keilt einmal aus und kracht dann nach links um. Johnston saust aus dem Sattel, taucht noch einmal aus der Staubwolke auf, die beim Fall seines Pferdes entstanden ist, und will nach seinem Gewehr springen.
Die Waffe liegt etwa drei Schritt entfernt. Johnston wagt es, er springt los.
Trevor stößt einen kurzen heiseren Laut aus, visiert knapp, drückt dann auch ab und sieht Johnston links einknicken. Der Mann stürzt neben sein Gewehr hin, ergreift es und rennt dann doch wieder los. Mit zwei, drei humpelnden Schritten springt er hinter sein Pferd. Und dort wird er jetzt das Gewehr neu laden.
Auch Joslyn hat blitzschnell nachgeladen, erkennt die sich auf ihn richtende Gewehrmündung und feuert.
Johnston schießt im gleichen Moment.
Die Kugel kommt heran, schlägt hart vor Trevor in den Boden und überschüttet ihn mit einem Hagel von Sandkörnern und Lehmbröckchen. Trevor, der die Augen aufgehabt hat, rollt sich sofort nach rechts. Sand sitzt in seinen Augen. Er wartet jede Sekunde auf den Krach, den Johnstons Gewehr machen muss, doch es kommt nichts.
Schließlich prallt er an einen Busch, rutscht hastig nach hinten und presst seine linke Hand an die Augen. Während er heftig seine Augen reibt und nichts sehen kann, hört er das Gebrüll eines Mannes und dann einen Schuss.
Er reibt heftig, zieht die Augenlider hoch und setzt sich schließlich auf. Tonios Stimme ist hinter ihm, von drüben ruft Eddy Swartz heulend: »Ist er heil – ist er heil?«
»Ja«, gibt Tonio zurück. »Er sitzt am Boden und heult Tränen. Hast du den Kerl?«
»Ich habe ihn, kommt schnell her, er lebt zu wenig, um am nächsten Baum …«
Trevor kann endlich auf dem linken Auge etwas sehen. Es brennt und zwickt schlimm, die Tränen rinnen immer noch aus dem rechten Auge über sein vom Staub bedecktes Gesicht. Torkelnd kommt er hoch, sieht Tonio mit dem Schimmel auf sich zujagen und greift nach dem Sattel.
Gemeinsam – Trevor kann nun schon bedeutend besser sehen – reiten sie zum Pferd hin, hinter dem in etwa vier Schritt Entfernung Charlie Johnston auf der Seite liegt.
»Er wollte wegkriechen«, sagt Eddy bitter. »Ich konnte nicht wissen, dass er schon von dir eine Kugel in die Schulter bekommen hat, Trevor. Komm schnell, er lebt nicht mehr lange.«
Trevor steigt ab, kniet neben Lacy nieder und hebt seinen Kopf langsam an.
»Lacy – Lacy!«
»Schon – schon gut. Vorbei, was? Ich – ich habe es nicht gern getan, aber das Geld …, Trevor, Slim hat – Geld …«
»Bist du schon länger für ihn geritten?«
Johnston versucht den Kopf zu schütteln und sagt brüchig: »Nicht – lange. Er – wird – dir …«
»Was wird er, Lacy? Was? – Sage es, Mann! Was wird er noch tun?«
Lacy Johnston sieht ihn aus flackernden Augen an und bewegt die Lippen. Und als sie sich alle über ihn beugen, da hören sie ihn sagen: »Geld …, Geld …«
Und dann sagt Lacy Johnston nichts mehr.
Sie sehen sich alle an. Noch mehr Männer kommen, steigen ab und betrachten Johnston finster.
»Schade«, sagt Bustamente, an dessen Sattel die Gitarre baumelt. »Schade, Verräter sterben manchmal zu schnell!«
»Nehmt seinem Pferd den Sattel ab und schafft ihn ins Camp«, bestimmt Trevor düster. »Vielleicht ist es besser so – sicher besser.«
Er zieht sich wieder in den Sattel, blickt über die Hügel und weiß, dass es für Lacy Johnston so besser ist. Die anderen Männer in ihrer wütenden und gereizten Stimmung würden ihn aufgehängt haben.
So hat Lacy wenigstens noch gekämpft und ist anständig gestorben.
Er reitet stumm und bitter an. Hinter ihm ist Schweigen, Sättel janken und Pferde prusten.
Er sieht das Camp vor sich und erinnert sich mit einigen bitteren Gefühlen an das Mädchen. Sie hat nie den Hut abgenommen, soviel er weiß, aber vielleicht hat sie auch ihr Haar abgeschnitten. Was soll er nun tun? Eine Herdenmannschaft, in der ein Mädchen ist.
*
Großer Gott, was kann das werden? Soll man sie wegschicken, die ganzen Meilen nach Hause?
Er erinnert sich an ihr schneeweißes Gesicht und die Furcht in ihren Augen. Ihre Tränen, als Saguaro sie zwang, aus dem Becher zu trinken.
Warum ist sie an die Herde gekommen? Warum hat sie mit Jesse Tyler getauscht? Etwas anderes kann es doch wohl nicht sein. Sie hat ihre Pflicht wie ein Mann getan, wenn er es richtig überlegt. Die zwei Hände werden ihm fehlen, das ist die eine Sache. Aber ein Mädchen im Camp, an der Herde? Das ist nun wieder die nächste und schlimmere Geschichte.
Er erreicht den Wagen, steigt ab und sieht sich um. Einige der Männer sehen ihn fragend an.
»Er – er ist tot«, sagt er düster. »Er hat es für Geld getan und seine Bezahlung bekommen. – Wo ist Saguaro?«
»Bei der Remuda«, sagt einer und sieht weg. »Boss, was wirst du jetzt tun?«
»Mich bedanken, keine Sorge!«
Er geht am Wagen vorbei, langt in den Kessel und trinkt gleich aus der Kelle von dem verdammten Gebräu Saguaros. Dann steigt er über die beiden Seile des Corrals hinweg, entdeckt Bill ein Stück weiter und kann dann hinter den Büschen Saguaros breiten Rücken erkennen.
Der Indianer kauert am Boden und sagt mit seiner kehligen Stimme verzweifelt: »Miss müssen nicht mehr heulen. Heulen macht alt und hässlich. Tun mir leid, oh, verdammt, es tun mir so leid, aber ich nicht wissen, dass Miss und denken, sein schlechter Junge, wo belügen seine Partner und geben Gift. Und da ich zwingen zu trinken – tun mir leid, sehr leid, Miss.«
Suzanne kauert am Boden und schluchzt immer noch. Trevor nähert sich von der Seite, bleibt bei Saguaro stehen und scharrt mit dem rechten Stiefel am zertretenen Boden.
Er kniet neben Suzanne nieder, die den Hut verloren hat. Sie hat wirklich ihr Haar abgeschnitten und trägt es so lang, wie es eben ein ziemlich wilder Junge tragen kann, der drei Monate keinen Barbier gesehen hat. Ihre Schultern zucken. Trevor beugt sich nieder und berührt sie vorsichtig.
»Suzanne, Mädel, jetzt ist es genug«, sagt er rau. »Saguaro macht sich schreckliche Vorwürfe, er verträgt es nicht, wenn eine Frau ihm böse ist.«
»Ich – ich bin ihm nicht böse, aber er hat so schrecklich wild ausgesehen. Und – und Sie auch, Trevor!«
»Ah, schön, viele Freude machen Saguaro, viele Freude!«
Der Indianer kramt sein Taschentuch hervor und trompetet heftig.
Trevor aber rüttelt Suzanne leicht und nimmt ihr die Hände vom Gesicht.
»Na, na, Mädel, so schlimm ist das alles nicht. Aber wenn man da so einige Dinge findet, dann glaubt man leicht daran, dass nicht alles richtig ist. Ich hätte eben mehr Vertrauen haben müssen. Jeder macht mal einen Fehler, wie? Mädel – nun hören Sie auf zu weinen!«
»Sie …, sie schon gewesen ganz ruhig beinahe«, sagt Saguaro in seinem Kauderwelsch. »Aber dann gehen Schüsse und sie heulen und sagen, jetzt Boss sein mausetot. Da wieder heulen und jammern und nicht sein zu beruhigen, Boss!«
»So?«, fragt Trevor bitter. »Mir ist nichts geschehen, Suzanne. Ich muss ziemlich ernst mit Ihnen reden. So geht das nicht. Sie wissen ganz genau, dass eine Frau an einer Herde …«
»Ja«, erwidert sie schluckend. »Ist schon gut, Trevor. Ich – ich werde meine Sachen nehmen und gehen. Wenn Jesses Eltern einen Brief bekommen, in dem ein alter Mann nach mir fragt – dann ist es ohnehin vorbei. Ich gehe – ich gehe ja auch heute noch, Trevor!«
Ihre Stimme klingt ziemlich verzweifelt, aber Trevor sieht wirklich keinen anderen Ausweg und sagt leise: »Ich schicke einen der Männer mit bis Fort Worth. Dort bekommen Sie die nächste Kutsche, Lady. Ich kann Sie nicht bei der Herde behalten. Was für ein Glück, dass Sie es selber einsehen. Dann brechen Sie am besten in zwei Stunden auf, ich denke, Sie bekommen dann die Abendkutsche noch!«
»Ja, Mr Joslyn!«
Saguaro sitzt dabei, kauert auf den Knien und schaut erst Trevor, dann die Lady fragend an.
»Du jagen sie weg, Trevor?«
»Natürlich nicht, aber sie muss nach Hause, Saguaro. Das siehst du doch ein? Ein Mädchen an einer Herde, das geht einfach nicht, verstanden?«
»Ich nicht verstehen, verstanden, Boss!«
»Was ist? Saguaro, was soll das heißen?«
»Sie bleiben, verstehen!«
»Sag mal, bist du verrückt, Saguaro? Das geht nicht, das ist unmöglich! Wenn eine verheiratete Frau mit ihrem Mann, der Rancher ist oder Trailboss, eine Herde begleitet, dann schon, aber doch kein Girl, Saguaro, jetzt wirst du vernünftig, klar?«
Der Indianer starrt sie aus seinen dunklen Augen reglos an und bewegt sich nicht.
»Gut!«, brummt er im gutturalen Tonfall.
Damit dreht er sich um und geht los.
»Saguaro, wo willst du hin, zum Teufel? Was willst du nun wieder tun, du verdammter Dickschädel!«
»Reiten nach Hause zu Indianerdorf und fressen Mais mit dicke fette Weiber. Und sagen zu jede dicke fette Hund, die laufen auf Dorfplatz: Bah, Trevor Joslyn!«
»Saguaro, jetzt ist es genug, du bleibst hier, verstehst du, Dickschädel, verdammter?«
»Schicken weg, Miss, dann auch gehen Saguaro, du auch verstehen?«
»Saguaro, das kannst du doch nicht machen. Nenne jeden dicken fetten Hund meinetwegen gleich Trevor Joslyn, aber geh nicht weg. Wie soll ich denn ohne dich nach Sedalia kommen?«
»Ah, jetzt kommen und bitten und betteln armes Indianer, he? Denken, schöne Schmeichelei machen und Saguaro doch bleiben, he? Selber alle Arbeit machen, du Ochse, selber machen, verstehen? Saguaro gehen!«
»Halt, Saguaro, ich gehe ja freiwillig, er braucht mich nicht wegzuschicken«, meldet sich da Suzanne. »Saguaro, höre zu: Ich weiß, dass ich nicht hierbleiben kann, nachdem ihr wisst, dass ich ein Mädchen bin. Er braucht dich doch …«
»Es hat keinen Sinn, Lady«, brummt Trevor bitter. »Ich kenne Saguaro, den hält nichts zurück, wenn er sich etwas in seinen Dickschädel gesetzt hat.«
»Du, Trevor, Dickkopf selber, verstehen? Sie getan Arbeit gut, warum nicht sollen machen Arbeit weiter? Du haben Angst, kommen Boys und verrückt nach Girl? Gut, kommen, ich haben Messer und passen auf. Einer kämpfen wollen mit Saguaros Messer? Keiner, ich sagen keiner, alle Angst! Sie bleiben, Saguaro bleiben und passen auf, verstanden?«
»Du bist ja …«
»Letzte Wort gesprochen! Jetzt reden, ob gehen wollen allein Sedalia und machen Gespräch mit Indianer allein. Sie bleiben, Saguaro bleiben. Sie gehen, Saguaro gehen …, fertig!«
Danach kreuzt er die Arme über der Brust und bleibt so stehen, wie es nur ein Indianer tun kann: Stoisch, gleichmütig!
Bill Lawson räuspert sich und kommt langsam näher. Die Lady sagt gar nichts, sie ist anscheinend so weit über den dicken Kopf Saguaros informiert, dass sie den Mund hält und abwartet, was Trevor beschließen wird.
Trevor aber steht da, starrt Saguaro grimmig an und hört dann Bill sagen: »Hör mal, Boss, sie ist schließlich Barts Tochter und vertritt ihn an der Herde. Dagegen ist kaum etwas zu sagen. Außerdem haben wir sie mächtig gequält. Ich denke, du kannst es tun. Die Männer werden schon nicht verrückt spielen, schließlich werden sie es verstehen – na?«
»Zum Teufel, redet nicht mit Engelszungen auf mich ein. Ich weiß zu genau, was geschieht, wenn sich ein Girl in der Mannschaft befindet. Nicht, dass ich an sonst etwas glaube, aber sie werden die nächste Stadt besuchen und ihren Spaß haben wollen. Ich kann nicht …«
»Wenn wollen, dann können!«, brummt Saguaro dazwischen.
»Sei still, du Idiot! Mit dir rede ich kein Wort mehr! – Gut, sie kann bleiben. Und nun geht alle in die Hölle und sagt dem Teufel, er soll euch in den dicksten Kessel stecken. Verdammter Dickkopf, ich könnte dich …«
Er dreht sich wütend um und geht los.
So im Zwiespalt seiner Gedanken kommt er zum Wagen und sieht die Mannschaft beinahe vollzählig versammelt vor sich.
»Ramon«, sagt er scharf. »Näht ihn in eine Decke. Ich werde ihn zu seinem Boss zurückschicken, sobald wir kräftig genug sind, um uns Slim auf jede Art vom Hals zu halten. Tragt ihn in den Schatten. Und du – zum Teufel, hör auf zu klimpern, Bustamente, ich kann deine Zupferei nicht mehr hören! He, kommt alle her, ich habe euch etwas zu sagen, und sperrt gefälligst die Ohren auf!«
Er wartet, bis sie alle nahe genug sind. Bustamente blickt ihn verwirrt und beinahe erschrocken an, steckt verschüchtert sein Banjo weg und wechselt einen verständnislosen Blick mit seinem Partner Jacco.
»Also«, sagt Trevor kurz und winkt Wes Turner heran, der seinen Arm verbunden und nur einen Streifschuss von Lacy erhalten hat. »Die Sache ist ganz einfach, Leute. Wir haben ein Girl in der Mannschaft!«
Die Männer sehen sich bestürzt an, dann aber wandelt sich ihre Bestürztheit in breites Grinsen.
»Uh – wo ist die holde Jungfrau?«
»John, ich trete dich sonst wohin, wenn du weiter so redest, das verspreche ich dir«, brüllt ihn Trevor zornig an. »Es ist Suzanne Tyler, damit ihr es wisst. Ja, Dexter, die Tochter von deinem Boss! Wo habt ihr drei Burschen eure Augen gelassen? Ihr habt sie nicht erkannt, sie ist an der Remuda geritten. Oder wisst ihr es etwa?«
»Wa – was?«, fragt Dexter van Vleck, einer der Männer Tylors verstört. »Das ist doch wohl nicht – das kann nicht wahr sein!«
»Saguaro, komm mit der Lady her, schnell!«
Saguaro kommt mit Suzanne heran, die den Kopf tief gesenkt hält und den Hut wieder aufgesetzt hat.
»Runter mit dem Hut, Lady. Well, Dexter, jetzt sieh sie an, und dann sage, ob sie noch immer Jesse ist!«
»Sie …, sie … Allmächtiger, Miss Suzanne, die schönen Haare!«
Die Männer glotzen sich erstaunt an, grinsen dann und nicken.
»In Ordnung, Trevor«, meint Ramon träge. »Sie ist Miss Tyler, gut. Hier sind nur Gentlemen, sie wird das merken. Wer bei uns zu Hause eine Frau anfasst, wenn sie nicht angefasst werden will, der stirbt ziemlich schnell. Saguaro, mein Messer kannst du auch noch bekommen!«
Die Männer haben ihren Gesprächsstoff, wenn auch Eddy und Wes meinen, die Sache sei ganz und gar verrückt, und der alte Bart würde ihnen alle Haare einzeln ausreißen. Schließlich beruhigen sie sich alle wieder, trinken den verdammt bitteren Höllentee und erholen sich langsam. Bill Lawson macht nach Saguaros Angaben ein Essen fertig, ein Teil der Mannschaft zieht wieder auf Pferden um die Herde, der andere ruht sich aus und schläft im Schatten unter den Büschen und Bäumen.
Trevor aber geht zur Remuda, brummt vor sich hin, als er dort Saguaro und Suzanne findet und sagt schließlich: »Lady, Sie können Bill bei der Arbeit helfen. Dies hier ist keine Arbeit für eine Frau!«
»Trevor, ich möchte aber weiter an der Remuda bleiben!«
»Da haben wir es. Sie möchte, wie, sie möchte? Gebe ich die Befehle oder Sie, Lady? Nun gut, bleiben Sie an der Remuda und schinden Sie sich tot, wenn Sie so närrisch sein wollen!«
Und dann geht er los und lächelt leicht vor sich hin. Dieses kleine Mädchen hat wirklich prächtige Augen – und ehrliche noch dazu. Vielleicht würde dieses Mädchen niemals auf einen großen Haufen Geld sehen und darüber alles andere vergessen?
Er geht zum Wagen, nimmt sich seinen Block Papier und schreibt etwas auf ein Blatt. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist Mittag. Am Nachmittag wird er losreiten können, denn die Männer erholen sich unter der Wirkung von Saguaros Teufelsgebräu ziemlich rasch. Wenn er in der Dunkelheit das Camp von Slim Dorlanay erreicht, dann ist es die richtige Zeit.
Trevor winkt Saguaro heran, reißt den Zettel vom Block ab und faltet ihn zusammen.
»Saguaro, mach mir die beiden besten Pferde fertig. Meinen Gaul und deinen. Ich werde nachher reiten.«
Der Indianer sieht ihn groß an, wendet dann den Kopf und blickt zu den Büschen hinüber, an die man Lacy gelegt hat.
»Du wollen zu Slim-Stinktier reiten und Lacy abliefern, eh?«
»Ja, ich reite hin und werde ihm einen kleinen Schreck einjagen.«
»Er sein schon über Roten Fluss in Indianerland. Du das wissen, he?«
»Ja, das weiß ich. Mach die beiden Pferde fertig. Ich kann mit Lacy nicht schnell reiten und breche gleich nach dem Mittag auf. Hast du gehört?«
Der Indianer nickt wieder, sagt aber langsam: »Wenn du reiten über Roten Fluss und kommen Indianer, was dann? Wenn du bringen Lacy zu Schuft, dann Slim werden wissen, dass wir nicht malado genug, er müssen jetzt rechnen mit eine Woche oder auch acht Tage, dass ganze Mannschaft nicht können weiter. Er wissen, wir schneller gesund, als er wollen. Das sein klug?«
»Ja«, sagt Trevor knapp. »Das ist klug. Ich will es dir erklären. Du bist Slim-Stinktier und ich Trevor Joslyn. Jetzt pass auf, Saguaro: Slim bekommt Nachricht, dass wir treiben können. Er wird sich ausrechnen, dass irgendetwas nicht ganz geklappt hat. Vielleicht hat er uns längst beobachten lassen und hat uns in der Frühe ziemlich elend gesehen. Nun gut, wenn er nun keine Woche Vorsprung gewinnt, was wird er denken müssen?«
»Wird denken müssen, jetzt kommen du und machen Trail mit Gewalt schneller als seine Trail, ja?«
»Und was macht er dann?«
»Er jagen seine Rinder wie Verrückter. Der sein blöd, wenn wir wirklich kommen schnell!«
»Meinst du, das macht er?«
»Ich ihn kennen, gemeine Schuft Slim. Wir machen ein wenig schneller. Vielleicht zwei, drei Tage, eh? Unsere Herde sein ausgeruht, Slim-Stinktier aber getrieben, wir gestanden, eh? Er lassen laufen sein Herde drei Tage und mehr, ganz schnell, wenn wir kommen nach. Nach drei Tage ist er kaputt, eh?«
»Du bist doch ein schlauer Indianer, Saguaro!«
»Indianer alle viel schlauer als Weiße. Du halber Indianer, verstehen. Aber du nicht reiten, Saguaro reiten!«
»Du? Warum willst du reiten?«
»Lassen Saguaro reiten. Vielleicht treffen Indianer, dann kleine Geschichte Indianerfreunde erzählen. Vielleicht Slim-Stinktier dann bekommen Pfeil in Stinktierbauch, und sein fertig.«
»Nein, das tust du nicht. Lass deine Indianerfreunde aus dem Spiel, Saguaro. Du brauchst nicht zu reiten, es ist besser, wenn ich es tue!«
»Ich schleichen genauso wie du, eh! Du an Herde dreimal wichtiger, also lassen Saguaro. Denken nach, sein besser!«
Trevor denkt nach. Saguaro hat ohne Zweifel recht. Erstens kennt er alle Indianer, spricht fast jeden Dialekt fließend und kommt mit jedem Indianer zurecht. Zum anderen kennt er auch das Land besser. Und schleichen kann er auch, versteht sich.
»Vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich an der Herde bleibe, was? Traust du dir zu, ihn an die Herde zu bringen, ohne dass dich einer sieht?«
»Pah, leichter nichts ist: Bringen ihn zu Wagen und setzen ihn auf Bock. Wenn wollen, ich sagen es!«
»Geh nicht zu nahe ans Camp, Saguaro, Steingesicht Byrd ist da mit seinem Hund.«
»Was – mit Bestie gräulicher? Das sein kein Hund, das Mörderwolf.«
»Ja, der ist wirklich da und hat lange Zähne. Na, willst du noch immer gehen?«
Der Indianer sieht ihn an und nickt ernst.
»Bringen hin und kommen wieder, gut?«
»Ja, in Ordnung, aber komm schnell wieder, wir werden gegen morgen Mittag treiben können!«
»Ist gut, kommen schnell zurück. Du aufpassen auf Miss, ja?«
»Natürlich passe ich auf, Saguaro. Mach dir keine Sorgen.«
»Miss haben Sorgen, wenn Trevor wegreiten, du noch nicht gemerkt?«
Der Indianer grinst und steckt den Zettel ein. Dann geht er los, um die Pferde zu satteln.
Sei vorsichtig, Saguaro, der Hund ist gefährlich. Der Hund ist gefährlicher als zehn Männer. Weißt du das, Saguaro?
*
Der Indianer kommt aus dem Gras hoch und richtet sich langsam bis zu den Knien auf. Er sieht über die Spitzen der Büsche hinweg auf den Saumpfad, der hier am Hügel herabläuft. Unter Saguaro sind die Feuer. Er zählt vier mittelgroße Feuer, erkennt die Planen der beiden Wagen und weiter links die Masse der Rinder, der er sich bis auf zweihundert Schritt genähert hat.
Saguaro hat unheimlich scharfe Augen. Er schließt die Lider halb und kauert bewegungslos hinter dem Buschstreifen. Langsam beobachtet er jeden Fleck des Camps. Dort am Wagen kauern in unmittelbarer Nähe des Feuers einige Männer am Boden.
Selbst auf diese Entfernung erkennt Saguaro Slim Dorlanay an seinem feuerroten Bart. Etwas wie Hass funkelt sekundenlang in Saguaros Augen, dann gleitet sein Blick weiter. Er macht Stevens und Hardkins aus, aber Steingesicht Byrd sucht er vergebens.
Steingesicht ist nicht da.
Da ist ein Fleck unter dem Wagen, aber auf diese Entfernung nur als ein Schatten zu erkennen, der im Dunkel verschwindet. Jemand kommt in diesem Augenblick zum Feuer geritten, sitzt klein auf einem großen Pferd.
Neben ihm taucht etwas aus dem Gras auf, steht im lodernden Schein der Flammen und reckt den Hals hoch, als wittere er etwas.
Da ist der Hundemörder, denkt Saguaro, Wolfsmörder, Bestie – da bist du ja.
Er kennt viele Geschichten von Steingesicht Byrd und dessen Hund. Aber Saguaro hat keine Angst vor Hunden oder Steingesicht, obwohl der zwei Revolver trägt.
Saguaro beobachtet das Camp, das er nach sechs Stunden Ritt erreicht hat. Sechs Stunden, in denen er keine Spur übersehen hat. Er weiß jetzt, dass am Morgen dieses Tages jemand von Slim Dorlanays Reitern in der Nähe des Camps gewesen ist. Dieser Mann hat eine vom Gift überfallene Mannschaft gesehen, die nicht fähig ist zu treiben. Das wird er nun längst seinem Boss berichtet haben. Und der wird sich freuen. Vierunddreißig Meilen ist die Herde Slim Dorlanays schon weitergezogen, längst über fünfzehn Meilen im Indianerland, aber Saguaro hat keinen Indianer sehen können.
Saguaro richtet sich noch ein Stück weiter auf, gewinnt den freien Blick nach links und sieht dort den Reiter.
Es ist einer der Herdenreiter, der seinen Weg am Hang entlang nimmt und oberhalb der Herde bleibt.
Er reiten herunter, drehen unten um und kommen zurück, denkt Saguaro zufrieden. Jetzt er sein unten, jetzt drehen und kommen zurück. Reiten nicht schnell …, gut!
Saguaro huscht zurück, kommt zu seinen beiden Pferden und bindet die Stricke los. Dann bringt er die Pferde direkt hinter die Büsche, leckt an seinem Finger und hält ihn in den kaum spürbaren Wind. Der Wind steht vom Camp auf ihn zu, der Hund wird ihn nicht wittern können.
Der Indianer schleift leicht schnaufend von der Buschreihe an Lacys Körper weiter auf den Weg zu, den der eine Herdenwächter genommen hat. Der Herdenwächter ist jetzt oben auf dem Hügel und dreht.
Saguaro sinkt zu Boden, denn der Mann sieht jetzt in seine Richtung. Nichts rührt sich, die Grasfläche vor den Büschen liegt still und schweigend da.
Dann ist der Wächter weit genug, um Saguaro die Seite zuzuwenden. Und jetzt kriecht der Indianer weiter.
Er braucht vielleicht zwanzig Minuten, um an den im Gras deutlich erkennbaren Streifen zu kommen, um jene Spur zu erreichen, die der Herdenwächter geritten ist.
Der Mann ist jetzt etwa hundertfünfzig Schritte rechts von Saguaro. Mitten auf die Spur schiebt der Indianer die Decke und das, was in ihr ist. Dann gleitet Saguaro zurück, gleitet schnell auf seiner Spur dahin und ist beinahe wieder an den Büschen, als er sich umblickt.
Der Herdenwächter ist keine zehn Schritt mehr vor dem auf der Fährte liegenden Lacy Johnston. Er kommt der Stelle immer näher, muss sie gleich erreicht haben.
Noch reitet der Mann langsam, noch sieht er nichts, aber dann bleibt sein Pferd stehen.
Der Mann blickt auf seine Rinder, doch jetzt schnaubt das Pferd störrisch und geht nicht weiter.
»Jetzt sehen«, sagt Saguaro kühl. »Nun …, jetzt sehen, was? Und was machen?«
Der Herdenwächter nimmt den Blick nach vorn, er senkt den Kopf und zuckt heftig zusammen.
Saguaro aber huscht weiter, erreicht die Büsche und tritt neben die beiden Pferde.
Im nächsten Augenblick sieht er den Reiter drüben absteigen und sich bücken.
Es dauert vielleicht zehn Sekunden, dann erreicht Saguaro der heisere Ruf des Mannes, der auch am Camp gehört wird.
Dort stehen Männer von den Feuern auf, zwei der anderen Reiter kommen schnell von rechts und links. Sie nähern sich ihrem Partner, der heiser ruft.
Vielleicht sollte Saguaro jetzt seine Pferde nehmen und reiten, aber der Indianer denkt nicht daran. Er will erst sicher sein, dass Slim Dorlanay seinen Mann findet und erkennt. Die Männer, die jetzt auf Lacy Johnston stoßen, werden Lacy vielleicht gar nicht kennen.
Er hält neben seinen Pferden, sieht knapp über die Büsche hinweg auf das Camp und die Männer, die nun in laute Rufe ausbrechen. Deutlich erkennt Saguaro, dass sie Lacy anheben und mit ihm zum Campfeuer aufbrechen.
»Gut«, sagt der Indianer zufrieden. »Jetzt gut, sie finden und bringen ihn. Was du machen für Augen, wenn kommen Verräter gebracht in deine Camp, Slim – Schuft?«
Dort kommen sie nun auf die Feuer zu. Das ganze Camp ist hellwach. Männer laufen durcheinander, aus den Wagen steigen zwei Mann heraus und laufen dem Zug entgegen, der jetzt in den Feuerschein kommt.
Saguaro hat nur Augen für Slim Dorlanay und sieht den großen breitschultrigen Mann nun laufen. Dorlanay rennt auf die Pferde zu, stößt einen brüllenden Ruf aus und lässt Lacy, den die Decke noch halb verhüllt, in den Feuerschein legen.
Deutlich erkennt Saguaro, dass Dorlanay zusammenfährt und die Augen aller auf dem Herdenboss liegen.
»Das deine Antwort«, sagt der Indianer grimmig. »Ich nicht lesen können Zettel, aber Trevor dir hat geschrieben bestimmt Warnung. Nun …, was …«
In diesem Augenblick kommt Steingesicht Byrd von der Seite auf das Feuer zu und bleibt ruckhaft stehen. Dann redet er mit Dorlanay, der wild mit beiden Händen fuchtelt und die anderen Männer anspricht. Diese nun wieder deuten auf die Hügelseite, strecken die Hände aus und reden aufgeregt.
Dorlanay fährt herum, packt Steingesicht Byrd an der Schulter und redet wild und gestikulierend auf Byrd ein. Der nickt zweimal kurz.
Und dann dreht sich Byrd um, steckt zwei Finger in den Mund und pfeift. Einer der Männer kommt von hinten angerannt, bringt Byrds Pferd mit und hält ihm den Steigbügel.
Jetzt schwingt sich der kleine Mann auf sein Pferd. Er hat den Hund an der Leine, einem langen Strick, an dem der Hund heftig zerrt.
Byrd reitet an. Ein halbes Dutzend Männer folgt ihm jetzt auf die Hügelseite hin. Sie nähern sich alle Saguaro, der langsam auf sein Pferd steigt, den Schimmel kurz an der Longe packt und immer noch hält.
»Nicht einholen, dazu zu schlechte Pferde«, sagt Saguaro halb höhnisch. »Finden Spur, kommen. Ah, was jetzt – er lassen Hund frei. Hund kommen schnell – laufen voraus, sein sehr schnell. Nun …«
Saguaro hat keine Furcht, er lacht nur leise und reißt jetzt seine beiden Pferde herum. Der Hund kann so schnell sein, wie er will, neben einem im vollen Galopp dahinrasenden Pferd hat er keine Chancen.
Der Indianer taucht hinter den Büschen auf, wird von Steingesicht Byrd bemerkt und hört dessen peitschenden scharfen Ruf: »Fass ihn, Dingo – fass ihn! Fass!«
Dann gibt Saguaro seinem Pferd die Hacken. Der Gaul stürmt los, der Schimmel rast an seiner Seite dahin. Hinter ihm schießt man nicht. Die Herde ist zu nahe, es ist zu gefährlich für die Männer.
Saguaro sieht sich um. Byrd, ein lachhaft kleiner Mann gegenüber dem großen Gaul, kommt ihm auf seinem Pferd nach. Aber die Entfernung wird nicht kleiner, die beiden Pferde Saguaros sind eben schneller.
Nur der Hund – wo ist der Wolfshund?
Saguaro sieht sich um, aber er kann den Hund in dem hohen Gras nicht erblicken. Hinter ihm brüllt Byrd wieder, dass der Hund ihn fassen solle, aber Saguaro lächelt nur grimmig. Der Hund kann nie so schnell wie ein gutes Pferd sein.
Nach vorn gebeugt, sich locker im Sattel machend, so jagt Saguaro nach Süden. Der Abstand zwischen ihm und Byrd vergrößert sich immer mehr. Keine Meile ist er gejagt, als er schon vierhundert, beinahe fünfhundert Schritt von Byrd entfernt ist. Aber wo ist der Hund?
Saguaro sieht sich um. Ist dort nicht eine leichte Bewegung im Gras, teilen sich dort nicht die Halme, kommt dort nicht im schwachen Licht des Mondes, der sich hinter einigen Wolkenschleiern versteckt, ein Schatten?
Der Indianer lenkt seine beiden Pferde leicht nach links und kommt nun über einen breiten trockenen Streifen ohne Grasbestand. Hier führt zur Regenzeit ein Nebenarm des Blue River Wasser.
Jetzt ist das Gelände trocken, eine Bodensenke, in der kaum etwas wächst. Nur Geröll, einige Rinnen im Boden. Saguaro fegt darüber hinweg, sieht sich wieder um.
Sechzig Schritt hinter ihm – großer Gott, da ist der Hund, diese Bestie. Sie läuft schneller als ein Pferd – sie läuft ja schneller!
Der Wolfshund kommt, ein federnder lang gestreckter Körper, der durch die winzigen Stauden des Fettholzes jagt, jetzt schon an der anderen Seite ist. Auf diesem Boden ist der Hund noch schneller als im Gras. Er kommt schnell heran.
Und nun weiß Saguaro auch, warum es Byrd nicht eilig zu haben braucht. Sein Hund wird die Arbeit tun, der Hund ist auf Menschen abgerichtet.
»Damnato«, zischt Saguaro zwischen den Zähnen. »Bestie, ich werde dir …«
Weiter kommt er nicht.
Irgendwo in diesem Boden ist eine Rinne, ziemlich tief, von Gras überwachsen. Das Pferd Saguaros stürmt über die Grasfläche am anderen Ende der Bodensenke und tritt mit dem linken Vorderhuf jäh in die Rinne hinein.
Saguaro aber blickt nach hinten und hat in dem Augenblick, in dem er die Schnelligkeit des Wolfshundes erkennen muss, auf die anderen Dinge – seinen Sitz, die Haltung seiner Beine und die Richtung – nicht genau geachtet.
Das Pferd tritt in das Loch, kommt mit dem krachenden Fall eines Blitzes, mit dieser verheerenden Geschwindigkeit über den Hals und überschlägt sich.
Der Indianer fliegt im Bogen davon, ehe ihm überhaupt zu Bewusstsein kommt, was dort eigentlich geschieht, warum der Himmel plötzlich unten und der Boden über ihm ist.
Er dreht sich in der Luft, er verliert seinen Revolver beim Fall, der ihn mit hartem Anprall auf einen Busch schleudert.
Sein Pferd kommt wieder hoch, aber da ist schon der Hund!
Der Hund kommt, diese Bestie, mit Zähnen, so lang wie ein Finger, gekrümmt und bereit, zuzubeißen.
Es ist der Augenblick von wenigen Sekunden, der Saguaro die halbe Besinnungslosigkeit bringt, der ihn krachend aufprallen lässt.
Aber das Bewusstsein ist doch da, jenes Wissen: Der Hund kommt, der verdammte Wolfsbastard!
Saguaro rollt sich herum, seine Hand zuckt nach unten. Er kommt auf die Knie, aber er hört im gleichen Augenblick das wilde Knurren hinter sich und wirft sich wieder platt hin. Es ist eine Reflexbewegung, die den Indianer durchzuckt, der oft genug auf die Pumajagd gegangen ist.
Saguaro wirft sich flach hin und sieht nach hinten.
Er erkennt nur einen Schatten, der in der Luft schwebt und über ihn hinwegzuschießen scheint.
Und da reißt Saguaro die rechte Hand mit dem Messer hoch. Er spürt den Widerstand an der Klinge. Das Heft wird ihm um ein Haar aus der Hand gerissen.
Über ihm ist das grässliche Heulen des Wolfsbastardes, der dicht vor ihm landet und sich mit aufgerissener Schnauze und funkelnden Augen herumwirft.
Ein Körper, der einer gespannten Sehne gleicht, einer Feder, die sich blitzartig krümmt und dann aufschnellt.
Saguaro hat den flachschnauzigen hässlichen Kopf des Wolfshundes direkt vor sich. Der Kopf schießt vor. Er sieht nur die mörderischen Augen und den weit offenen Rachen mit den schrecklichen Zähnen.
Der Kopf zielt nach seinem Hals, aber der Indianer weiß, was der Hund zu tun beabsichtigt. Er reißt genauso schnell seinen linken Arm nach und stößt ihn mit geballter Faust vorwärts, mitten in den Rachen hinein.
Der Wolfsbastard stößt ein fürchterliches Knurren aus, beißt zu, kann nicht seine Muskeln gebrauchen und heult mit zugestoßenem Rachen.
Saguaro weiß gar nicht, wie schnell er sein Messer hoch hat und es herunterjagt. Die breite Klinge funkelt grell im Mondlicht auf, der Schmerz zuckt durch Saguaros linke Hand bis hinauf in die Schulter.
Mondlicht geistert über das Gras, schießt durch die Zweige der Büsche. Das Messer jagt hoch und herunter.
Saguaro merkt, dass der Wolfsbastard nach hinten die Läufe einstemmt und weg will. Er wirft sich nach vorn, begräbt den Wolf unter sich.
Stiefel scharren über das Gras, der Boden reißt auf, der Wolf knurrt und das Messer funkelt wieder.
Saguaro keucht schwer, zieht seinen linken Arm an sich, aber die Hand will sich nicht lösen. Er packt mit der rechten Hand zu und reißt die Schnauze auf und seine Hand zurück.
Und dann friert ihn, friert ihn fürchterlich. Es ist, als wenn eine kalte Welle nach der anderen über seinen Rücken rieselte. Diese Wolfsbestie, da liegt sie. Was für ein fürchterliches Tier, welches Ungeheuer, dressiert auf den Mann. Von dieser Sekunde an wird er Angst haben … Angst vor jedem Hund, selbst vor denen, die ihm kaum bis an die Knie reichen.
Das Gras ist zerwühlt, die Wolfsbestie liegt still auf der Seite und Saguaro kommt hoch, sieht sich mit flackernden Augen um.
Da – da kommt der Hufschlag, dort kommt Hufgetrommel und die gellende Stimme von Steingesicht Byrd: »Dingo – Dingo, wo bist du? Dingo, fass!«
Saguaro duckt sich, rennt zu seinem Pferd, reißt das Gewehr aus dem Sattelschuh und weiß, dass Byrd in der Senke ist und jeden Augenblick auftauchen kann.
Er dreht sich keuchend herum. Der Schmerz in seiner linken Hand ist fürchterlich, aber er kann das Gewehr gut halten.
Wo ist er, dieser Menschenjäger, der seinen Hund auf Menschen hetzt, wo? Dann sieht er ihn kommen, einen kleinen hässlichen Mann auf einem zu großen Pferd.
Das Gewehr fährt etwas zur Seite, aber da erkennt auch Byrd den Mann, der zwischen den beiden Pferden mit angeschlagenem Gewehr steht.
Saguaro hat Byrd genau vor dem Lauf. Saguaro will ihn haben, will diesen verrückten bösartigen kleinen Zwerg erwischen.
Und dann drückt Saguaro ab.
Das Gewehr kracht, doch Byrd zieht sein Pferd hoch und will es wenden.
In dieser Sekunde trifft die Kugel das Pferd und nicht den kleinen bösartigen Byrd. Die Kugel lässt das Pferd seine Drehung nicht mehr ausführen, sie packt den Gaul, der zusammenrutscht und Byrd nach hinten abgleiten lässt.
Der Schatten seines eigenen Pferdes ragt über dem kleinen Byrd auf, dessen Steingesicht, eine Maske, die viele erschreckt hat, wenn er ihnen gegenübergetreten ist, sich zu einer furchtsamen Fratze verzieht. Byrd stößt sich mit Händen und Füßen zugleich ab, aber da trifft ihn irgendetwas am Kopf. Er sieht eine Riesensonne, die in der Luft schwebt und landet unter seinem Pferd.
»Weg«, sagt Saguaro keuchend und zieht sich hastig in den Sattel. »Noch mehr kommen – immer mehr kommen und wollen fangen, Hund tot, Byrd liegen unter Pferd, was? Auch gut! Jetzt weg, schnell weg!«
Der Schmerz reißt ihm fast den Arm aus, als er das Sattelhorn packt und sich in den Sattel schwingt. Dann geht sein Pferd wieder an. Es humpelt leicht, steigert sich aber gleich zum Galopp. Es ist schnell genug, um Saguaro die Verfolger weit genug vom Hals zu halten, die von hinten heranspreschen und ihm einige harmlose Kugeln nachschicken.
Der Indianer kauert im Sattel, betrachtet seine linke Hand und reißt ein Stück Tuch aus seiner Satteltasche.
Mit dem Tuch wischt er das Blut ab, nimmt dann sein Messer, ein kleines Klappmesser, das eine haarscharfe Klinge besitzt, aus der Tasche und streift die Klinge am Tuch sauber. Eine Meile weiter hält er auf einer Hügelkuppe an, blickt sich um und starrt zurück.
Sie kommen ihm nicht mehr nach. Sie haben den Wolfsbastard gefunden und genug zu tun, um Byrd unter dem Pferd herauszuziehen. Saguaro hat keine Ahnung, dass Byrd nicht unter dem Pferd liegt, aber er sieht keine Verfolger und starrt auf seine vier Bissstellen an der Hand. Dann beißt er die Zähne zusammen, nimmt die Klinge und presst seine linke Hand auf das Sattelhorn.
Er denkt einen Augenblick daran, dass jeder Indianer so tapfer zu sein hat, keinen Schmerz zu zeigen, scheinbar niemals welchen zu spüren. Und er weiß, dass es nicht wahr ist. Dann hebt er entschlossen die Klinge an und drückt sie vorwärts. Er fällt beinahe vor Übelkeit vom Pferd, doch er muss die Wunden bis auf den Grund erfassen und aussaugen können.
Wenn er an den Wolfsbastard denkt, dann zuckt er jedes Mal zusammen und schließt die Augen. Er wird den aufgerissenen Rachen und die fürchterlichen Augen niemals vergessen können, das weiß er nun endlich. Er wird manchmal in der Nacht hochfahren und sich wild umsehen. Und es wird kein Hund neben ihm sein. Der Traum nur, der wird bleiben.
Der Indianer jagt nach Süden, dem Morgenrot entgegen.
Er hat einen Todfeind von dieser Sekunde an, einen Feind, der nichts auf der Welt jemals lieben konnte – nur Tiere. Dieser kleine bösartige Mann hat nicht nur sein Pferd verloren, er besitzt nun auch keinen Hund mehr, der ihm die Hand leckt.
Jetzt hat Saguaro in diesem Mann einen Todfeind. Byrd wird nicht eher Ruhe geben, bis er sich gerächt hat.
Am Ende des Weges sehen sie sich wieder.
Und wer stirbt dann?
*
Peitschen knallen in den grauen Tag hinein, die Rinder wälzen sich zu einem Halbkreis gegen den nächsten Hügel im Osten, genau in das blutrote Morgenrot hinein.
Die Herde zieht.
Der Staub steigt auf.
Er legt sich auf den Tau an den Gräsern und macht ihn blind.
Die Herde zieht dem Red River zu. Slim Dorlanays Tücke hat sie zwar aufgehalten, aber nicht am Weiterziehen hindern können.
Schon wallt der Staub zu einer langen flatternden Fahne. Der Morgenwind kommt, zerreißt die Schleier. Die Sonne steigt über den Horizont und überschüttet die Masse der Rinder mit ihrem Licht.
Trevor jagt zur Remuda nach links hinaus, sieht Saguaro fragend an und deutet kurz gegen den Wind.
»Ja, gut, ziehen andere Seite. Keine Angst, wir beide hier es schaffen, Boss!«
Trotzdem reitet Trevor weiter, stößt dann auf Suzanne, die den Hut im Nacken hängen hat, und lächelt leicht.
»Nun, Lady, geht es?«
»Sicher, Trevor, sicher. Was für ein prächtiger Morgen!«
»Ja«, sagt er kurz. »Ich reite voraus. Hoh, treibt sie, treibt sie!«
Er bleibt an der Remuda, bis sie drüben sind und die andere Seite der Herde erreicht haben. Hier läuft die Remuda, sichtbar für jeden an der staubfreien Seite.
Dann erst jagt Trevor los, kommt zu Jerry Anderson an die Spitze der Herde und sagt scharf: »Treibe den Bullen an, Jerry. Wir werden einen kleinen Weg bis an den Red River machen. Richte dich darauf ein. Ich sehe mich vorn um und bin gegen Mittag wieder zurück.«
Bald kreuzt Trevor den Iron Creek. Hier steigt das Gelände noch an, um dann auf den Red River zu, innerhalb von drei Meilen um hundertfünfzig Fuß abzufallen. Vor ihm öffnet sich der steile Durchlass zwischen den Hügeln, der zum Red River führt. Dort ist der Bach, der jetzt ein kaum drei Fuß breites Rinnsal bildet. Es hat in diesem Jahr früh angefangen zu regnen und dann zu schnell aufgehört. Es ist nicht viel Wasser in den Bächen und Flüssen, aber immerhin die beste Zeit zu einem Trail.
Die Hügel liegen unter der sengenden Sonnenlast, das Gras ist hart und beinahe schon verwelkt. In der Höhe der beiden Talerhebungen steht auf den Kämmen das Buschwerk, noch staubig von Slim Dorlanays Herde, die wenige Tage vorher hier durchgezogen ist. Spuren sind hier nicht mehr zu finden, der Boden ist von siebentausend Rindern zerstampft worden.
»Das ist weit genug«, sagt sich Trevor Joslyn, als er am Ende der fast zwei Meilen langen Talsenke ankommt. »Noch auf die Hügel rechts, dann sehe ich den weiten Weg zum River. Die Sicht ist gut genug.«
Er reitet hinauf, wirft einen Blick nach Norden und sieht in der Ferne in einer leichten Dunstschicht den Fluss blinken.
Er kann fast zehn Meilen weit von hier oben sehen, dreht schließlich und jagt noch auf die andere Höhe links. Auch dort ist nichts zu sehen. Lediglich weit hinten am Fluss steigt Rauch auf. Dort liegt Colberts Ferry. Sonst gibt es hier kaum eine Ansiedlung. Weiter rechts die Indianer-Post, einige Siedlerstellen – das ist alles. Sonst ist nichts zu sehen. Das Land scheint leer zu sein.
Trevor dreht nun endgültig um und schlägt den Rückweg ein.
Er jagt durch die Schlucht zurück, blickt sich noch einmal um und drückt seinem Schimmel dann die Hacken an.
Vielleicht sollte er nicht so schnell davonreiten und besser die Augen aufhalten.
Hinter ihm, knapp unterhalb der Buschreihe auf dem linken Talrand, den er vor weniger als drei Minuten verlassen hat, taucht ein Mann auf und sieht ihm starr nach. Der Mann bleibt auf dem Bauch liegen, duckt sich leicht, als Trevor Joslyn noch einmal nach hinten blickt und sagt, als sich unter ihm jemand räuspert: »Bei so vielen Spuren findet nicht einmal dein verdammter Indianer eine frische Spur, Byrd. He, Byrd, hörst du nicht?«
Er wendet den Kopf. Sein roter Bart zuckt einmal, als er beinahe verächtlich auf den kleinen Mann blickt, der wie eine Statue auf einem neuen Pferd sitzt.
Im Steingesicht Byrds rührt sich nichts. Der kleine Mann hebt beinahe schläfrig die Lider und blickt Dorlanay aus halb geschlossenen Augen an.
Dorlanays Grinsen erstickt jäh. Der Blick des kleinen Mannes ist so voller Bösartigkeit, dass selbst Slim Dorlanay eine Gänsehaut über den Rücken läuft. Seitdem Byrd wieder bei Bewusstsein ist, hat er nicht mehr als zwanzig Worte gesprochen. Er hat seinen Wolfsbastard begraben und sich schweigsam ein Pferd aus der Remuda genommen. Dass dieser Gaul einem der Männer gehört, das hat ihn nicht eine Sekunde gestört.
Dorlanay erinnert sich, dass der Eigentümer des Pferdes hatte protestieren wollen, und Byrd hatte ihn dann nur mit seinen kalten Augen angesehen. Und dann hatte Byrd ganze sechs Worte geredet – und der Mann hatte zusehen müssen, wie Byrd sich das Pferd genommen hat.
»Das ist jetzt mein Pferd, fertig«, hatte Byrd gesagt. Und das hatte genügt!
»Er hat nichts gemerkt«, sagt Dorlanay spröde. »Hörst du, Byrd, er hat nichts gemerkt.«
»Ja«, erwidert Byrd trocken und ausdruckslos. Mehr sagt er nicht. Aber er greift zu dem Packen, der hinter seinem Sattel aufgeschnallt ist.
Sein bisher ausdrucksloses Steingesicht verändert sich jäh. In seinen kalten Augen taucht ein wilder, bösartiger Funke auf und erlischt wieder. Die Narbe an seiner linken Kinnseite beginnt förmlich zu glühen. Und dann hört er, noch auf den Packen starrend, dessen Umhüllung zum Teil aufgerissen ist – wie Slim heiser sagt: »Es ist knochentrocken. Wir sollten mit der Arbeit anfangen und nicht länger warten. Jemand in der Nähe, Hardkins?«
Hardkins sieht sich um, schüttelt den Kopf und betrachtet dann Byrd. Er sieht den Hass in Byrds Gesicht und die Frucht ist auf einmal da, jene Furcht, die ihn seit dem Augenblick gepackt hält, in der er erfahren hat, dass Trevor Joslyn ablehnte, für Adam Sherburn den Trail zu leiten. Seit dem Tag, an dem sie Bart Tyler trafen, der ihnen gesagt hat: »Tut mir leid, Trevor wird unsere Herde führen«, steckt die Furcht in ihm.
Slims Hass und nun auch Byrds Hass – das ist vielleicht verkehrt, denkt Hardkins, ein Bulle von Mann, der aus dem einfachen Grunde bei Slim ist, weil er auch wie Slim ein Ire ist und sich gern prügelt.
Prügeln, denkt Hardkins, sich ein wenig prügeln und Streit suchen, aber schießen? – Diesmal werden sie schießen. Dieser kleine Bursche Byrd, der bis an den Rand voller Gift steckt, der hasst den Indianer und damit auch Trevor. Jemand hat mir mal gesagt, dass Hass selten klug ist, eher aus Dummheit geboren wird. Verdammt, prügeln – ja, immer, aber auf diese Art? Dafür bringt Trevor Slim um. Und ich hänge mit drin. Oh, verdammte Geschichte!
»Nichts zu sehen«, sagt Hardkins spröde. »Hier ist niemand, Slim.«
»Dann lasst uns anfangen. Sie werden in wenigen Stunden hier sein. Diesmal holt er mich nicht ein, der verdammte Kerl. Nimm deinen Sack, Hardkins, und die Packpferde!«
Ja, denkt Hardkins, es wird ganz einfach sein. Niemand von uns riskiert dabei etwas. Es ist gemein – unendlich gemein. Aber weiß ich eigentlich noch, was gemein ist?
Er sieht sich um und fängt einen Blick aus Byrds kalten Froschaugen auf, ein Blick, der ihm eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Niemand weiß, was Byrd gerade denkt. Und er soll manchmal Gedanken lesen können. Und da sagt Byrd auch schon: »Na, was ist, gefällt es dir nicht, Hardkins?«
»Was – was meinst du?«, fragt Hardkins stockend. »Natürlich gefällt es mir!«
Und dann zieht er die beiden Packpferde heran und schlägt das Segeltuch zurück.
Er sieht die vier Tonnen und die Aufschrift: Danger – Explosives – Powder. Vorsicht – Explosivstoff – Pulver.
Es steht in schwarzen Buchstaben auf den schwarzbraunen Dauben der Tonnen. Hardkins zieht fröstelnd die Schultern zusammen.
*
Die Herde kommt, mit Eddy Swartz an der Spitze, über die Hügelwellen und bringt den Staub mit. Eddy sieht voraus den breiten Einschnitt, durch den der Weg zum Fluss führt.
Sieben, acht Meilen noch.
Sie treiben weiter.
Sie werden auch noch im Mondlicht treiben und über den Red River gehen. Rinder im Fluss, andere, die von hinten kommen und nachdrängen. Sie werden erst auf der anderen Seite halten und dort ihr Abendessen bekommen. Der Wagen ist mit Bill Lawson drüben, der Wagen dort auf der anderen Seite wird sie mit warmem Essen versorgen.
Eddy hat Hunger, richtigen Hunger. Er denkt an ein saftiges Steak, sieht sich nach Trevor um, der hinter ihm nach vorn an die Herde kommt, und sagt heiser. »Mann, habe ich einen Hunger! Meinst du, wir schaffen es in der Dunkelheit über den Fluss zu gehen?«
»Natürlich, Eddy, halte dich hier vorn. Ich will mal nach rechts hinauf!«
Trevor reitet weiter. Sein Pferd hinterlässt eine Staubbahn zum Kamm des Hügels. Von oben blickt Trevor Joslyn nach rechts, doch hier ist niemand. Hinter den Hügeln steckt nichts. Er nimmt sein Pferd herum, jagt auf die linke Seite des Höhenzuges und gewinnt einen Überblick bis weit nach vorn. Kein Mensch ist zu sehen. Niemand ist da, der hier lauern könnte.
Und da dreht Trevor um, prescht zur Remuda und ruft scharf zu Saguaro hinüber: »Saguaro, die Remuda nach vorn! Wir bringen sie zuerst durch das Tal. Los, schneller! Überholen wir die Herde rechts!«
Er schwingt das Lasso aus, sieht die blitzenden Augen von Suzanne Tyler und jagt das Rudel der Ersatzpferde an. Die Pferde jagen rechts an den Rindern vorbei, wirbeln einen Augenblick eine breite Wolke Staub auf und ziehen dann an der Spitze der Herde vorüber.
»Nicht zu wild, Lady, nicht zu wild, nur etwas Abstand halten. So ist es gut. Nur nicht zu sehr jagen, wir wollen sie nicht unnötig laufen lassen – Saguaro, da laufen zwei heraus!«
Saguaro hat die beiden Pferde schon selbst gesehen, prescht im Bogen nach links und schwingt sein Lasso. Die beiden Ausreißer drehen bei und laufen wieder zwischen die anderen.
Jetzt haben sie die Pferde von drei Seiten erfasst. Saguaro ist vorn, während Trevor rechts ist und die Lady sich links hält.
Der Indianer blickt nach vorn, zieht die Luft durch die Nase und wendet leicht den Kopf. Die Sonne steht schon tief. Sie verschwindet im Westen hinter der Hügelkette. Schatten fällt in das Tal, in das nun die Herde kommt. Die Rinder zockeln über die alte Spur von Dorlanays Herde hinweg. Einige wollen zu dem saftigen Gras an den Seiten ausbrechen, aber die Männer passen auf. Lassos kreisen, Peitschen knallen. Die Herde wird zusammengedrückt und zieht wie ein Strom in das Tal hinein.
Saguaro blickt jetzt nach links und nach rechts. Seine Feder, die er ständig am Hut trägt, wippt etwas. Vor ihm ist nichts, der Hügelkamm liegt wie ausgestorben da. Aber die Unruhe steckt plötzlich in dem Indianer.
»Boss – he, Boss!«
»Was ist, Saguaro?«
»Schicken Männer nach Flanken, vielleicht besser, he?«
»Ich reite schon selbst. He, Tonio, komm her und nimm mal die linke Hügelseite. Halte die Augen auf!«
Dann dreht sich Tonio zurück und starrt auf die Büsche drüben. Hat sich dort nicht etwas bewegt?
Da hat sich doch etwas …
Tonio kneift die Augen zusammen und denkt an die tief stehende Sonne, in die er beinahe blicken muss. Er kann nicht viel sehen, denn die Büsche sind mehr als vierhundert Schritt entfernt. Aber da ist etwas gewesen.
Er zaudert noch einen Augenblick, dann reitet er langsam los, sieht nach vorn und schielt doch zur Seite.
Und da ist die Bewegung wieder.
Hinter dem nächsten Kamm, auf dem die Büsche stehen, taucht kurz ein Kopf auf und wieder zurück.
Tonio wird langsamer, hat aber den Hut erkannt und tut so, als wollte er wieder zurück über den Kamm. Dann aber reißt er sein Pferd jäh nach links herum, duckt sich blitzschnell und zieht mit einem Griff seinen Karabiner aus dem Scabbard. Es ist eine schnelle und geübte Bewegung, doch dann erkennt er seinen Fehler. Er kann nicht vom Sattel aus treffen. Der Bursche, wenn er will, schießt ihn ab.
Bei diesem Gedanken sieht Tonio blitzschnell rechts an dem Pferdehals vorbei. Und dann bemerkt er die Wolke dort drüben. Sein Pferd bekommt im gleichen Augenblick einen Schlag und zuckt heftig zusammen. In der nächsten Sekunde bricht der Gaul auch schon aus, jagt nach rechts und stolpert dann plötzlich.
Tonio wirft sich geistesgegenwärtig nach rechts vom Pferd, rollt sich durch das Gras und duckt sich tief. Knapp zehn Schritt weiter kracht sein Pferd zusammen, geht über den Hals zu Boden.
In diesem Augenblick flammt es drüben auf. Rauch steigt blitzschnell auf eine Länge von mehr als fünfzig Meter hoch. Eine Feuerschlange scheint sich über den Kamm des nächsten Hügels zu wälzen. Flammengarben schießen aus dem dürren ausgetrockneten Gras hoch, erfassen die ersten Büsche und treiben ein dunkles Meer von Rauchpilzen über den Hügel. Der Wind kommt und faucht noch in die Flammen hinein, die sich rasend schnell über das zundertrockene Land fressen.
Tonio sieht nichts mehr von dem Mann dort, er hat keine Ahnung, dass jemand aus lauter Furcht, jemanden zu erschießen, zu tief gehalten hat und eigentlich nicht einmal das Pferd richtig treffen wollte.
Es vergehen zwei, drei Sekunden, in denen Tonio aus schreckgeweiteten Augen auf das Feuer starrt und nicht begreifen kann, wie schnell es über den Hang läuft. Jetzt ist die Feuerwand schon sechshundert Schritte lang. Sie wird rasend schnell länger, Gras fliegt drüben hoch, Rauch zieht auf Tonio zu, der sich jäh aufrichtet und zu rennen beginnt. Dabei schießt er aus seinem Karabiner laufend gegen den Himmel, rennt den Hang hoch und sieht dann den Reiter oben angefegt kommen. Er erkennt Trevor, der ihm etwas zubrüllt, dann seinen Arm ausstreckt und genau auf ihn zurast.
Ein Ruck – das Pferd rennt Tonio beinahe um, aber dann fliegt der Vaquero im Bogen hinter Trevor auf das Pferd.
»Feuer«, sagt Tonio keuchend. »Dieser Halunke, ich hatte ihn gewarnt – ich hatte ihn gewarnt. Und das ist seine Antwort. Wer hat geschossen?«
»Ich habe nur einen Hut gesehen«, brüllt Tonio. »Nicht viel mehr als einen Hut, Trevor. Mein Gaul, mein Sattel …«
»Sei froh, wenn du nicht selbst verbrennst. Schnell, zu Saguaro auf den Gaul.«
Er rast mit ihm auf Saguaro zu, sieht nach links und kann in der Höhe des Tales vor ihnen, knapp vor der Senke, die sich zum Red River hin neigt, das Feuer sehen. Dort kommen, fast anderthalb Meilen entfernt, die schwarzen Rauchschwaden auf der ganzen Breite des Tales heran.
Trevor Joslyn lässt Tonio noch auf Saguaros Pferd springen, dann fegt er nach rechts und sieht auch dort nur ein Meer von Rauch und Flammen. Auch rechts brennt das Gras, auch hier läuft mit dem Wind, sich ständig nach den Seiten ausbreitend, eine Feuerwand entlang, die bis weit hinter die Herde reicht.
Auf sie zu kommt das Feuer, Rauchgeruch liegt in der Luft. Schon werden die Rinder unruhig, schon beginnen die ersten Rinder wild zu brüllen.
Er blickt mit zusammengekniffenen Augen auf die heranwogende Flammenwand und reißt sein Pferd herum, prescht an das Ende der Herde zur Remuda und ruft drei Männer an.
»Jagt zum Ende der Remuda und steckt mit Büschen das Gras hinter euch an. Es geht nur nach vorn, nicht nach hinten. Steckt sie an und helft Saguaro! Er weiß schon, was zu tun ist!«
Schon prescht er wieder nach links, stößt jetzt auf Jesse und betrachtet kurz die von vorn kommende Feuerwand. Sie ist keine dreiviertel Meile mehr entfernt und nähert sich schnell. Ein Streifen von vielleicht zweitausend Schritt Breite und unbekannter Länge. Dort kommt niemand durch, der nicht von der Hitze gebraten oder ohnmächtig werden will. Es geht nur links oder rechts, mitten durch die vielleicht hundert Schritt breite Flammenwand.
Um ihn ist das Gebrüll der Rinder.
Er winkt Jesse schnell zu und jagt dann beinahe an die Spitze der brüllend ihren Weg ziehenden Herde. Die Rinder laufen jetzt bereits leicht nach links und entwickeln beinahe ihre volle Schnelligkeit. Das Brüllen und Muhen erfüllt die Luft mit einem unbeschreiblich tosenden und röhrenden Geräusch, in das sich wie ein Wasserfalldonner das Trommeln von tausend Hufen mischt. Die Herde rast nach der linken Seitenwand ans Feuer. Mit der rechten Hand reißt Trevor jetzt einen Busch zu sich heran, steckt ihn an und sieht gleichzeitig den Qualm auch schon bei Jesse aufkommen. Auch dort brennt der Busch, fliegt wieder ins Gras. Trevors Pferd macht einen erschreckten Satz nach vorn, als der Busch sprühend und Funken stiebend ins Gras fällt. Dann kommt auch im Gras eine flackernde schmale Spur auf.
Nun brennt es links und rechts der Herde. Die Rinder haben das Feuer von zwei Seiten, sehen nur Rauch und Flammen und rennen brüllend enger zusammen. Niemand braucht sie jetzt mehr zusammenzuhalten.
Nun läuft die Herde in jenem rasenden unaufhörlichen Galopp, der alles niederwalzen wird, was sich gegen sie stemmen sollte.
Trevor Joslyn sieht nach vorn und schätzt mit wild klopfendem Herzen die Breite der linken Feuerwand ab. Sie mag etwa hundertfünfzig Schritt breit sein, wenn nicht noch schmaler. Noch hat sich das Feuer nicht in die Breite gefressen. Ein Mann, der jetzt die Nerven verliert, der überall nur Feuer sieht, der wird seine Herde auch verlieren. Die Rinder werden sich zerstreuen, werden in einzelnen Gruppen irgendwo den Durchbruch versuchen, wenn das Feuer sie einschließt. Aber hier ist sofort ein Gegenplan, der Erfolg haben kann.
Es ist nicht mehr weit bis auf die Feuerwand zu. Dort kann viel lauern, dort können Indianer sein, die sich aus ihrem Gebiet gewagt haben, dort können weiße Banditen stecken, aber dort kann auch nichts sein, nur ein schmaler Streifen verbrannter Erde, über den die Herde stampfen wird.
Die Männer zerren jetzt an ihren Hüten. Die Halstücher rutschen mehr nach oben. Viele der Männer haben die Handschuhe dabei, andere umwickeln die Hände mit Lappen, so gut es geht.
Die Herde rast auf die Feuerwand zu. Einige der Rinder vorn wollen halten, aber der Druck von hinten ist zu stark, die anderen drängen nach, stoßen nach vorn und schieben alles nieder, was zurück will. Was hinten ist, das hat Feuer vor den Augen und jagt blindlings nach vorn weiter. Es ist selten gelungen, eine wildgewordene Herde aufzuhalten, fast immer rennt eine Herde in Stampede so lange, bis sich ihre Rinder erschöpft haben.
Noch zweihundert Schritt bis auf die Feuerwand zu – hundertfünfzig – hundert.
Die Entfernung schmilzt zusammen, die Rinder kommen – kommen schneller von hinten, als jene vorn zurückdrängen können. Und Trevor ist bis ganz nach vorn aufgerückt und setzt jetzt mit Jesse links der Herdenspitze das Gras in Brand. Der Busch hat kaum noch Flammen, aber es reicht aus. Jetzt ballt sich vorn an der Herde ein Knäuel zusammen, zerplatzt im nächsten Augenblick wie eine Seifenblase. Rinder rennen blindlings in das Feuer hinein, gestoßen, getrieben von denen, die hinter ihnen sind.
»Achtung!«, brüllt Trevor. »Ein paar brechen aus – pass auf! Aber jetzt – Sie sind drin und durch, Mann, durch!«
Dort sackt das Feuer in sich zusammen, dort fallen Funken auf die Rinder, jagen sie noch mehr an. Der erste Schub von vielleicht dreihundert Tieren walzt das Feuer vorn nieder, schafft eine Bahn. Der Wind treibt die Flammen nach links weiter, treibt sie dorthin, wo das Feuer keine Nahrung mehr finden kann. Durch die Gasse wälzt sich der Strom der Leiber, jagen Pferde nach links, setzen sich Reiter wieder an die Flanken der Herde.
Viele sind da, die kaum begreifen, dass sie plötzlich aus der Falle heraus sein sollen, aber sie sind draußen. Nach links zieht eine brüllende, muhende Woge. Reiter pressen sie wieder zusammen, als sie sich auseinanderziehen will.
Dann lassen sie die Rinder laufen, versuchen nicht sie zu halten und schwenken die Spitze nur leicht nach rechts. Es geht wieder auf die Höhenzüge hinter dem Tal zu. Hier fällt das Gelände ab.
Und die Herde rast.
*
Die Jackfork Berge liegen westlich des Kiamichi Flusses. Der Name kommt aus dem Choctaw-Dialekt, denn sie sind hier mitten im Gebiet der Choctaw-Indianer. Hart am Flussrand zieht die Herde nach Nordosten auf die Senke zwischen den Jackfork Bergen und den Kiamichi-Bergen zu. Hinter diesen Bergen liegen wie eine Barriere die Winding Stairs. Und dort erst beginnt das eigentliche Gebiet der Quachitas mit zerklüfteten Schluchten und reißenden Bächen. Von dort ab, wenn sie Fort Smith in Arkansas hinter sich haben, kommen sie dann in die bewohnten Gebiete, in denen es manchmal Ärger mit den Siedlern gibt. Aber schließlich kennt Trevor die meisten und die einflussreichsten dieser Siedler. Es wird kaum Ärger geben können.
Ist es bis zum Red River trocken gewesen, so regnet es jetzt fast unaufhörlich. Ein feiner nieselnder Regen hat sie bereits am Kiamichi gepackt und verstärkt sich von Stunde zu Stunde.
Der Boden ist hier bereits aufgeweicht. Von den Hängen gurgelt das Wasser in den Rinnen zu Tal. Hier und da sind Wasserpfützen, die so groß wie die halbe Herde sind.
Sie reiten jetzt mit acht Mann vorn, haben den Küchenwagen an die Herde geholt und noch rechtzeitig Holz gesammelt, um wenigstens eine warme Mahlzeit kochen zu können.
Die Herde wird schnell getrieben, wenn auch der Dunst keine gute Sicht gibt. Saguaro ist jetzt vorn an der Remuda, denn Indianer haben einige Eigenschaften, die sie alle kennen. Eine Remuda, die einer Herde nachzockelt, verliert ganz plötzlich ein halbes Dutzend Pferde. Die Gäule sind auf einmal einfach nicht mehr da. Und Indianer hat niemand gesehen. Diese Burschen wälzen sich im Schlamm und Dreck, tauchen unter irgendeinem Busch auf, sitzen oder hängen an einem Gaul und verschwinden mit ihm in der nächsten Regenbö. Indianer sind die geschicktesten Pferdediebe, die es jemals gegeben hat. Ihre Tricks sind nicht alle bekannt, und deshalb ist Saguaro vorn, und acht Mann bewachen die Remuda.
Trevor kommt von der Seite durch das aufplatschende Wasser und sagt fluchend: »Hast du mal gesagt, dass eine Herde verdursten kann, Wes? Ersaufen würde jetzt besser passen, Saguaro, keine deiner Freunde in der Nähe?«
»Ich passen auf, aber vielleicht auf einmal eine tauchen neben mir auf und Pferd sein weg, he? Stehlen immer bei schlecht Wetter prima, du glauben. Regen gut, verstehen?«
»Warum soll dieser verdammte Regen gut sein?«
Der Indianer kichert und grinst breit.
»Slim-Stinktier vor uns, eh?«
»Na und?«
»Indianer sehen ihn zuerst, da noch keine Regen, als er kommen hierher vor zwei Tage. Sehen, warten und machen Regen. Dann stehlen Pferde, verstehen?«
»Du bist verrückt! Sie können schließlich keinen Regen zaubern.«
»Choctaw viele Medizin, auch machen Regen, ich sagen! Wetten, sie stehlen alle Pferde?«
»Mensch, woher willst du das wissen?«
»Eben – wissen, so wissen, einfach. Selbst Indianer, ha!«
»Dann würdest du auch Pferde stehlen?«
»Ganz sicher das. Passen auf, er nicht viel weit mehr gekommen. Keine Pferde, keine Ersatzpferde – können nicht schnell treiben. Kommen Strafe allein!«
Die Männer sehen sein breites grinsendes Gesicht und fragen sich, ob er es im Ernst meint oder sie nur foppen will.
Unter den beiden Schutzdächern haben die Männer kleine Feuer angefacht. Der Rauch ist dicht und das Holz feucht, aber man kann sich wenigstens etwas wärmen, denn der Regen ist ziemlich kalt.
Müde hocken die Männer da, löffeln die Suppe, trinken den heißen Kaffee in kleinen Schlucken und hören die Rinder muhen.
Irgendwo platschen Schritte durch den Schlamm, ein Pferd wiehert, an der Herde tauchen aus dem Dunst einige Schatten auf und verschwinden wieder, um im nächsten Augenblick direkt am Küchenwagen wie aus dem Nichts zu erscheinen.
Der erste Mann, der die Reiter aus der Dunkelheit auftauchen sieht, lässt vor Schreck beinahe seinen Teller fallen und sperrt den Mund auf.
Es ist Jerry Anderson, der die kleinen struppigen Indianermustangs genau vor sich in dem matten und düsterroten Schein des Feuers kommen sieht.
Jerry erstarrt nach dem ersten Schreck, bewegt dann aber den Fuß und tritt Dexter vor das Schienbein.
»Dexter – da!«
»Was ist – ouh!«
Mit einem Schlag fahren ein halbes Dutzend Männer zusammen und sehen sich um. Vor ihnen sind gut zehn Indianer. Choctaws sind es, die sie schweigend anstarren.
»Trevor! Trevor – Indianer!«
»Was? Wo? – Ah, wenigstens sind sie nicht heimlich gekommen. – Saguaro, komm her, deine Freunde sind da!«
Da kommt auch schon Saguaro durch eine Pfütze gewatet, nähert sich den Choctaws von der Seite und beginnt dann zu reden.
Er spricht so schnell, dass selbst Trevor, der immerhin einige Brocken der Indianersprache kennt, nichts versteht.
Das halbe Camp läuft zusammen, die Männer sehen unter ihren Decken, mit denen sie im Regen stehen, wie vermummte Geister aus, die sich um die Indianer scharen.
»Bleibt bei der Remuda und passt an der Herde scharf auf«, brummt Trevor zu Wes hin. »Weiß der Teufel, die Kerle reden so schnell, dass ich kaum etwas verstehen kann. Vielleicht ist das nur ein Ablenkungsmanöver, während ihre Brüder in der Zwischenzeit einige Rinder und Pferde klauen. Geh schnell, halte die Augen auf. Du auch, Eddy. Nimm Jesse mit!«
Die Indianer stehen barhäuptig, die Decken um die Schultern, im Regen und palavern mit Saguaro.
»He, Saguaro, was reden sie da von Rindern?«, fragt Trevor schließlich. »Sage schon was.«
Die meisten Männer essen nicht mehr. Hier und da ist eine Hand unter den Decken verschwunden und liegt am Revolverkolben. Man weiß nie, was die Indianer gerade vorhaben.
Saguaro schnattert lustig weiter und nickt Trevor nur einmal kurz zu. Ein Zeichen mit der Hand – Trevor möchte warten.
»Trevor, verstehst du was?«, fragt Tonio heiser. »Was wollen sie von uns?«
»Sicher das, was sie immer wollen. Sie reden da von hundertvierzig Rindern, das habe ich verstanden. Die sind wohl verrückt, was? Hundertvierzig Rinder?«
»Was? Sie können hundertvierzig Kugeln bekommen«, brummt Jerry Anderson grimmig.
Aber da wendet sich Saguaro schon um, deutete auf Trevor und lässt den größten Roten an sich vorbei. Unter dessen Umhang erscheint die Hand, die Trevor mit der seinen ergreift. Dann schüttelt ihm der Choctaw auf typische Indianerart die Hand, was ungefähr zwei volle Minuten dauert, und sagt: »Ich – Großer Biber – Freund. Geben Rinder!«
»Boss, gehen mit unter Plane, rauchen, er freundlich!«
»Na gut, Saguaro! Ich – Trevor Joslyn, Bruder von Häuptling Scharfes Auge. Kommt mit, Großer Biber, wir werden reden! Freund – gut?«
»Gut, gehen!«
Nach zwei Minuten sitzen sie unter der Plane und tauschen Tabak aus, während Saguaro mit zwei anderen Indianern spricht.
»Boss«, sagt Saguaro schnaufend. »Jetzt gut hören. Indianer sehr böse, weil Ärger mit Slim-Schuft bekommen. Sie haben gesehen seine Herde, fordern wie immer Rinder, aber Slim sie haben geschickt zum Teufel und gedroht, er würden sie totschießen. Die Roten einige Rinder einfach mitnehmen wollten, da er Stevens schießen lassen. Einer der Choctaws ziemlich schwer verletzt und einer angeschossen worden. Boss, es kommen noch besser: Slim-Stinktier hat keinen Preis für Verwundete bezahlt, hat gesagt, sie selbst schuld und er eilig. Er an Maline liegen und Herde verstreut ganz und gar!«
»Was ist das, Saguaro? Seine Herde verstreut? Warum das?«
Der Indianer lächelt hintergründig, verstohlen. Die anderen, die Choctaws, beobachten ihn aufmerksam.
»Einfach gewesen«, sagt Saguaro in seinem Kauderwelsch. »Furt tief, viel Wasser. Versuchen, Rinder auf andere Seite, aber kommen Bäume in Fluss geschwommen, mächtig Verwirrung. Müssen Slim-Schuft fischen heraus, Männer und Rinder paar Meilen weiter. Kommen zurück – Remuda weg. Nur zehn Pferde da, das alles!«
»Und – und wo sind die anderen, he?«
Saguaro grinst noch breiter.
»Wer weiß? Vielleicht weggelaufen? Männer nicht gut aufpassen, laufen Pferde weg. Wer weiß? Können nicht fangen schnell Rinder ein, alle Rinder verlaufen und Männer wenig Pferde. Liegen an Fluss und können nicht rüber. Eine halbe Rinderherde linke Seite Fluss, andere halbe rechte Seite. Viele Wasser. Boss, wir einholen und eher in Sedalia, wetten?«
Die Männer sehen sich alle an und beginnen zu grinsen. Es gibt niemanden, der Slim Dorlanay diese Geschichte nicht gönnt.
Alle Teufel, denkt Trevor, dieser Narr macht sich die Indianer zu Feinden.
Die Burschen haben sicher gewartet, bis er die halbe Herde im Fluss hatte und dann erst haben sie die Bäume auf die Reise ins Wasser geschickt. Und seine Pferde ist er auch los. – Saguaro hat wieder einmal recht behalten!
»Saguaro, frage deine Freunde, wie viel Rinder sie haben wollen.«
Saguaro redet wieder schnell und gestikulierend mit dem Choctawanführer, wendet sich dann um und sagt kurz: »Er sagt, er will hundert Rinder haben!«
»Sage ihm, ich glaube nicht, dass er seine weißen Brüder betrügen will. Aber Choctaws sind weise Männer und große Krieger. Er kann fünfzig haben, mehr nicht!«
Saguaro redet weiter und sagt darauf: »Er sprechen, alle Weiße auch mächtig schlau und nicht hungern lassen rote Brüder Choctaws. Er sagen achtzig Rinder!«
»Sage ihm, er bekommt sechzig, das ist mein letztes Wort! Sage ihm, dass ich weiß, wo die Pferde von Slims Herdenremuda geblieben sind, aber ich will sein Freund sein und nichts gesehen und gehört haben. Sechzig, kein Stück mehr!«
Wieder schnattert Saguaro eine Zeit lang, dann stecken die Choctaws die Köpfe zusammen und sprechen schließlich noch einmal mit Saguaro.
»Boss, er sagen, du sein schlauer Freund. Er wollen keinen Streit und sein zufrieden, wenn du geben sechzig Rinder und eine Gewehr für ihn mit Patronen.«
»Na gut, das kann er haben. Frage ihn, ob man über den Maline kommen kann.«
Der Indianer ist also zufrieden und erwidert auf Saguaros Frage, dass sie vier Tage warten sollen, dann wird es keinen Regen mehr geben und die Furt niedrig genug sein.
»Well, soll er an der Furt warten, dort bekommt er seine Rinder, Saguaro. Was will er?«
»Er sagen, zehn gleich mitnehmen!«
»Soll er haben. Er hat mein Versprechen, dass er die anderen an der Furt bekommt … Verstanden? Geh mit und gib ihm zehn Rinder, aber sage ihm, wenn uns ein Pferd fehlen sollte, dann bekommt er kein Rind, sondern Besuch von den Pferdesoldaten aus Fort Smith!«
Die Indianer beteuern hoch und heilig, dass kein Pferd fehlen wird und ziehen los, um mit ihren zehn Anzahlungsrindern zu verschwinden. Auch Saguaro kommt wieder und meint trocken: »Boss, sie nicht stehlen, haben jetzt Pferde genug. Wir morgen in Dämmerung an Furt, was?«
»Übermorgen Mittag, Saguaro. Wir treiben nicht mehr so scharf weiter. Bist du sicher, dass sie uns nun in Ruhe lassen werden?«
»Ganz sicher, kommen nicht und stehlen. Können alle schlafen beruhigt, Boss!«
Und wirklich erscheinen die Indianer nicht wieder. Die Herde bleibt den ganzen nächsten Tag unbelästigt und trifft auch am folgenden Tag auf keine Indianer.
Erst vier Meilen vor der Furt tauchen sie auf, halten schweigend vor dem Weg, um ihre restlichen Rinder zu holen.
Sie erhalten fünfzig Rinder, verschwinden dann wieder, lassen aber durch Saguaro sagen, dass Slim Dorlanays Herde noch immer nicht wieder ganz gesammelt und aus dem verregneten Camp die Hälfte aller Männer in die Stadtsiedlung bei Fort Smith verschwunden seien.
Der Regen fällt immer noch. Ein grau verhangener Himmel gießt seine Wassermassen auf Menschen und Tiere herunter. Trevor Joslyn holt Wes Turner nach vorn an die Spitze der Herde und deutet voraus.
»Wes«, sagt Trevor düster, »ich werde jetzt zur Furt reiten und mich umsehen. Steht uns die Herde im Weg, dann muss sie weg. Wir wollen durch den Fluss. Du treibst langsam weiter und wartest, was Eddy dir für Nachricht mitbringt. Ich schicke ihn zurück, wenn wir die Furt nicht benutzen können. Tue dann genau das, was ich ihm auftrage. Die Indianer haben das Camp Slims anscheinend Tag und Nacht nicht aus den Augen gelassen. Wie ich die Burschen kenne, haben sie fast alle verstreuten Rinder aufgelesen und sind mit ihnen verschwunden. Saguaro sagt, dass die Hälfte aller Männer von Slim das Camp verlassen haben soll. Was das heißt, brauche ich dir nicht zu sagen.«
»Damned«, erwidert Turner bestürzt. »Wenn seine Mannschaft meutert, dann kommt er nie ans Ziel. Sie werden ihm die Schuld dafür geben, dass ihnen die Remuda und einige Rinder verschwunden sind. Er hat zu hart treiben lassen, weil er uns im Nacken glaubte. Bei dem Sauwetter bekommt jede Mannschaft genug von einem sturen Trailboss von der Sorte Slims. Gut, dann reite, aber nimm besser noch ein paar Männer mit. Wir werden hier schon fertig.«
Er bricht nach wenigen Minuten auf. Sie reiten schweigsam über den feuchten und glitschigen Boden auf die Furt zu.
Jetzt reitet Trevor Joslyn schneller, braucht keine zehn Minuten mehr und stößt dann auf drei Männer, die von rechts mit einigen Rindern auftauchen und sofort ihre Gewehre herunternehmen.
»Langsam«, ruft Trevor sie scharf an. »Brazos, bist du das dort? Hier ist Trevor Joslyn, lasst die Gewehre in Ruhe, Leute!«
Es dauert keine Minute, dann sind sie an den vielleicht zwanzig Rindern und den drei Männern. Der alte Hopkins, der Koch von Adams Weidemannschaft, Brazos Tracy und Joel Blomfield, der Zureiter von Adam Sherburns Ranch, tauchen bei den Rindern auf.
»Hallo, Trevor«, sagt Tracy bitter und sieht zu Boden. »Wir liegen euch im Weg, was? Tut mir leid, aber ich kann unsere Rinder nicht aus dem Weg bekommen, jedenfalls nicht so schnell und ohne Hilfe. Die Männer haben sich einige Laubhütten und Planenzelte gebaut und weigern sich, die Arbeit zu tun. Nur die Stammmannschaft sucht nach versprengten Rindern, die anderen … Tut mir leid, es ist keine böse Absicht, Trevor!«
»Ich glaube dir schon, Tracy, keine Sorge. – Wo ist Slim Dorlanay?«
»Der verfluchte Kerl ist in die Stadt und versucht, die Hälfte der Mannschaft aus den Saloons zu bekommen. Sie haben ihn von hinten niedergeschlagen, als er seine verrückten Befehle gegeben hat und sind dann davon. Dieser Narr, es hat vor drei Tagen begonnen, da wurde er plötzlich verrückt und bekam von Stevens Nachricht, dass ihr bereits über den Red River gewesen seid. Von dieser Stunde an hat er die Rinder jagen lassen. Und dann kamen die Indianer …«
Er seufzt bitter, versucht sich seine Pfeife anzustecken und wirft fluchend den feuchten Tabak weg, der nicht brennen will.
Neben ihm kommt der alte Hopkins von hinten, der Trevor schon seit vielen Jahren kennt und nickt Trevor kurz zu.
»Nun, Matt?«, fragt Trevor düster. »Sieht ziemlich bitter für euch aus, was? Kochst du nicht?«
»Kochen kann ich immer noch, aber wir müssen erst die Rinder finden. Die verdammten Indianer stehlen jedes Rind, das sich verlaufen hat. Ich sage dir, wenn sie schlau sind, dann fallen sie über die Rinder her und stehlen sie alle, aber das werden sie wohl nicht wagen. Dieser verdammte Dorlanay, wir haben nie viel von ihm gehalten, aber seine Verrücktheit ist noch schlimmer, als wir jemals glauben wollten. Trevor, er hat sich eingebildet, dass er schnell genug sei, um aus dem Indianerland heraus zu sein, ehe die roten Burschen sich an die Herde oder die Remuda wagen könnten. Dieser Narr Stevens musste schießen, obwohl wir ihn zurückzuhalten versuchten. Trevor, unsere alte Mannschaft schafft es allein nicht mehr, die angeworbenen Männer haben genug von Slim und seinen Burschen und sind in die Stadt gegangen. Weiß der Teufel, ob sie wiederkommen!«
»Jeder Mann macht mal irgendwann einen Fehler«, brummt Trevor. »Ich habe nicht die Absicht gehabt, euch zu überholen, aber nachdem der Halunke uns vergiften lassen wollte und uns die Prärie ansteckte …«
»Waas?«, macht Tracy bestürzt. »Trevor, was redest du da? Ich glaube, du irrst dich, wie? Von uns hat keiner eine Ahnung. Bist du sicher …«
Trevor erzählt ihm im strömenden Regen die Geschichte. Die drei Männer beginnen wild zu fluchen und verwünschen Slim in die Hölle.
Die Männer blicken Trevor bestürzt an. Jeder von ihnen würde jetzt losreiten und sich Slim Dorlanay kaufen. Es ist nicht einer unter ihnen, der daran zweifelt, dass Trevor Joslyn Slim vor seinen Revolver holen wird.
Blomfield flucht bitter, Hopkins sagt etwas davon, dass ein toter Slim Dorlanay keine Herde mehr leiten könne und Brazos meint bitter, diese Schweinerei sei einfach zu groß, um nicht bestraft zu werden.
»Ich werde mir erst die Furt ansehen«, sagt Trevor zu ihrer Überraschung bitter. »Brazos, geht das Wasser hoch?«
»Da kommt keiner auf die andere Seite, nur schwimmend, an der Seite seines Pferdes, aber Rinder nicht, Trevor. Hör mal, willst du nicht Slim folgen?«
»Ich denke nicht. Reiten wir! Wir helfen euch die Rinder in den Fluss zu schaffen. Los, kommt schon, in drei Stunden ist es dunkel. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch etwas schaffen wollen!«
Er hilft ihnen mit Eddy und Tonio die Rinder zu der Herde am Ufer des Flusses zu bringen, trifft dort die anderen Männer aus Adam Sherburns Herde und betrachtet eine Weile stumm den gurgelnden und rauschenden Fluss. Jeder der Männer hier kennt ihn. Und einige sagen ziemlich deutlich, dass sich Slim Dorlanay zum Teufel scheren und Trevor seine Arbeit tun soll. Aber es ist, als höre Trevor das nicht. Er sieht nur auf den vielleicht zweihundert Schritt breiten Fluss, der den beinahe doppelten Wasserstand erreicht hat.
»Eddy«, meint er dann nach einer ganzen Weile. »Sage hinten Wes Bescheid. Er soll unsere Rinder etwa eine halbe Meile weiter nach Westen an den Maline treiben und warten. Ich suche nach einer Furt. Es hat jetzt keinen Zweck mehr, mit den Rindern durch den Fluss zu gehen. Sage das Wes, erst muss ich eine Furt finden. Tonio, geh mit. Und passt scharf auf, ich traue den Indianern nicht ganz über den Weg.«
»Und – eh, wann bist du zurück?«, fragte Eddy Swartz schnaufend. »Dauert es lange?«
»Ich komme, sobald ich den besten Weg gefunden habe. Macht euch keine Gedanken.«
Er wird auf einmal so sanft und ruhig wie noch nie auf diesem Trail, zieht sein Pferd herum und reitet an.
Trevor Joslyn reitet nach Westen, den Flusslauf hoch. Er verschwindet im Regen und lässt die Männer zurück.
»Hör mal, Tonio«, sagt Brazos Tracy nachdenklich. »Was ist mit Trevor los? Ich kenne ihn noch aus der Zeit, als er auf unserer Ranch den Vormann machte. Da ist er jedem ins Gesicht gesprungen, der irgendeine Gemeinheit getan hat. Und jetzt – der Bursche ist zu ruhig, verdammt zu ruhig. Was sagst du, Joel?«
»Jeder andere würde sich Slim vor den Revolver holen«, meint Blomfield düster. »Trevor hat etwas, aber ich weiß nicht, warum er so ruhig bleibt. Das ist sonst nicht seine Art. Man will seine Männer vergiften und steckt ein Feuer an, um ihn aufzuhalten. Und er schluckt es! Es ist seine Art, all seine Dinge selbst zu erledigen und niemals Hilfe anzunehmen. Eddy, an eurer Stelle würde ich nachsehen, wo er geblieben ist. Und das verdammt schnell!«
»Du meinst«, sagt Eddy Swartz erschrocken, »er könnte in die Stadt reiten und Slim einen Besuch machen? Teufel, er schien mir ganz danach auszusehen. Komm schnell, Tonio, wir sehen besser nach!«
Sie jagen beide der Spur nach, die Trevors Pferd am Ufer hinterlassen hat, aber es dauert keine zehn Minuten, dann endet die Spur urplötzlich an der nächsten Furt.
Eddy und Tonio halten bestürzt an, starren auf das Wasser und auf die Hufeindrücke, die sich am Uferstreifen zum Wasser hin verlieren. Hier ist Trevor Joslyn in den Fluss geritten und auf die andere Seite geschwommen.
»Trevor«, brüllt Eddy in das Gurgeln und Rauschen des Wassers hinein. »Trevor, gib Antwort! – Wo bist du?«
Er bekommt keine Antwort, wechselt einen wilden Blick mit Tonio und treibt dann sein Pferd auf das Wasser zu.
»Tonio, ich sehe drüben nach. Ist er dort nicht am Ufer geblieben, dann ist er unterwegs nach Fort Smith. Warte, ich werde rüberschwimmen!«
Über den Fluss hinweg kann er Tonio undeutlich als Schatten drüben im Dunst stehen sehen, und er brüllt heiser: »Tonio – Tonio, hörst du mich?«
»Ja, was ist?«
»Er ist nach Fort Smith, Tonio! Ab mit dir zur Herde. Sage Wes und den anderen Bescheid. Dieser verdammte Narr, er geht wieder ganz allein auf seinen Mann los und denkt nicht daran, dass Slim Stevens Steingesicht bei sich hat. Schnell, Tonio, bring die anderen nach!«
Tonio reißt den Gaul herum und rast davon. Eddy aber prescht auf der Spur Trevors nach und weiß, dass er Trevors Pferd niemals einholen kann.
*
Sie stehen an der Tür. Stevens macht einen hastigen Schritt und steht dann im Raum.
Dorlanay stößt mit dem Fuß gegen den anderen Flügel und tritt gleichfalls in den Saloon. Seine anderen drei Männer kommen hinter ihm her und bauen sich an der Tür auf.
Im Saloon sitzen über fünfzehn Männer. Einige sind am Tresen, drei, vier hocken an einem Tisch und machen ihren Spaß mit Girls.
Das harte Klappen der Schwingtüren knallt durch den Raum. Der Keeper hinter dem Tresen hebt jäh den Blick an und starrt durch die Rauchschwaden auf die Tür. Er erkennt Slim Dorlanay in einem Augenblick, duckt sich leicht und sagt zischend: »Dorlanay! Passt auf, Jungens!«
Dann sinkt er noch ein Stück tiefer, greift unter den Tresen und nimmt die Schrotflinte mit den abgesägten Läufen aus den beiden Haken. Die Flinte ist ständig geladen. Eine Tatsache, die hier nichts besonderes bedeutet.
Die Männer am Tresen zucken leicht zusammen, drehen sich dann um und blicken finster auf Dorlanay, Stevens und die anderen drei Männer.
Slim Dorlanay blickt die Männer mit einem so grimmigen Gesichtsausdruck an, dass einige zu Boden sehen. Die anderen aber haben sich jetzt von ihrer Überraschung erholt. Jay Chalk, einer der härtesten und wildesten Burschen aus der angeworbenen Mannschaft, der die Meuterei angezettelt hat, nimmt die Hand langsam vom Tresen und denkt eine Sekunde an seine beiden Partner Dalby und Bassett.
Im gleichen Augenblick trifft ihn der wilde harte Blick des rotbärtigen Iren Dorlanay und scheint ihn durchbohren zu wollen.
»Da bist du ja, du Hundesohn«, sagt Dorlanay fauchend und hebt den Revolver mit einem kleinen Ruck ein Stück höher. »Sieh mal einer an. Feiern, was, während die anderen im Regen reiten! Jay, der Spaß ist zu Ende!«
»Sagtest du etwas?«, fragt Chalk kühl und verzieht das Gesicht. »Du irrst dich immer wieder, mein Freund. Das ist dein schlimmster Fehler. Diese Feier geht weiter, das sage ich dir. Du kannst mit Narren auf einen Trail gehen, aber nicht mehr mit uns.«
Slim Dorlanay läuft rot an und kann den Revolver für Sekunden nicht ruhig halten. Dieser Bursche da sagt ihm, dass er ein Nichtskönner sei? Dieser verdammte Meuterer!
»Was …, was hast du gesagt?«, fragt er scharf keuchend. »Du hast dich verpflichtet, die Herde nach Norden zu bringen, ihr alle! Und jetzt wollt ihr nicht mehr? Ihr schlagt euren Trailboss nieder, ihr nachgemachten Kuhtreiber? Es liegt nicht an mir, wenn wir nicht weitergekommen sind – an euch liegt es. Raus hier, sonst mache ich euch Beine. Der Trail geht weiter, verstanden?«
Jay Chalk schüttelt bedächtig den Kopf und blickt ihn spöttisch an.
»Du taugst nichts, Slim«, sagt er dann verächtlich. »Du bist immer ein kleiner Mann gewesen, der sich an einem großen Mann reiben musste, weil er nicht zugeben wollte, dass der andere jünger und besser war.«
Im gleichen Augenblick sieht er die zuckende Hand Slim Dorlanays und will sich noch ducken. Er kennt Slim nicht genug und weiß nicht, dass Slim urplötzlich seine Beherrschung und damit auch seinen Verstand verlieren kann.
»Du schmutziger kleiner …«
Jay Chalk duckt sich jäh, sieht links von sich aus der Hintertür den kleinen Byrd mit seinem grässlichen starren Gesicht auftauchen und hört ihn fauchend sagen: »Nicht – Slim!«
In dieser Sekunde kracht der Revolver in Slim Dorlanays Hand.
Chalk sieht mitten in die Feuerlohe, bekommt den Schlag gegen die rechte Seite und stöhnt einmal heiser. Dann presst er seine linke Hand auf die Wunde, legt die rechte darüber und kippt langsam dem Boden zu.
Slim Dorlanay hat in seiner Wut geschossen.
»Du – du bist ja …«, sagt Jay stammelnd und sieht die Bewegung Dorlanays. »Was …«
Dies ist der Moment, in dem die Tür einmal klappt und Byrd in der Hintertür des Saloon die Hand öffnet.
In Byrds Rücken steckt der Lauf eines Revolvers, und die Stimme von Carter Bassett sagt fauchend, während von vorn Jim Dalby mit einer Schrotflinte durch die Tür kommt und sie Slim in den Rücken drückt: »Lasst fallen, sonst sterbt ihr beide auf dem Fleck. Lasst fallen, schnell!«
Er kann Jay nicht sehen, aber er hat den Schuss gehört und blickt nun über Byrds Seite hinweg auf Dalby.
»Weg, die Revolver!«, faucht jetzt auch Dalby. »Slim, du Schuft, er hat nicht zum Revolver greifen wollen, daran denkst du noch in einigen Jahren. Weg mit den Eisen!«
Dorlanay bekommt einen Stoß, fliegt drei Schritte nach vorn und landet reglos am Boden.
»Well«, meint Dalby grimmig. »Tut uns leid, Jay, dass wir jetzt erst kommen konnten, aber sie wollten nicht alle von vorn herein. Byrd ging nach hinten, das hielt uns etwas auf. He, ihr Burschen, durchsucht sie und steckt ihre Waffen in den Sack! Byrd, komm her, Mann – aber versuch nichts, die Flinte geht sonst los!«
Stevens bückt sich fluchend mit einem der Männer. Sie schleifen den schweren Slim Dorlanay nach draußen und heben ihn auf sein Pferd. Schweigend sitzt Byrd auf, starrt vor sich hin und tut so, als gehe ihn die ganze Sache nichts an.
Bassett kommt mit einem Leinenbeutel und ihren Waffen, hebt den Beutel einem der Männer entgegen und tritt dann mit gezogenem Revolver zurück. Jetzt stehen alle Meuterer auf dem Vorbau und sehen zu, wie die Gruppe anreitet. Stevens muss den stöhnenden, aber nicht aufwachenden Slim halten, reitet nur ein Stück bis zum nächsten Saloon und steigt dort wieder ab.
»Kommt«, sagt er finster. »Wir tragen ihn hinein. Dieser verdammte Dalby mit seiner Schrotflinte! Komm schon, fass an, Luke!«
Es dauert keine drei Minuten, dann kauert Slim Dorlanay auf einem Stuhl, wird mit Gewalt von Stevens munter gemacht und blickt verstört um sich.
»Was – was ist passiert?«
»Du bist fertig, sie wollen nicht mehr. Sei froh, wenn sich nicht der Sheriff um dich zu kümmern beginnt«, erwiderte Stevens bitter. »Wie konntest du Narr auf Jay schießen? Es sind Zeugen genug da, die alles beschwören werden. Werde schon richtig munter! Du bist fertig, Slim, niemand wird dir mehr gehorchen wollen. Du wirst auch keine Mannschaft mehr zusammenbekommen. Wach auf, Mann!«
Slim Dorlanay wacht wirklich auf, sieht sich aus flackernden Augen um und begreift dann ganz, was geschehen ist.
»Du bist fertig. Mein Geld – schnell!«
»Du – du willst mich verlassen?«
»Genau das! Ich werde es wie Hardkins machen! Das Geld, Slim!«
Er zieht seinen rechten Revolver und sieht Stevens kurz an, aber auch Stevens greift nicht ein. Ächzend holt Slim das Geld aus der Tasche, zählt Byrd seinen Anteil hin und schiebt es ihm zu.
»Da, nimm«, sagt er keuchend. »Nimm – und fahr zur Hölle damit. Ich bin noch lange nicht fertig mit ihnen, ich bin noch lange nicht …«
»Fertig, das bist du!«
Er steckt das Geld mit der linken Hand ein, hält in der rechten seinen Revolver und geht langsam rückwärts aus der Tür.
Slim Dorlanay aber sitzt da und stiert auf die sich leise bewegenden Flügel der Schwingtür. Er hört die Schritte auf dem Vorbau, dann das Janken des Sattels und die Hufe im Schlamm patschen. In seinem Kopf breitet sich eine Leere aus, die ihn zu einem erstarrten Abbild eines Narren werden lässt. Er sitzt da und lässt seine Unterlippe hängen. Draußen reitet Byrd davon, der Mann, der nie ganz zu durchschauen und der doch sein schnellster Mann gewesen ist. Byrd lässt ihn sitzen!
Steingesicht Byrd blickt sich nicht mehr um, er reitet die Straße hoch. Seine Maske ist starr wie immer. Regen peitscht in sein Gesicht, aber er merkt es kaum. Byrd denkt wieder an seinen Wolfsbastard.
Dann schrickt er zusammen. Er hört den Hufschlag eines Pferdes und sieht, ehe er nach rechts in die Gasse einbiegt, den Schatten eines Reiters auf einem Schimmel.
Steingesicht Byrd wird jäh hellwach, treibt sein Pferd scharf an die Hauswand und sieht sich um. Im nächsten Moment erkennt er auch schon Trevor Joslyn, der nun sein Pferd zurückhält und langsamer wird. Jetzt muss er die fünf Pferde am Vorbau des Saloons sehen.
Trevor treibt seinen Schimmel hart nach links, denn er hat Slims Pferd ausgemacht.
»Sieh einer an«, sagt Byrd, ohne groß die Lippen zu bewegen. »Ist es schon so weit, dass Freund Slim ersticken muss? Nun, wer immer lebend aus dem Saloon kommen mag – wird es Trevor sein, dann werde ich auf ihn warten!«
Trevor geht mitten auf der verschlammten Fahrbahn weiter und kommt vor den Saloon. Langsam greift er zum Hals hoch, löst die Schnur seines Ölumhanges und nimmt den Hut ab.
Und wieder sagt Byrd, als er erkennen muss, dass Trevor seinen Revolver unter den Hut gesteckt hat, um die Patronen nicht feucht werden zu lassen: »Schlau – schlau! Man kann immer noch etwas lernen, denn sicher ist Trevor durch den Fluss geschwommen.«
Einen Augenblick steht Trevor Joslyn still, der Revolver wandert unter seine Achsel.
Dann aber wirft er die Ölhaut hinter sich auf den anderen Gehsteig und dreht sich voll dem Saloon zu.
»Slim komm heraus! Hier ist Trevor Joslyn! Komm heraus, Slim, ich habe mit dir zu reden!«
Seine Stimme schallt laut durch den fauchenden Wind, den klatschenden Regen und bricht sich drüben an den Hauswänden. Die Worte schallen bis zum nächsten Saloon, dringen bis in den Store, das Barbiergeschäft und die Bäckerei.
Aus dem Store sehen blitzschnell drei, vier Männer heraus. Dalby macht die Tür auf, Bassett kommt nach draußen. Hinter ihnen schieben sich die anderen Männer auf den feuchten Vorbau unter das Regendach. Sie sehen den Mann nun alle.
Er steht mitten auf der Straße, der Mann, der seinen Hut leicht in die Stirn gezogen hat und dem der Regen über Rock und Weste peitscht.
»Slim«, ruft Trevor noch einmal heiser, »komm heraus, wenn du kein Feigling sein willst. Slim, komm heraus!«
In diesem Augenblick greift eine Hand von innen über die Kante des einen Schwingtürenflügels hinweg.
Dann geht die Tür auf.
Slim Dorlanay kommt langsam auf den Vorbau.
Er hat seine Jacke offen, tritt zwei Schritt vor und wartet dann auf seine Männer. Sie kommen hinter ihm aus der Tür. Nur Stevens fehlt, das sieht Trevor augenblicklich. Steingesicht Byrd ist auch nicht da.
Eine Sekunde später erkennt er die Bewegung am Tor des Hofes vom Saloon und sieht Stevens dort auftauchen.
»Slim, du weißt, weshalb ich gekommen bin«, sagt Trevor ganz ruhig und gelassen. »Wo ist Byrd?«
»Vor fünf Minuten weggeritten, du Narr«, erwidert Slim bissig. »Das ist sogar die Wahrheit!«
»He, Trevor«, ruft einer der Männer da von rechts. »Ich habe ihn wegreiten sehen, es stimmt. Diesmal lügt er nicht! Damit du es weißt: Wir haben genug von ihm, er taugt nichts.«
»Gut«, erwiderte Joslyn knapp. »Slim, kommst du? Ich warte nicht mehr lange und werde …«
In diesem Moment stößt Stevens das Tor auf und springt mit einem Satz auf die Straße. Eine Bewegung, die Trevor von Slim ablenken soll. Zwar sieht Trevor für eine Sekunde nach Stevens, aber dann bemerkt er aus den Augenwinkeln den Satz, den Slim Dorlanay macht und wendet blitzschnell den Kopf zurück.
Trevor sieht Dorlanay ziehen, duckt sich etwas und greift unter die Achsel. In einer Sekunde erkennt er den Trick Dorlanays, der ihn von sich ablenken wollte, und duckt sich tief ab.
Dorlanays Revolver kommt hoch, doch schießt Slim zu überhastet. Die Kugel jagt keinen halben Schritt vor Trevors linkem Stiefel in den Schlamm der Straße und jagt eine Fontäne Dreck gegen die Beine Trevors.
Jetzt zieht auch Stevens, aber da feuert Trevor schon auf Dorlanay. Der brüllende harte Donner der Schüsse rollt über die Straße hinweg und erwischt Dorlanay mitten in der verzweifelten Rechtsbewegung. Slim will sich zur Seite werfen, als er den Revolver Trevors auf sich gerichtet sieht. Die Kugel, die ihn in der Schulter treffen soll, trifft ihn mitten in der Brust und lässt ihn gegen die anderen drei seiner Männer zurücktaumeln. Er prallt auf zwei von ihnen, hindert sie am Ziehen und sieht dann nichts mehr als einen grauen Vorhang, der sich langsam auf ihn niedersenkt.
Von seiner linken Seite her schießt jetzt Stevens und sieht deutlich, dass Trevor heftig zusammenzuckt.
Joslyns linker Arm bekommt einen harten dumpfen Schlag, wird etwas nach hinten gerissen und bringt den Revolver Trevors, der Dorlanay umfallen sieht, wobei er einen seiner Männer mitreißt.
Trevor begreift kaum, dass der Riese Dorlanay von einem Schuss in die Schulter umfallen soll, aber die Kugel von Stevens erinnert ihn jäh an diesen Mann.
Er nimmt die Hand wieder leicht herum, drückt dann ab und sieht zugleich in Stevens Hand die Feuerwolke aufdonnern. Dicht an seiner rechten Seite vorbei faucht die Kugel. Sie schlägt wenige Schritt hinter ihm in die Wand des nächsten Hauses.
Stevens taumelt drüben gegen das Tor zurück, aber der Torflügel, der von einem Windstoß gepackt wird, schleudert ihn wieder nach vorn. Stevens macht einige taumelnde Schritte, um dann auf die Brust in den Schlamm zu fallen und liegen zu bleiben, Sofort dreht sich Trevor wieder zurück, hebt den Revolver an und sieht den einen Mann seinen Colt zu Boden werfen. Der Mann sagt japsend und voller Furcht: »Hört auf, hört auf! Slim ist tot und Stevens liegt im Straßenschlamm. Hört auf – aufhören! Ich passe, Trevor, ich passe!«
Langsam und etwas benommen, den Schmerz im linken Arm, geht Trevor über die Straße auf Stevens zu. Er behält den Revolver in der Hand und sagt knapp und kalt: »Werft eure Revolver weg, wenn ihr es nicht fortsetzen wollt!«
Die drei Männer oben halten die Hände vom Körper weg und stehen still, während Trevor neben Stevens anhält und ihm den zweiten Revolver nimmt.
»Du hast das Gras angesteckt«, sagt Trevor scharf und zieht Stevens aus dem Schlamm auf den Gehsteig. »Stevens, du und Hardkins, ihr beide seid es gewesen. Nun, Mann, ich werde dich zum Sheriff bringen!«
»Ich sage nichts«, keucht Stevens heiser. »Das beweise mir erst einmal. Ich sage nichts. Lass mich laufen, dann rede ich, aber sonst …«
»In Ordnung, dann rede und verschwinde, aber sieh zu, dass du mich nie wieder triffst und die Hand am Revolver hast, Mann!«
Stevens atmet heftig und presst seine Hand auf seine Schulter. Einige der Männer kommen jetzt und wollen ihn stützen, aber er schüttelt nur matt und ablehnend den Kopf und torkelt allein auf den Vorbau des Saloon zu, auf dem Slim Dorlanay reglos liegt.
»Dieser Narr«, murmelt Stevens dann schwach und lehnt sich ächzend an die Wand. »Ich hätte es wie Byrd machen sollen. Schon Hardkins hat es vorausgesehen und ist ausgestiegen, aber ich Narr musste ja schlauer sein. Trevor, er wollte die Herde nach Sedalia bringen und um jeden Preis vor dir dort zu sein, um sie verkaufen zu können. Hör zu, Mann, er hat sie verkaufen und mit dem erzielten Geld verschwinden wollen. Das ist sein ganzer Plan gewesen!«
Die Männer Dalbys und Bassetts fluchten wild los und werfen bittere Blicke auf Slim Dorlanay, aber der kann sich nicht mehr rechtfertigen.
»Darum also hat er mich mit Gewalt aufhalten wollen«, murmelt Trevor düster. »Er hat wohl Angst gehabt, ich würde ihn bis in die Hölle verfolgen, wenn er Adam betrogen hätte. Und damit hat er es genau richtig gewusst! Tut mir leid, Leute, ihr würdet keinen Cent Traillohn erhalten haben, das wisst ihr wohl jetzt. Ich brauche einige Männer für eine gute Mannschaft, aber gemeutert wird bei mir nicht. Wenn ihr wollt, dann überlegt euch die Sache. Ich denke, ihr kennt mich. Ich brauche euch alle. Vielleicht rechnet ihr euch aus, dass ihr sonst keinen Cent Trailgeld zu erwarten habt!«
Und da sagt hinter ihm, vielleicht sechzig Schritt entfernt, Steingesicht Byrd mit seiner eiskalten und durchdringenden Stimme: »Trevor, mein Freund, du hast etwas vergessen – mich! Komm da herunter, ich warte so lange!«
Die Männer fahren alle zusammen und wenden sich dann um. Sie sehen Steingesicht Byrd an einer der Stützen des Gehsteigdaches lehnen.
»Mischt euch nicht ein«, ruft Trevor. »Byrd, was willst du?«
»Sehen, ob du auch mich schlagen kannst«, antwortet Byrd ruhig. »Die Sache ist für dich noch nicht zu Ende, mein Freund. Einen ganz richtigen, fairen Kampf. Komm herunter!«
»Byrd, dabei kannst du sterben!«
»Es ist meine Sache, wenn ich sterben will. Finde heraus, ob du es schaffen kannst.«
»Trevor, sei kein Narr, er ist unheimlich schnell«, zischt Bassettt scharf. »Trevor, du brauchst nicht zu kämpfen, du bist verwundet.«
»Vielleicht bin ich das, aber Byrd wird dann warten. Ich laufe ihm nicht davon. Er denkt an seinen Hund und sonst nichts! Byrd, ich komme!«
»Das habe ich gewusst!«
Trevor geht langsam vom Gehsteig und sieht Byrd klein und mager heruntersteigen. Auch Byrd kommt jetzt auf die Straße, lässt seine rechte Hand tief hängen und hält dann in etwa dreißig Schritt Entfernung an.
»Du hast deinen Indianer geschickt«, sagt Byrd dann tonlos. »Du hast ihn geschickt, und er hat meinen Hund umgebracht. Ich habe versprochen, mich dafür zu rächen.«
»Dein Hund ist immer eine Bestie gewesen, Byrd!«
»Vielleicht. Aber treu war er. Ein Tier ist besser als zehn Menschen!«
»Nun gut, kann sein. Wenn du es nicht anders haben willst, dann …«
Er hört das Trommeln der Hufe und den gellenden wilden Schrei, der links aus der Gasse kommt und sich an den Häusern bricht.
Und er weiß in dieser Sekunde, dass niemand so schreien kann wie Saguaro.
Der Chihuahuaindianer stößt seinen wilden, fürchterlichen Kriegsschrei aus und rast – Trevor begreift nicht, woher er auf einmal kommt – auf seinem großen Gaul wie der Blitz aus der Gasse heraus.
In derselben Sekunde aber wirbelt auch schon Byrd herum. Und diesmal verzieht sich das Steingesicht zu einer wilden Grimasse. Dann brüllt auch Byrd, als wenn ein Hund zu heulen beginnt und rennt dem Pferd entgegen.
»Byrd, stehen bleiben – stehen bleiben, Byrd!«, brüllt Trevor los, aber der kleine Mann rennt mit unheimlicher Behändigkeit über die Straße, dem Pferd entgegen auf seinen Todfeind los.
»Byrd, halte an, halt!«
Jetzt sieht ihn der Chihuahua und stößt den zweiten gellenden und schrillen Schrei aus.
Saguaro greift jäh nach unten, beugt sich weit über den Hals des Pferdes und sieht jenen Mann vor sich, der ihm den Wolfsbastard auf den Hals gehetzt hat.
Wie der Blitz kommt Saguaros Hand hoch und in ihr funkelt das breite beidseitig geschliffene Messer.
»Ah, du – du knirpsiger Teufel!«
»Du hast meinen Hund umgebracht!«
In dieser Sekunde richtet sich Saguaro auf, das Messer wirbelt durch den Regen los.
Der kleine Mann vor dem großen Pferd duckt sich und schießt. Über ihn hinweg surrt das Messer in den Schlamm, doch die Kugel trifft den Indianer.
Noch ein Krach, und das Pferd Saguaros, dieses große, prächtige Pferd, stellt sich hoch, macht dann einen gewaltigen Satz, als der Indianer ihm die Hacken in die Seite jagt und springt.
»Du – du verdammter Teufel«, sagt der Indianer leise und sieht sein großes Pferd auf den kleinen Mann zufliegen.
»Da, nicht schießen mein Pferd tot!«
Sie sehen es alle und bewegen sich vor lauter Entsetzen nicht. Das Pferd springt genau auf Byrd los, der den Arm hochreißt und schießen will, während er sich wegwerfen möchte.
Das Pferd drückt den Arm des kleinen Mannes mit Gewalt herum, der Schuss kracht und der Gaul geht zu Boden.
Aus dem Sattel fällt Saguaro mitten in den dicken Schlamm und bleibt reglos liegen. Genau zwischen ihm und Byrd liegt das große prächtige Pferd.
Byrd liegt ganz still. Die Kugel aus seinem eigenen Revolver hat ihn getroffen, als das Pferd gegen den Arm gesprungen ist.
Der kleine Mann hat die eine Hand ausgestreckt und sieht seinen großen schrecklichen Wolfsbastard kommen. Das Tier beugt den Hals und leckt ihm die Hand.
Steingesicht Byrd beginnt zu lächeln und weiß nicht, dass es die Wellen jener Pfütze sind, in die er gefallen ist, die ihm über die Hand rinnen.
Er hat seinen Hund bei sich. Und der Hund leckt ihm die Hand.
»Viel treuer als ein Mensch«, flüstert Steingesicht Byrd und lächelt, doch niemand hört ihn reden. »Viel treuer als ein Mensch. Bravo, Dingo – braver Hund!«
Drüben aber, drüben liegt der Indianer und bewegt die Hand. Er sieht auf den Griff seines Messers, der aus dem Schlamm ragt und zieht sich mühsam weiter.
Es wird schwarz vor seinen Augen, ehe er das Messer erreichen kann, doch der letzte Befehl ist an die Muskeln gegangen, er schiebt sich das letzte Stück und hat den Griff in der Hand.
Saguaro sieht den Hund kommen und nach ihm packen. Er hört ihn knurren und will sein Messer heben, doch die Hand ist wie gelähmt.
»Bestie, bringen um, müssen sterben – müssen sterben!«
»Du stirbst nicht – du stirbst nicht, Saguaro. Du bist doch mein bester Freund und Bruder, du stirbst nicht!«
Das ist Trevor, denkt der Indianer, ist Trevor …
Ich, denkt der Rote, ich bin nur ein roter Bastard für viele, aber für ihn … Ist schön, ist schön. Bester Freund und Bruder.
Er macht die Augen auf und sieht Trevors blasses Gesicht über sich.
»Wo – die Bestie – tot, ja?«
»Ja, der Hund ist tot, schon lange, Saguaro. Du stirbst nicht, die Kugel sitzt zu hoch.«
»Mein Bruder, du mein Bruder, ja?«
»Ja, Saguaro, ja!«
»Schön, jetzt Indianer gern sterben!«
Und dann verliert er das Bewusstsein.
Vielleicht ist ein Tier doch nicht treuer als der Mensch?
Aber sicher gibt es wenige unter den Menschen, die wirklich treu sind, so treu wie Saguaro, der Chihuahua.
Sicher wenige.
Und der Kampf ist vorbei!
*
Sie haben noch viele Tage gebraucht, ehe sie Sedalia erreichten. Sie, darunter ist Eddy, der vom Fluss aus die Spur von Trevor genau verfolgt hat, dabei über die Cavanal Berge gemusst hat, wie die Spur nun eben lief. Vielleicht ist Eddy Swartz damals darum langsamer als der Indianer gewesen, der wie ein Wilder und richtiger Roter auf seinem großen Pferd losgefegt ist, alle anderen weit hinter sich gelassen hat.
Sie – das sind sie alle … Wes, Tonio, die Mannschaft Trevors und die von Adam Sherburn. Es hat auch keiner mehr gemeutert, nicht einmal die Gruppe um Dalby und Bassett.
Nicht zuletzt ist noch jemand an der verwaisten Remuda mitgeritten, jemand mit Haaren, die in den Wochen langsam gewachsen waren. Jemand, der dauernd Angst gehabt hat, wenn der große Trevor fort gewesen ist, seinen Trail der Furchtlosen geführt hat.
Nun, schließlich ist die große vereinigte Herde verkauft, und die Männer warten alle im Saloon auf den Boss, denn es verspricht eine mächtige Feier zu werden.
Draußen, aber hinter dem Tor des Saloons, dort kommt eine Lady heraus. Sie hat ein richtiges Kleid an, einen Hut auf dem Kopf und geht langsam dem Mann entgegen, der die Straße heraufmarschiert kommt.
Der Mann sieht diese Lady und zieht kurz den Hut, als er an ihr vorbeigeht. Er erkennt sie nicht, geht beinahe weiter.
Dabei sieht er dann doch noch in ihre Augen und bleibt mit einem Ruck stehen.
»Oh«, sagt Trevor Joslyn beinahe erschrocken. »Lady, du siehst prächtig aus, viel zu prächtig. Du wirst sicher alle Herzen knicken, wenn ich dich so zu der Mannschaft lasse!«
»Oh, Trevor«, murmelt sie und legt ihm die Hand auf den Arm. »Trevor, ich muss dir etwas ins Ohr sagen. Bückst du dich einmal?«
Nun ja, wenn eine Lady etwas zu flüstern hat?
Also bückt er sich und fühlt ihre Hand in seinem Nacken. Und dann sagt sie leise: »Trevor, ich danke dir für alles, dafür, dass du mich mitgenommen hast. Die Herde ist da, Slim gibt es nicht mehr. Ich möchte dir auf meine Art danken. Trevor, aber du musst ganz stillhalten.«
Er hält still, er hält nur zuerst still, dann hebt er sie etwas hoch.
Und Miss Bouldingwater vom Moralistenverein aller Jungfrauen aus Sedalia sagt ein Stück weiter, durch ihr Stielglas starrend: »Unerhört – unerhört! Jetzt küssen sich diese fremden jungen Leute schon mitten auf der Straße!«
Wahrscheinlich gibt es nicht nur eine Miss Bouldingwater auf der Welt, sicher aber viel mehr ›freche junge Leute‹.
Diese frechen jungen Leute kommen mit etwas Verspätung, aber Arm in Arm in den Saloon, in dem es zuerst ganz still wird. Dann aber brüllen hundert Löwen so laut, dass die ganze Stadt davon aufwacht.
Well – und dann haben sie alle gefeiert, das glückliche Ende des Trails, ihre verschiedenen Siege und natürlich Mr Trevor Joslyn und seine zukünftige Frau.
Es muss eine schrecklich mächtige Feier gewesen sein. Den Mut, immer wieder anzufangen, hatten die Burschen alle.
Bestimmt sind sie auch in späteren Jahren noch oft nach Norden gezogen. Vielleicht auch mit Trevor Joslyn.
Und ganz sicher haben sie sich dann alle an ihren ersten gemeinsamen Trail erinnert, an den Trail der Furchtlosen.
- E N D E -