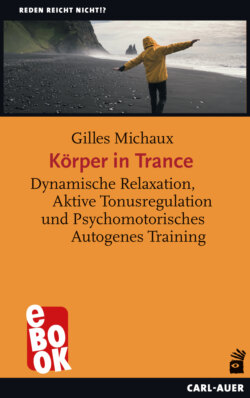Читать книгу Körper in Trance - Gilles Michaux - Страница 8
1 Embodiment, Ideomotorik und Körpertrance
ОглавлениеBereits in den traditionsreichen Ansätzen der Entspannungskultur der asiatischen Versenkungstechniken bilden Körper und Geist eine eng miteinander verwobene Entität, wonach der Körper eine essenzielle Rolle auf dem Weg zur mentalen Beruhigung und Besänftigung spielt, und zwar sowohl auf passiv-statische als auch auf aktiv-dynamische Manier. In diesem Sinne finden sich körperliche Innenschau und Spannungsabfuhr als zentrale Elemente in den Übungen tradierter Entspannungsverfahren wie denen des Yoga, des Tai-Chi und des Qigong wieder (siehe vertiefend Mitzinger 2003 bzw. Scholz 2003). So erkennt auch der Begründer des AT eine deutliche Parallele zwischen der passiven Hinwendung auf neutrale »affektfreie Körpererlebnisse« durch die nach innen gerichtete »Körperschau« des Yoga und seiner sich eben auf diese konzentrierenden und autogenerierenden Entspannungstechnik (Schultz 1932, S. 350 ff.; siehe genauer in Kap. 4). Das Kernprinzip der dynamischen Entspannung des Yoga in Form eines bewussten Einnehmens von und Innehaltens in körperlichen Posituren, den sogenannten Asanas, spiegelt sich tendenziell auch in der Methodik der PR wider, dem kontrollieren Anhalten von muskulärer Spannung. Anders als Schultz distanzierte Jacobson (1963, S. 80; siehe Kap. 7) seine Methode jedoch deutlich vom Yoga, den er aufgrund seiner orientalischen spirituellen Hintergründe als zu mysteriös, sprich »okkult« und somit für Westler nur schwer zugänglich empfand.
Konträr dazu der integrierende Ansatz von Caycedo, dem es mit seiner in den 1960er-Jahren begründeten Dynamischen Relaxation gelang, achtsame Bewegungsübungen aus Tibet, Indien und Japan derart aufzubereiten, dass sie auf leichte, lockere Art und Weise zur psychohygienischen Entspannungsregulation in den westlichen Lebensalltag integrierbar und mit der okzidentalen Weltanschauung vereinbar wurden. Getreu seiner geistigen Wurzeln wählte auch er die Bildersprache für die Bezeichnung seiner Übungspositionen (siehe Kap. 3). Genau wie sich etwa im Yoga die Baumhaltung, die Fisch- und die Kobrapose (siehe Abb. 1) oder im Tai-Chi und Qigong die Bogen- und Kranich-Übungen finden, tragen auch die Übungen der Dynamischen Relaxation bildhafte Namen wie »Marionette« oder »Zielscheibe«. Diese Idee findet sich auch im Psychosomatischen Entspannungstraining (PSE) von Scholz (2001) wieder, dessen Übungen wie etwa die des »Grübelwischers« sich ebenfalls an Tai-Chi und Qigong orientieren. Wollte man eine bewegungsbezogene Metapher verwenden, könnte man auch sagen, dass Caycedo mit seiner Methode »auf den Schultern von Riesen sitzt«. Zu Yoga, Tai-Chi und Qigong liegen mittlerweile vielzählige Wirksamkeitsnachweise in Form von Metaanalysen vor (Pascoe, Thompson a. Ski 2017; Wang et al. 2010; Wang et al. 2013).
Abb. 1: Fischpose im Yoga
Die bildhaften Bezeichnungen dienen dabei nicht nur als schmückendes Beiwerk oder dazu, dass sich die Übungen besser gemerkt werden können; sie verkörpern auch die beim Üben einzunehmende innere Haltung. So kann sich der Yogi oder die Yogini beim Einnehmen der Fischpose der körperlichen Wendigkeit von Fischen im Wasser bewusst werden und somit auf seine Beweglichkeit achten (siehe Abb. 1). Ebenso kann etwa bei der Marionettenübung der Dynamischen Relaxation die Vorstellung, wie sich eine Marionette mit durchgetrennten Fäden hin- und herbewegt, den Fokus auf körperliches Freisein und Loslassen lenken (siehe Kap. 3.1.4.5 und Abb. 22). Wir finden dieses Prinzip auch im spontanen Kinderspiel wieder, wenn diese etwa ein Flugzeug nachahmen und sich dabei mit seitlich ausgestreckten Armen und hin- und herschwingendem Rumpf fortbewegen. Hierin ist bereits das zeitgenössische kognitionswissenschaftliche Konzept des Embodiment, zu Deutsch Verkörperung, vorweggenommen, wonach der körperliche Ausdruck u. a. mentale Einstellungen und Gemütsbewegungen zu modulieren vermag (siehe bspw. Tschacher u. Storch 2012). Auf diese Weise kann bereits eine neutrale, aber selbstbewusst eingenommene Körperhaltung – ähnlich der Berghaltung beim Yoga – Angstzustände mindern (Weineck et al. 2020). Eine Entsprechung zwischen yogischer Körperhaltung und der Aktiven Tonusregulation erkennen Stokvis und Wiesenhütter (1979, S. 178 ff.), indem sie in ihrem Exkurs zur Yogatechnik die Ähnlichkeit zwischen der auch noch als Totenstellung bezeichneten Entspannungslage beim Yoga und der körperlichen Einleitung des Trancezustands, das heißt hypnotischen Bewusstseinszustands, bei ihrer Form der Entspannungshypnose beschreiben – beide gekennzeichnet durch eine totale Erschlaffung der Muskulatur (siehe Abb. 2 und Kap. 5). Hierbei wird der Trancebegriff seiner eigentlichen wie auch übertragenen Bedeutung gerecht, die auf das lateinische Wort transire zurückgeht und so viel meint wie »hinüberschreiten«.
Abb. 2: Entspannungslage im Yoga
Aber nicht nur die Körperhaltung kann auf das Mentale wirken. Umgekehrt üben auch gedankliche Ideen einen Einfluss auf den Körper aus, insbesondere auf das Muskelsystem. Dieser als Ideomotorik bezeichnete Zusammenhang wurde erstmals von dem englischen Physiologen William Carpenter beschrieben. Der nach ihm benannte Carpenter-Effekt kann sehr eindrücklich anhand des Chevreulschen Pendelversuchs gezeigt werden, bei dem die Versuchsperson ein Pendel mit zwei Fingern halten soll, ohne es willkürlich zu bewegen, während ihr von außen suggeriert wird, das Pendel kreise oder bewege sich hin und her.2 Auch ohne absichtsvolle Bewegung seitens der Versuchsperson gerät das Pendel durch die »Ideengabe« von außen in Schwingung. Dieser Effekt ist dabei nicht auf das motorische Nervensystem beschränkt, sondern impliziert gleichermaßen auch das vegetative Nervensystem, was als grundlegender Wirkmechanismus des AT sowie der Aktiven Tonusregulation gilt. Ein anderer Weg zur Beeinflussung des Vegetativums führt über die Atmung und soll im Fokus des folgenden Kapitels stehen, bevor wir uns danach den Einzeldarstellungen der hier im Buch zu besprechenden Methoden widmen.
2 Nach dem französischen Naturwissenschaftler Michel-Eugène Chevreul benannt, der sich gegen spiritualistische Erklärungen dieses Phänomens aussprach. Für detailliertere Anleitungen zur Durchführung siehe Kossak (2013, S. 254 f.).