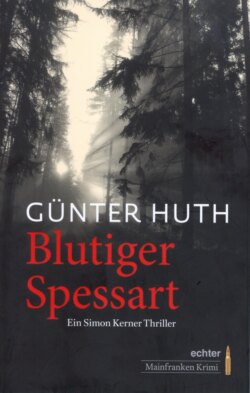Читать книгу Blutiger Spessart - Günter Huth - Страница 8
Оглавление2
Vier Monate später
Der Wetterbericht hatte im Bereich Nordbayern für Sonntag auf Montag einen schweren Sturm vorausgesagt, der mit Windstärken bis 10 vor allen Dingen über Unterfranken hinwegfegen sollte. Das Unwetter sollte von lang andauernden, sintflutähnlichen Regenfällen und starken Gewittern begleitet werden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, möglichst nicht die Häuser zu verlassen und Parkanlagen und Wälder zu meiden.
Der schwer gepanzerte, grüne VW-Bus mit den schussfesten, vergitterten Scheiben verließ am Montagmorgen die Justizvollzugsanstalt Würzburg exakt um 8.00 Uhr. Kaum hatte der Fahrer das schützende Dach über dem Innenhof der Strafanstalt verlassen, musste er die Scheibenwischer auf höchste Leistungsstufe stellen, denn in der Mainmetropole regnete es noch immer in Strömen. Die Vorhersage des Wetterberichts war voll eingetreten. Ständig kamen über Funk Meldungen von den Einsatzkräften der Feuerwehr herein, die die ganze Nacht unterwegs gewesen waren, um umgestürzte Bäume zu entfernen und abgedeckte Dächer zu sichern.
Fluchend wischte Norbert Beckmann, der Beamte, der am Steuer des Gefangenentransporters saß, von innen mit einem Lappen die Frontscheibe frei, die durch den plötzlichen Temperaturunterschied zwischen Außen und Innen schon nach wenigen Metern völlig beschlagen war. Das Gebläse arbeitete lautstark mit höchster Leistung, in dem Bemühen, die Sicht wieder freizumachen. Die Scheibenwischer konnten die Wassermassen kaum bewältigen. Beckmann warf zum wiederholten Male einen prüfenden Blick in den Innenspiegel. Hinter ihm, auf der mittleren Bank des Transporters, saßen mit angespannten Mienen seine Kollegen Martin Bohlender und Dieter Trusch. Zwischen ihnen der Mann, den sie transportieren mussten. Da der eine Beamte Rechts- und der andere Linkshänder war, hatten sie ihre Plätze so gewählt, dass der Mann nicht an ihre Dienstwaffen reichen konnte, die sie am Gürtel trugen. Eine Vorsichtsmaßnahme, die sie bei dem kriminellen Kaliber ihres Fahrgastes für mehr als angebracht hielten.
Beckmann konzentrierte sich wieder auf die Fahrbahn. Es fiel ihm recht schwer, da er heute einen ausgesprochen schlechten Tag hatte. Seine derzeitige private Situation ging ihm nicht aus dem Kopf. Am Wochenende hatte ihm seine Frau Veronika ihre Scheidungspläne eröffnet. Es gärte zwar schon seit längerer Zeit in ihrer Beziehung, aber bisher hatten sie die Schwierigkeiten noch immer irgendwie in den Griff bekommen. Sein Job als Mitglied des Mobilen Einsatzkommandos der Polizei war häufig stressig, mitunter sogar gefährlich und brachte ständig wechselnde Dienstzeiten mit sich. Umstände, die einem Familienleben nicht gerade zuträglich waren, dessen war sich der Polizeibeamte voll bewusst. Doch Norbert Beckmann liebte seinen Beruf und sah in seiner Mitgliedschaft in dieser Spezialeinheit auch die Möglichkeit, schneller Karriere zu machen – was seiner Meinung nach letztlich wieder der Familie zugutekam. Einige Jahre noch, dann würde er sich auf eine führende Position in einem Kommissariat bewerben können, und die Situation würde sich entspannen. Das hatte er seiner Frau schon häufig erklärt, aber darauf wollte Veronika offenbar nicht mehr warten. Sie hatte, wie sie ihm sagte, nicht geheiratet, um dann immer allein zu sein und täglich in der Furcht zu leben, ihr Mann könne im Dienst verletzt werden oder gar ums Leben kommen. Auslöser war wohl der letzte Einsatz gewesen, bei dem sein Kommando einen Drogenhändler über die A7 verfolgt hatte. Ein total zugekiffter Irrer, der mit seinem Mercedes über die Autobahn gerast war und dabei auch noch auf die ihn verfolgenden Einsatzkräfte schoss. Die Autobahn musste gesperrt werden, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Darüber war natürlich im Fernsehen groß und breit berichtet worden, wodurch seine Frau alle Einzelheiten mitbekommen hatte. Letztendlich hatten sie den Kerl geschnappt. Allerdings hatte Beckmann ein leichtes Schleudertrauma davongetragen, als sein Dienstwagen beim Versuch, den Flüchtigen zu stellen, gegen die Leitplanke geprallt war. Das hatte wohl bei seiner Frau das Fass zum Überlaufen gebracht.
Beckmann riss sich mit Gewalt von seinen Gedanken los. Leicht über das Lenkrad gebeugt, starrte er angestrengt durch die Windschutzscheibe. Von dem Wagen, der vor fünfzehn Minuten ihrem Transport vorausgefahren war, war nichts zu sehen. Es handelte sich dabei ebenfalls um einen gepanzerten Gefangenentransporter, in dem sich ein mit Handschellen gefesselter Angeklagter befand. Sie hatten diesem Fahrzeug ausreichend Vorsprung gelassen; somit bestand keine Gefahr, dass sich die beiden Transporte und die darin befindlichen Personen auf dem Weg zum Gericht begegneten.
Als sich der Wagen der ersten Kreuzung mit einer Ampelanlage näherte, schaltete Beckmann das Martinshorn und das Blaulicht ein und fuhr zügig über das Straßenkreuz hinweg. Anlass für einige Autofahrer, wütende Blicke herüberzuwerfen, weil sie plötzlich abbremsen mussten und dazu noch von einer Wasserfontäne getroffen wurden, die der Transporter nach beiden Seiten hochspritzte. Doch Beckmann konnte darauf keine Rücksicht nehmen, er hatte strikte Anweisung, während der Fahrt nicht anzuhalten.
Der Grund für diese strengen Vorsichtsmaßnahmen saß in seinem Fahrzeug. Es handelte sich um den Kronzeugen in dem Strafprozess gegen Francesco Edoardo Emolino, Renato Mallepieri. Er war ebenso wie Emolino deutscher Staatsbürger italienischer Abstammung. Emolino war wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung und Anstiftung zum mehrfachen Mord von der Staatsanwaltschaft vor dem Schwurgericht des Landgerichts Würzburg angeklagt worden. Schon seit geraumer Zeit saß er deswegen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Würzburg. Heute sollte der Prozess gegen ihn beginnen, für den von vornherein mehrere Tage angesetzt worden waren. Mallepieri war dabei der Schlüssel, mit dem die Strafverfolgungsbehörden Emolino endlich knacken wollten. Der Kronzeuge war wie ein Augapfel gehütet worden. Wochen hatte er in einer sicheren Wohnung im Landkreis Würzburg verbracht. Dort hatte man ihn verhört und seine Zeugenaussagen aufgenommen. Eine ganze Gruppe Ermittler der Sondereinheit Spessartblues war für seine Bewachung abgestellt worden, da sein Leben höchst gefährdet war.
Das Verfahren, das in ganz Deutschland für Furore in den Medien sorgte, wurde insgesamt von außerordentlich strengen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Die Justiz rechnete damit, dass von bestimmten Kreisen der Versuch unternommen werden könnte, Emolino zu befreien, und man traf entsprechende Vorsichtsmaßregeln. Zu viel stand für den Angeklagten auf dem Spiel. Immerhin drohte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Aus anderen Gründen, aber in noch viel stärkerem Maße galt diese Bedrohungssituation auch für Mallepieri. Sein Leben war extrem gefährdet, das stand außer Zweifel. Um heute Morgen keine längere Fahrt über Land in Kauf nehmen zu müssen, war Mallepieri gestern am späten Abend in die Justizvollzugsanstalt Würzburg verlegt worden, wo er die Nacht, streng bewacht, in einer Einzelzelle verbrachte.
Fünfzehn Minuten später erreichte das Fahrzeug mit dem Kronzeugen sein Ziel: die Einfahrt zur Tiefgarage des Strafjustizzentrums Würzburg in der Ottostraße. Per Funk überzeugte sich der Fahrer davon, dass das vorausfahrende Fahrzeug mit dem Angeklagten am Ziel angekommen war. Wie man ihm sagte, saß Emolino bereits in einer Wartezelle des Strafjustizzentrums, wo er bis zum Beginn des Prozesses verwahrt wurde. Man konnte also den Kronzeugen in ein gesichertes Zimmer neben dem Schwurgerichtssaal schaffen.
Beckmann schaltete das Sondersignal aus. Langsam rollte er die am Altbau der Würzburger Justiz entlangführende Parkstraße entlang, die zugleich die einzige Zufahrtsstraße zur Tiefgarage des Strafjustizzentrums darstellte. Zwischenzeitlich hatte der Regen deutlich nachgelassen. Die Beamten im Fahrzeug machten sich bereit. Diese Phase, eingesperrt in die sich schluchtartig verengende Zufahrt zur Tiefgarage des Gerichts, war die gefährlichste während des gesamten Gefangenentransports. Hier gab es kein Ausweichen und keine Wendemöglichkeit. Wenn sie erst einmal das schwere Metalltor zur Tiefgarage passiert hatten, waren sie in relativer Sicherheit. Es gab dort reservierte Parkplätze für Polizeifahrzeuge, von denen aus man den Zeugen auf kurzen, sicheren Wegen zum Schwurgerichtssaal bringen konnte.
Die auf grün springende Ampel oberhalb des Tores zeigte an, dass die Zufahrt zur Tiefgarage freigegeben war. Beckmann rollte langsam die Asphaltstraße hinunter, die mit Gefälle zum ferngesteuerten Tor der Garage führte. An der tiefsten Stelle der Einfahrt hatte sich aufgrund des Unwetters ein regelrechter See gebildet. Während sich der Transporter im Schritttempo der Einfahrt näherte, drückte ein Justizwachtmeister, der den Vorgang auf einem Bildschirm in der Zentrale im Gebäude verfolgen konnte, den Schaltknopf, und das Tor bewegte sich knarrend im Schneckentempo nach oben.
Der Mann, der sich hinter den Büschen der angrenzenden Parkanlage versteckte, kniete bereits in der richtigen Position. Er wusste, dass er vom nahen Fußgängerweg nicht gesehen werden konnte. Eine ganze Reihe von Sträuchern gab ihm ausreichend Deckung. Im Übrigen waren bei dem augenblicklichen Regenwetter sowieso nur wenige Menschen unterwegs. Er wischte sich mit dem Ärmel das Wasser aus dem Gesicht. Dass er nass bis auf die Haut war, störte ihn nicht.
Aufs äußerste konzentriert, beobachtete er die Ankunft des zweiten Gefangenentransporters. Er hatte genaue Instruktionen erhalten. Der zweite Wagen war sein Ziel! Das erste Fahrzeug war schon seit einiger Zeit in der Garage verschwunden.
Als der Wagen kurz vor dem Tor zum Stillstand kam, führte er das Abschussrohr an die Schulter, klappte die Zielvorrichtung auf und blickte hindurch. Ruhig visierte er, erfasste das Ziel und betätigte ohne Hast den Auslöser. Dieses russische Modell eines panzerbrechenden Raketenwerfers war kinderleicht zu bedienen und hatte nur einen geringen Rückstoß. Nach hinten einen langen Feuerstrahl ausstoßend, zischte die Rakete aus dem Abschussrohr und raste mit rasch zunehmender Geschwindigkeit auf das rückwärtige Fenster des Polizeifahrzeugs zu. Die vergleichsweise dünne Panzerung des Fahrzeugs war für das Geschoss, das mühelos siebzig Millimeter Stahl eines modernen Panzers durchbrechen konnte, kaum spürbar. Zwischen dem Einschlag in den Transporter und der nachfolgenden Explosion verging keine für Menschen erkennbare Zeitspanne. Nach Sekundenbruchteilen blähte sich das Fahrzeug plötzlich wie ein überdimensionaler Ballon nach außen auf und explodierte in einem enormen Feuerball. Der Druck der Explosion prallte gegen den noch nicht geöffneten Teil des Metalltors der Tiefgarage, traf es mit der Wucht einer gigantischen Faust und verbog es nach innen. Fenster der angrenzenden Gebäude splitterten, und von den in der Nähe stehenden Bäumen brachen Äste herunter. Der Knall und die nachfolgende Druckwelle der Explosion erreichten den Schützen nicht unvorbereitet. Längst lag er auf der Erde und drückte sich fest gegen das nasse Gras. Seine Trommelfelle hatte er durch Gehörschutzkapseln geschützt. Als der Luftdruck schadlos über ihn hinweggegangen war, drehte er sich ohne Hast zur Seite und steckte die Abschussvorrichtung in die unauffällige, längliche Sporttasche zurück, in der er sie auch hertransportiert hatte. Dann erhob er sich und zwängte sich durch die nassen Büsche nach draußen auf den Weg. Er wusste, dass zwischen Explosion und Reaktion der Sicherheitskräfte im Haus einige Zeit vergehen würde. Vermutlich waren im Augenblick alle vom Schock gelähmt. Den Flammen, die in der Schlucht der Zufahrt mehrere Meter hochschlugen, schenkte er nur einen beiläufigen Blick. Das Benzin des Fahrzeugs sorgte für eine tosende Feuerhölle. Er wusste, welch verheerende Auswirkungen diese Waffe hatte. Man konnte sich auf diese Baureihe absolut verlassen. Vorsichtig bewegte er sich über die Glassplitter der im angrenzenden Ziviljustizzentrum geborstenen Fensterscheiben.
Kurze Zeit später verließ ein dunkelblauer Van eine Parkbucht vor dem Gebäude der nahen Universität. In der Ferne hörte der Fahrer Sirenengeheul: Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge. Trotz allem hatten die Verantwortlichen der Justiz offenbar schnell reagiert.
Der Mann fühlte keine besonderen Emotionen. Zu oft hatte er in seinem Leben schon vergleichbare Situationen erlebt. Er war sich sicher, dass es dort nichts mehr zu retten gab. Die Insassen des Fahrzeugs waren in tausend Stücke gerissen worden, die Überreste würden in den Flammen bis zur Unkenntlichkeit verbrennen. Damit war der Job für ihn erledigt. Das Honorar würde in den nächsten Tagen auf seinem Auslandskonto eingehen.
Auf der Talavera, einem großen Parkplatz in der Nähe des Mains, stellte er den gestohlenen Wagen ab. Den Schlüssel ließ er stecken. Mit einem Handgriff aktivierte er den Zeitzünder, der in der kommenden Nacht den Wagen in eine Brandfackel verwandeln würde. Den Zeitpunkt hatte er deshalb gewählt, weil dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine unbeteiligten Menschen gefährdet wurden. Seine Handlungen waren rational gesteuert, seine Motive geschäftlicher Natur. Er tötete nicht zum Vergnügen. Da keine weiteren Todesopfer erforderlich waren, um sein Ziel zu erreichen, würde es auch keine geben. Mit dieser Aktion waren dann alle Spuren, die er möglicherweise hinterlassen hatte, vernichtet. Er stieg aus. Es regnete nicht mehr. Die Sonne kämpfte sich durch die Wolkendecke und begann, seine feuchte Kleidung zu trocken. Er setzte eine Sonnenbrille auf, überquerte ohne Eile den Parkplatz und marschierte wenig später mit seiner Tasche in der Hand in die Zellerau, wo in der Wredestraße ein weiteres Fahrzeug auf ihn wartete. Auch dieses Auto war gestohlen und diente nur dazu, seine Spuren zu verwischen. Irgendwo auf der Strecke zwischen Würzburg und seinem Wohnort würde er dann in sein eigenes Fahrzeug steigen. Dort konnte er auch die noch immer feuchte Kleidung wechseln. Während der Fahrt würde er seine gesamte Ausrüstung an einer passenden Stelle im Main versenken.
Der eine oder andere in seinem Geschäft hielt diese Maßnahmen wahrscheinlich für übertrieben, aber er überließ seine persönliche Sicherheit nur ungern einem Zufall.