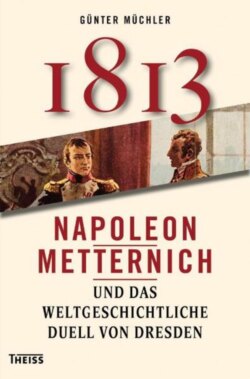Читать книгу 1813 - Günter Müchler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Leben als Drama
ОглавлениеAnfang 1813 ist Napoleon 43 Jahre alt. Seit dem Putsch vom 18. brumaire, des 9. November 1799, regiert er Frankreich de facto als Alleinherrscher, zunächst als Erster Konsul, danach als Konsul auf Lebenszeit, schließlich als Kaiser. In diesen 13 Jahren errichtet er ein Imperium, das das Reich Karl des Großen an Raum und Macht weit übertrifft. Vom Januar 1813 bis zur Ankunft auf Sankt Helena verbleiben ihm noch 33 Monate. Die restlichen fünf Jahre und sieben Monate verbringt er in englischer Gefangenschaft. 51jährig stirbt er am 5. Mai 1821.
„Welch ein Roman war doch mein Leben!“ soll er kurz vor seinem Tod ausgerufen haben. Man möchte eher von einem Drama sprechen. Es ist ein Leben in extremis, voll lodernder Aktion, gewaltig im Aufstieg, furchtbar im Untergang. Im Zenit seiner Macht gehorcht ihm der größte Teil des europäischen Festlandes. Am Ende kommandiert er nur noch das Gesinde am Ort seiner Verbannung. Er stirbt einen jämmerlichen Tod, wahrscheinlich ist Magenkrebs die Ursache.
Aber vergessen ist er nicht. Seine märchenhaften Taten leben weiter in den Erzählungen der alten Gardisten, der grognards, und beunruhigen seine Nachfolger auf dem Thron Frankreichs, die im Spiegel der napoleonischen Überlieferung nichts anderes erblicken als ihre Mittelmäßigkeit. 1832 schreibt Heine aus Paris, für die Franzosen sei Napoleon „ein Zauberwort, das sie elektrisiert und betäubt. Es schlafen tausend Kanonen in diesem Namen“1.
Den größten Anteil an seiner verstörenden Gegenwärtigkeit hat Napoleon selbst. Bis zum letzten Atemzug arbeitet er auf der Insel daran, die Deutungshoheit über sein Werk zu gewinnen. Feindliche Armeen kann der ewige Kämpfer nicht mehr in die Knie zwingen. Wohl aber kann er sich literarisch gegen die einsetzende Dämonisierung durch seine Bezwinger zur Wehr setzen. So wird der Basaltfelsen des Exils zum Feldherrnhügel, von dem aus er eine Propagandaschlacht entfesselt, die seinen Nachruhm retten und seinen Platz in den Herzen der Franzosen zurückgewinnen soll. Eine Autobiographie schreibt er nicht, was zu bedauern ist. Denn ohne Zweifel verfügt er über schriftstellerisches Talent. Statt dessen hält er den ihm gebliebenen Gefährten vorlesungshafte Monologe, die diese festhalten und zu Büchern verarbeiten. Die stärkste Wirkung erzielt das Mémorial des Grafen Las Cases. Es wird zu einem der größten Bucherfolge des Jahrhunderts und leitet die Ikonisierung des Ex-Kaisers ein.
An der Legende seines Lebens beginnt Napoleon in früher Zeit zu weben. Die Eigenpropaganda, die er schon als junger General betreibt, ist vielgestaltig und hochmodern. Sie reflektiert das neuartige Phänomen der öffentlichen Meinung, das man in den Stäben der feindlichen Armeen noch gar nicht erkannt hat. Preußischerseits wird sich das erst durch Gneisenau ändern. Intuitiv erfaßt Napoleon, daß in der neuen Zeit nicht allein die Taten zählen, sondern auch, wie über die Taten gedacht und gesprochen wird. Die öffentliche Meinung, sagt er einmal zu Las Cases, „ist eine unsichtbare, mysteriöse Macht, der nichts widersteht“2. Daß diese geheimnisvolle Macht geformt werden kann, beweist er als erster. Zeitungen, die er während des Italienfeldzugs ins Leben ruft, verbreiten seinen Namen und streichen seinen Anteil an den Siegen heraus. Armee-Bulletins, die er selbst verfaßt, beeinflussen die Stimmung in der Heimat. Das ist von großer Bedeutung, denn die Kriegführung der Republik beruht auf der Volksbewaffnung. Sie braucht also ein günstiges Meinungsklima. Die Bulletins schaffen ein unsichtbares Band zwischen Armee und Heimat. Durch sie erfahren die Familien zu Hause von den Heldentaten ihrer Söhne und Männer. Sie spenden Trost und lassen sich wie ein Vermächtnis des Ruhms auf bewahren, dann, wenn die Soldaten nicht mehr für sich sprechen können. Stilistisch sind die Bulletins Bravourstücke. In den Theatern werden sie von Schauspielern deklamiert, auf den Kanzeln von Pfarrern erläutert. Ihre Manipulationskraft ist groß, weil die protokollhafte, Amtlichkeit suggerierende Form den durchaus legeren Umgang mit den Fakten verschleiert.
Die Eigenpropaganda, die der junge Bonaparte in Italien zu handhaben lernt, wirkt als Treibsatz seiner Karriere. Am Anfang fördert sie seinen Bekanntheitsgrad. Später wird sie ihm als Mittel zur Zementierung seiner cäsarischen Herrschaft unverzichtbar sein. Wahre Meisterschaft erreicht er in der Selbststilisierung. Der Liebhaber des Theaters versteht es, sein Auftreten sorgfältig zu arrangieren. Als Napoleon 1811 durch den Hofgarten von Düsseldorf reitet, erkennt ihn der 14jährige Heine sofort an bestimmten für ihn typischen Accessoirs: „Der Kaiser trug seine scheinlose grüne Uniform und das welthistorische Hütchen“3. Bei dieser Kopf bedeckung handelt es sich um einen Zweispitz, wie er bei französischen Offizieren durchaus üblich war. Normalerweise wurde er so getragen, daß die Flügel nach vorn und nach hinten wiesen. Napoleon jedoch dreht ihn seit 1802 um 90 Grad, so daß die Spitzen parallel zu den Schultern stehen. Da immer mehr Devotionalien in Umlauf gebracht werden, die den Konsul und Kaiser mit Hut zeigen, entsteht mit der Zeit aus dem Petit Chapeau, von dem er jährlich vier bei der Firma Poupard Cie. bestellt4, ein Markenzeichen. Ähnliche Bewandtnis hat es mit der „scheinlosen grünen Uniform“. Es ist der Habit der chasseurs de garde, den er auf Reisen und im Feld bevorzugt, wenn er seine Nähe zu den einfachen Soldaten betonen will. Auch dem berühmten grauen Mantel, den er bei Marengo getragen hat, kommt eine imageprägende Funktion zu. Jedem Schulkind vertraut ist das Bild Napoleons mit der in die Weste geschobenen Hand. Die Pose, die der Maler Ingres für ein Porträt des Ersten Konsuls gewählt hat, wird bald zum Sinnbild des Heroischen: Ein Beispiel ist der von Franz von Defregger gemalte Anführer des Tiroler Aufstandes gegen Napoleon. Da er keine Weste trägt, hat Andreas Hofer die Hand unter den Träger seiner Lederhose geschoben.
Im beginnenden 19. Jahrhundert sind es vor allem die bildenden Künstler, die den Menschen eine Vorstellung von ihren Idolen verschaffen. Jacques Louis David war schon in der Konventszeit die unumstrittene Malerautorität. Mit Bildern wie dem vom sterbenden Marat und seinen Choreographien für die auf bauenden Massenspektakel auf dem Marsfeld verherrlichte er die Revolution. Jetzt stellt er seine Kunst in den Dienst des Diktators. David bekommt den Auftrag für das offizielle Porträt der Kaiserkrönung. Von seiner Hand stammt auch das Heldengemälde Bonaparte beim Übergang über den Sankt Bernhard. Wie Antoine-Jean Gros, ein anderer Lieblingsmaler Napoleons, erhält David genaue Vorgaben für seine Arbeiten, und zwar auf schriftlichem Weg. Nicht nur, weil Napoleon zum Modellsitzen die Zeit fehlt: Anders als Ludwig XIV., der Wert darauf legte, daß seine Gesichtszüge naturgetreu wiedergegeben wurden, steht Bonaparte auf dem Standpunkt, daß eine realistische Darstellung bei Männern der Geschichte weder nötig noch angebracht sei. „Ihr Genie muß man malen“5. Daran hält sich David beim Sankt-Bernhard-Gemälde. Napoleon hatte den Paß auf einem Maultier überwunden. Im Bild setzt ihn David auf einen feurigen Schimmel. Der ist zwar etwas unterproportioniert, eignet sich aber zweifellos besser für die Apotheose des unbezwinglichen Feldherrn als ein treuherziges Muli6. Der Wettbewerb für Die Schlacht von Eylau, den Gros gewinnt, gibt die Botschaft en détail vor: „Der zu malende Augenblick ist der, wo Seine Majestät das Schlachtfeld besucht, um für seine Verletzten erste Hilfsmaßnahmen zu organisieren. Ein junger verletzter Litauischer Husar erhebt sich beim Anblick des Kaisers und sagt zu ihm: ,Cäsar, man möge mich heilen – Dir werde ich treu dienen, so wie ich Alexander gedient habe‘“7.
Napoleons Alleinherrschaft steht auf vergleichsweise dünnem Eis. Sie ist nicht in Tradition und Überlieferung verankert, sondern beruht auf dem Charisma des Machthabers. Das heißt, sie bedarf der ständigen Pflege. Für Napoleon ist Propagandakunst deshalb weitaus wichtiger als für die eingesessenen Erb-Monarchen. Sie erfüllt auch einen anderen Zweck. Wenn in früherer Zeit Potentaten Kunst in Auftrag gaben, taten sie es, um Macht und Reichtum zur Schau zu stellen. Dagegen geht es, wenn Napoleon Künstler beschäftigt oder Zeitungen für sich schreiben läßt, ganz elementar um Herrschaftssicherung. Die Kunst wird zum Kitt der porösen Legitimität.
Nur gut, daß sich dienstbare Maler und gefällige Journalisten nicht besonders verbiegen müssen, um Napoleon zu glorifizieren. Dessen Errungenschaften sind für jedermann sichtbar. Hat er nicht den Bürgerkrieg in Frankreich beendet? Und steht Frankreich nicht ruhmvoller da als jemals zuvor in seiner Geschichte? Als staunende Zuschauer erleben die Zeitgenossen, wie vor ihren Augen ein neues, sich immer weiter spannendes Großreich entsteht. Die Erklärung für dieses wunderbare Geschehen finden sie in Napoleons „Genie“.
Tatsächlich ist Napoleons Überlegenheit das Produkt unermüdlicher Arbeit und außerordentlicher Geistesgaben. Ein moderner Forscher wie Hagen Schulze attestiert dem Korsen den „erstaunlichsten Intellekt, den die Welt in neuerer Zeit hervorgebracht hat“8. Für den Marxisten George Lefebvre ist Napoleons „Gehirn eins der vollkommensten, die je existierten“9. Caulaincourt, der Schlittenpartner, rühmt Napoleons unvergleichliche Konzentrationsfähigkeit und sein phänomenales Ortsgedächtnis: „Das Kartenbild eines Landes schien in seinem Kopf eingemeißelt zu sein“10. Ist Napoleon mit einem Gegenstand beschäftigt, versenkt er sich in ihn mit allen Sinnen. „Er tat alles mit Leidenschaft. Daher der ungeheure Vorteil, den er über seine Gegner hatte. Denn nur wenige Sterbliche geben sich so ganz und gar dem Gedanken oder der Tat eines Augenblicks hin“11.
Napoleon I. in der Uniform eines Oberst der Garde-Grenadiere. Gemälde (um 1812) von François Pascal Simon Gérard.
Wie alle Kopfarbeiter, die als Dauerläufer unterwegs sind, kann Napoleon auf Knopfdruck einschlafen. Einer seiner Generäle beobachtet ihn während der Schlacht bei Bautzen. Nachdem er mittags durch die Stellung geritten ist, bemerkt der Kaiser: „Man muß die Sache gehen lassen. Die entscheidenden Schläge kann ich erst in zwei Stunden führen.“ Dann legt er sich schlafen12. Napoleon schläft im Schnitt sieben Stunden, aber in mehreren Abschnitten. Ist er in Paris, steht er um sieben Uhr auf, läßt sich aus Zeitungen und Polizeiberichten vorlesen, um dann seinen Sekretären zu diktieren13. Zum Frühstück genehmigt er sich ein Glas Chambertin, das ist sein Lieblingswein aus dem Burgund, den er meistens mit Wasser verdünnt (sic!) trinkt. Zurück im Arbeitszimmer, studiert er die ihm vorgelegten Dossiers, vertieft sich in Akten und Kartenmaterial, das ihm Bacler d’Albe, der kaiserliche Kartograph, vorsortiert hat. Am frühen Nachmittag besucht er Sitzungen des Staatsrats oder anderer Gremien. Gespeist wird um fünf Uhr oder später. Am Abend kehrt er in sein Arbeitszimmer zurück und nimmt sich die übriggebliebenen Akten vor. Gegen Mitternacht geht er zu Bett. Um drei Uhr wacht er wieder auf. Die folgenden zwei Stunden, nach denen er sich wiederum zwei Stunden Schlaf gönnt, sind die produktivsten. Er nennt sie die „Geistesgegenwart nach Mitternacht“. Sie nutzt er, um besonders schwierige Probleme zu wälzen. Im Feld behält er seine Angewohnheiten soweit möglich bei. Was das Essen betrifft, ist er mäßig. Das Nachtessen hat aus kaltem, gebratenem Huhn zu bestehen, einer halben Flasche Chambertin, Eis und einer Portion Schokolade. Napoleon ist kein Feinschmecker, in dieser Hinsicht also durch und durch unfranzösisch. Die Gabe zu genießen geht ihm ab. Feste bei Hof sind ihm zuwider, es sei denn, es läßt sich damit ein Zweck verbinden. Abendgesellschaften zur Pflege des Diplomatischen Korps delegiert er an Talleyrand. Angeblich verpflichtet er ihn, auf seinem Schloß in Valençay jede Woche vier Essen für mindestens 36 Personen zu geben14.
Für diesen Mann, der Zerstreuung für Vergeudung hält, kommt die Verbannung dem Todesurteil nahe. Auf Elba ist ihm wenigstens die „Souveränität über ein Gemüsebeet“ geblieben, wie Chateaubriand spottet15. Kaum angekommen, beginnt er zu planen und zu administrieren, als wäre das kleine Eiland ein Frankreich en miniature. Auf Sankt Helena ist er dagegen ein Gefangener. Schwerer als die Demütigungen durch seinen englischen Aufseher, den kleinkarierten Sir Hudson Lowe, erträgt er die erzwungene Langeweile. Verzweifelt versucht er, den Tag zu gliedern. Er bestimmt Zeiten für das Ausreiten und für die Lektüre. Von Las Cases läßt er sich regelmäßig Englischlektionen geben. Conquêtes sur le temps („Eroberungen über die Zeit“) nennt er mit bitterer Ironie die Stundenplanung auf Sankt Helena.
Schon als junger Mann, in einem Alter, in dem die Kameraden Frauen nachstellen und über die Stränge schlagen, praktiziert Napoleon eine fast mönchische Arbeitsdisziplin. Der 19jährige schildert der Mutter, wie sein Tag in der Garnison abläuft: „Ich gehe um 10 Uhr schlafen und stehe um 4 Uhr morgens auf. Ich esse nur einmal am Tage: das bekommt mir sehr gut“16. Um ein Großer zu werden, müssen viele Eigenschaften zusammenkommen. Disziplin ist eine davon. Sie hat der junge „Nabulione“.
*
„Nabulione“ ruft die Mutter Letizia ihren zweitgeborenen Sohn, der am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika zur Welt kommt. Acht Kinder haben die Eltern Carlo und Letizia Buonaparte. Sie gehören dem korsischen Kleinadel an. Wie in allen archaischen Gesellschaften besitzt der Clan auf Korsika einen hohen Stellenwert. Er ist Mittel- und Bezugspunkt des sozialen Lebens und Strebens. Die Buonapartes sind in diesem Punkt exemplarisch. Napoleon ist der Familiensinn eingeboren. Als er in die Lage kommt, Güter und Positionen zu verteilen, macht er vollkommen unverstellt davon im Sinne der Familie Gebrauch, übrigens längst nicht immer zu seinem Vorteil. Alle Geschwister werden aus der Fülle ihres Clan-Führers schöpfen. Er wird sie zu Königen machen und glänzend verheiraten. Die meisten von ihnen werden sich, anders als ihr Bruder, bereichern. Fast alle werden ihn enttäuschen. Keines der sieben Geschwister teilt seinen Weg ins Exil. Napoleon irrt, wenn er die Familienbande für eine absolut krisenfeste Lebensversicherung hält. 1813 wird er für diesen Irrtum teuer bezahlen.
Korsika ist aufgrund seiner geographischen Lage als Bollwerk ein Objekt der Begierde für alle Mächte, die das Mittelmeer beherrschen wollen. Anfang des 18. Jahrhunderts gehört die Insel zur Republik Genua. 1829 drängt ein Aufstand die Genuesen zurück auf die befestigten Küstenstädte. Leitfigur der Autonomisten ist Pascal Paoli. Der populäre Paoli führt eine Reihe von Neuerungen ein. Er baut Straßen und einen Hafen, setzt Sozialreformen durch und läßt sogar eine Verfassung erarbeiten. Rousseau ist begeistert. Im Contrat social sagt er voraus, Europa werde von Korsika noch hören. Das Orakel wird eintreffen, freilich anders, als der Philosoph gedacht hat. 1768 wird Genua, das bei Frankreich in der Kreide steht, zum Abtreten der Insel genötigt, bis die Schulden bezahlt sind. Paoli nimmt sogleich den Befreiungskampf gegen die neue Besatzungsmacht auf, kann sich aber nicht durchsetzen und muß bald nach England fliehen. Im Gegensatz zu ihm schlägt sich der Anwalt Carlo Buonaparte auf die Seite Frankreichs.
In diesen wirren Zeiten zerrinnt der Wohlstand der Buonapartes. Um so heißblütiger stürzen sich Carlo und seine ältesten Söhne in die innerkorsischen Turbulenzen. Wenigstens ein Clan-Mitglied soll in eine einflussreiche Stellung bugsiert werden, damit die Familie ihren Rang behaupten kann. Durch Beziehung gelingt es dem Vater, Napoleon mit einem Stipendium nach Frankreich zu bringen, zuerst an das Collège von Autun, wo der Zögling aus Korsika erst einmal Französisch lernen muß. Auf Autun folgt die königliche Militärschule von Brienne-le-Château in der Champagne. Napoleon wird die Schule, die er 1784 mit überwiegend schlechten Erinnerungen verläßt, 1814 wiedersehen, bei den blutigen Schlachten der Kampagne von Frankreich.
Im finsteren Schulhaus von Brienne führt Napoleon ein isoliertes Leben. Mit den später erreichten 168 Zentimetern Körpergröße hat er es bei Raufereien mit den Kameraden schwer. Er ist Hänseleien ausgesetzt. Der Spott gilt mehr dem schlechten Französisch, das er spricht, als seinem Status als Ausländer. Die Stunde des Nationalismus hat noch nicht geschlagen. Ironischerweise wird es Napoleon sein, der als Eroberer dem nationalistischen Aberwitz die Tür öffnet, indem er den Unterworfenen und Abhängigen den Virus des Franzosenhasses injiziert. Um die Jahrhundertwende dominiert aber noch ein weltbürgerlich-tolerantes Denken. Europas Eliten zirkulieren, so daß ein Schwabe aus Schorndorf, Reinhard, Außenminister Frankreichs werden kann. Der Rheinländer Metternich tritt in österreichische Dienste, die russische Armee wird von Offizieren geführt, die Phull oder Diebitsch heißen, keiner der großen Reformer Preußens ist eingeborener Preuße. Insofern muß man sich Napoleon nicht als zurückgestoßenen Migrantenjungen vorstellen. Wenn er sich in Brienne von seinen Kameraden fernhält, dann deshalb, weil er arm ist. Der Vater hat, als Bedingung der Einschulung, seine Mittellosigkeit nachweisen müssen. Für eine Schule junger Adliger ist das kein gutes Eintrittsbillett. Napoleon kann nicht mithalten, wenn es ans Geldausgeben geht, und fühlt sich gedemütigt. Er ist noch nicht einmal zwölf, da schreibt er seinem Vater einen Brief, in dem er seinen ganzen verletzten Stolz ausbreitet:
Mein Vater,
wenn Sie oder meine Beschützer mir nicht die Möglichkeiten geben, meinen Unterhalt in dem Hause, in dem ich mich befinde, anständig zu bestreiten, so rufen Sie mich nach Hause, aber sofort. Ich habe es satt, als armer Schlucker herumzulaufen und das unverschämte Lächeln meiner Mitschüler zu sehen, die weiter nichts über mich stellt als ihr Reichtum, denn nicht einer von ihnen ist auch nur annähernd von den aristokratischen Gefühlen beseelt, die in mir wohnen … Laßt mich, wenn nötig, ein Handwerk lernen, damit ich meinesgleichen um mich habe. Bald würde ich verstehen, unter ihnen der erste zu sein. Aus diesem Vorschlag können Sie meine Verzweiflung sehen. Aber, ich wiederhole es Ihnen nochmals, ich will lieber der erste Arbeiter in einer Fabrik als der verachtete Künstler einer Akademie sein 17 .
Der letzte Satz klingt nach Cäsar, den der aufgewühlte Knabe vielleicht gerade gelesen hat. Verbürgt ist, daß Napoleon in dieser Zeit anfängt, sich in die Bücherwelt zu vergraben. Sie ist sein Zufluchtsort in einer Umgebung, die er als abweisend erlebt. Den Büchern bleibt er sein Leben lang treu. In Longwood auf Sankt Helena ist die immerhin 2000 Bände umfassende Bibliothek sein größter Schatz. Bevorzugt läßt Napoleon seine Phantasie von den Darstellungen bedeutender Männer der Geschichte anregen. Ein früher Lieblingsautor ist Plutarch, in dessen Biographien er Vorbilder für den eigenen Lebensplan findet. Napoleons „ständige Gier nach Büchern“18 hebt sich ab von der gewöhnlichen Triebstruktur eines Waffenhelden. Man denke an Blücher, den Gegner von 1813, der unbelesen ist wie ein Bauer. Oder man denke an Napoleons spätere Marschälle und Generäle. Sie sind überwiegend einfacher Herkunft und dürften über ihren Anführer, der die üblichen soldatischen Zerstreuungen meidet und statt dessen Bücher wälzt, manchesmal den Kopf geschüttelt haben.
Von einer gerundeten Bildung wird man bei Napoleon dennoch nicht sprechen können. Sein Bildungshunger ist der eines Menschen, der nach oben will. Er liest mit Bleistift und Papier, macht Anmerkungen und Auszüge und führt Hefte mit Zitaten und Fakten, die er bei Gelegenheit anbringt. Oft und gern beeindruckt er, in diesem Punkt den Verhaltensmustern von Aufsteigern folgend, durch sein enormes Detailwissen. Seine Lektüre ist eklektisch. Geschichtliche, militärhistorische und geographische Titel überwiegen. Philosophisch beeinflussen ihn die Schriften des Abbé Raynal, den er in Marseille besucht, und vor allem Rousseau. Mit seiner Begeisterung für den Genfer Erfolgsautor, der er in einem Essay freien Lauf läßt, liegt er im Trend der Zeit. Die Begeisterung schwindet, als Napoleon auf eigenen Füßen steht und Rousseaus Philosophie ihm mehr und mehr weltfremd vorkommt.
Wer viel liest, ist nicht automatisch ein guter Schüler. Die Zeugnisse Napoleons sind mittelmäßig. In Mathematik, Geschichte und Geographie schneidet er noch am besten ab, das Lateinische ist nicht seine Stärke. Deutsch, das in Brienne ein Monsieur Bauer lehrt, interessiert ihn überhaupt nicht19. Immerhin wird ihm die Eignung für die École militaire du Champs-de-Mars bescheinigt, die führende Militärschule Frankreichs. Auch hier reißt er keine Bäume aus. Unter 58 Zöglingen absolviert er als 42. Mit dem Dienstgrad eines Sekondeleutnants tritt er in das Artillerieregiment von Valence ein. Inzwischen ist sein Vater gestorben. 1786 nimmt Napoleon Urlaub, verlängert ihn zweimal. Er strengt sich an, die finanziellen Probleme der Familie in den Griff zu bekommen, die durch einige unternehmerische Fehlversuche des Vaters noch drückender geworden sind. In Paris buhlt er vergeblich um Unterstützung. Sein Regiment ist mittlerweile nach Auxonne gewechselt. In der burgundischen Stadt hört er vom Sturm auf die Bastille: „Gestern erfahre ich Neues aus Paris; es ist höchst erstaunlich und alarmierend … Man weiß nicht, wohin das führt“20. Doch noch im August bittet er erneut um Urlaub und schifft sich nach Korsika ein.
Warum Korsika zu diesem Zeitpunkt? Er kann nicht ahnen, daß Frankreich gerade jetzt zum großen Sprung ansetzt. Außerdem langweilt er sich in der Garnison zu Tode. In den 15 Monaten von Auxonne füllt er nicht weniger als 27 Notizhefte mit Auszügen, Verweisen und eigenen schriftstellerischen Versuchen. Noch sieht er seine Zukunft auf Korsika. Korsika ist sein Vaterland. Hier will er den Namen Buonaparte zum ersten machen. Frankreich ist für ihn nur ein Parkplatz, eine Startrampe. Bis 1793 springt er ruhelos zwischen Insel und Festland hin und her, verschafft sich Urlaub, läßt den Urlaub verlängern und überschreitet ihn, mit der Folge, daß er aus der Stammrolle seines Regiments gestrichen wird.
Auf Korsika gärt es mehr denn je. Paoli ist aus dem Londoner Exil zurückgekommen. Der Bannerträger der korsischen Freiheit muß allerdings feststellen, daß seine Zeit vorüber ist. Das Spiel, das auf der Insel gespielt wird, ist ein anderes geworden. Es heißt nicht länger Autonomisten gegen Besatzer. Die Revolution ist auf Korsika gelandet, und schon bald bestimmt das Grundmuster des großen Gesellschaftskonflikts die Frontlinien im insularen Mikrokosmos. Auch auf Korsika ringen jetzt Jakobiner mit den Anhängern der alten Ordnung. Napoleon schlägt sich auf die Seite der ersteren. Seinem glühenden Patriotismus tut das keinen Abbruch. Auf dem Mastbaum seiner Fregatte flattert die Kokarde im Verein mit der altkorsischen Mohrenkopfflagge. Er fängt an, eine Geschichte Korsikas zu schreiben. Zugleich stürzt er sich gemeinsam mit seinem älteren Bruder Joseph in den Parteienkampf. Er überwirft sich mit Paoli, verstrickt sich in kaum entwirrbare Abenteuer und verliert den Machtkampf. 1793 wird Napoleons Geburtshaus in Ajaccio bei einem Racheakt gebrandschatzt. Im Juni flieht er mit der ganzen Sippe nach Toulon. Das Kapitel Korsika hat ein abruptes Ende gefunden.
Viel Glück hat die Revolution dem jungen Korsen also noch nicht beschert. Die entwurzelten Buonapartes sind froh, daß sie in einem Vorort von Toulon eine bescheidende Bleibe finden. Aber Toulon ist kein sicheres Pflaster. Die Radikalisierung der Verhältnisse in Paris, die Ausschaltung der Girondisten und die Machtübernahme durch den Wohlfahrtsausschuß führen zu einer Rebellion der Hafenstadt. Marseille schließt sich an, aus Lyon werden die Jakobiner vertrieben. Aber nicht nur im Süden brennt es. In der Vendée herrscht Krieg. Der ganze Westen droht abzufallen. Im Osten geht der 1792 begonnene Krieg gegen Österreicher und Preußen weiter. England tritt der antirevolutionären Allianz bei, die Koalitionsheere stoßen auf das linke Rheinufer vor und erobern die habsburgischen Niederlande, also Belgien, zurück. Die dem Vielfrontenkrieg ausgesetzte Republik befindet sich in diesem Sommer des Jahres 1793 in einer lebensbedrohenden Situation. Ob sie das Jahresende erreichen wird, ist eine offene Frage. Der allmächtige Wohlfahrtsausschuß nutzt die Krise auf seine Weise. Der große Terror beginnt. Er ist ein Lernprogramm für alle diejenigen, deren Phantasie nicht ausreicht sich vorzustellen, daß man auch mit schönen Ideen häßliche Dinge anrichten kann. Im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wird zermalmt, was sich in den Weg stellt, der halsstarrige Opponent wie der unbequeme Nebenbuhler. Die terreur ist die Stunde der Denunzianten. Der Pöbel feiert Hexensabbat. Robespierre, Marat und Danton, die führenden Männer der „Tugendregierung“, werden allesamt nur noch wenige Monate leben. Dann wird das Höllenfeuer, das sie entfachten, auch sie verzehrt haben. Bis dahin tun sie ihr Bestes, damit die Köpfmaschine des Klavierbauers Schmidt nicht zum Stillstand kommt.
Im Clan der Buonaparte ist Napoleon der einzige, der Geld verdient. Noch vor der Flucht nach Toulon ist es ihm irgendwie gelungen, den Wiedereintritt in die Armee zu bewerkstelligen. Mag sein, daß die Vorgesetzten über seine Unzuverlässigkeit hinwegsehen, weil nun jeder Mann gebraucht wird. Man weiß es nicht. Jedenfalls kehrt Napoleon als Hauptmann in sein Regiment zurück. Die Ernennungsurkunde hat Ludwig XVI. unterschrieben. Es ist eine der letzten Unterschriften, die der unglückliche König leistet. Am 21. Januar 1793 haucht der rex christianissimus als Louis Capet sein Leben unter dem Fallbeil aus.
Wie gut oder wie schlecht der Artilleriehauptmann Buonaparte* über die Pariser Vorgänge im Bilde ist, darüber läßt sich nur spekulieren. Äußerungen aus dieser Zeit sind rar. Findet die Ermordung des Königs seine Zustimmung? Schockiert ihn die Kunde, daß Marie Antoinette ihrem Mann auf das Schafott gefolgt ist? Napoleon hat später den Königsmord mehrfach gegeißelt. Erwiesen ist, daß Napoleon am 10. August 1792 Zeuge war, als ein blutrünstiger Mob die Schweizer Garden vor den Tuilerien abschlachtete und die Toten in schrecklicher Weise verstümmelte. Dieses Erlebnis vergißt der junge Korse nie; es impft ihm einen bleibenden Horror vor steuerlosen, aufgeputschten Massen ein.
* Diese Schreibweise des Namens behält er bis 1802 bei. Nach der Heirat mit Joséphine wird das „u“ gestrichen. Erst als Kaiser, also ab 1804, unterschreibt er mit „Napoleon“.