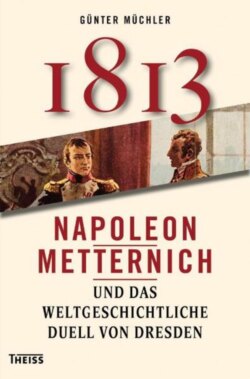Читать книгу 1813 - Günter Müchler - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
General der Republik
ОглавлениеVermutlich erlebt Napoleon die Revolution zuallererst als Unordnung. Selbst die Hauptakteure im Konvent handeln ja nicht nach Plan. Sie sind zerstritten, ihre Ziele sind unscharf und können jederzeit durch die mehr als 2000 Jakobinerclubs im Lande, deren radikalsten die Pariser Sektionen sind, manipuliert werden. Was bei den einfachen Menschen ankommt, ist zunächst, daß auf nichts mehr Verlaß ist. Autorität und Gewohnheit haben ausgedient. Die Anrede lautet jetzt „Bürger“ und nicht mehr „Monsieur“. Die Männer sind jetzt sansculottes; sie tragen lange Hosen statt die den Adel kennzeichnenden Kniebundhosen (culottes). Die Frauen geben ihre Korsetts auf den Trödel und vertauschen die ausladenden Rokoko-Roben mit glatt herabfallenden Kleidern. Nicht überall ist der Fortschritt so klar erkennbar wie in der Mode. Städte werden umgetauft. Aus Lyon wird die Ville affranchie, aus der Pariser Ile Saint Louis die Ile de la Fraternité. Die Königsgärten der Tuilerien werden zu Äckern umgepflügt. Erschließt sich schon bei dieser Barbarei an Blumen und Bäumen der revolutionäre Sinn nicht recht, bleiben aus der Römerzeit importierte Symbole wie die rote phrygische Mütze oder das Liktorenbündel weithin rätselhaft. Abgeschafft wird der vertraute gregorianische Kalender. Das Jahr hat zwar noch immer zwölf Monate, aber die haben jeweils nur 30 Tage. Fünf Ergänzungstage, die jours sansculottes, stopfen die Fehlstellen. Die Zeitrechnung beginnt nicht mehr mit Christi Geburt, sondern mit dem 1. vendémaire 1792. Sogar die Uhr wird neu erfunden. Sie funktioniert jetzt nach dem Dezimalsystem, was bedeutet, daß der Tag 10 Stunden à 100 Minuten à 100 Sekunden hat. Evident ist der Erneuerungsbedarf beim Kartenspiel: Die fluchwürdige Königskarte wird durch Genien ersetzt, aus den Damen werden Freiheitsgöttinnen. Victor Hugo hat den Neuerungswahn inklusive der hahnebüchenen Mode, Kindern die Vornamen römischer Helden zu geben, in dreiundneunzig mit beißendem Spott beschrieben21.
Am einschneidensten sind die Auswirkungen des Kirchenkampfes. Ungezählte Kirchen werden geschändet, Kathedralen gehen in Staatsbesitz über oder sie werden vermietet wie der gotische Dom von Metz. Die in der Basilika von St. Denis ruhenden Gebeine der Könige werden in ein Massengrab geschüttet. Selbst Heinrich IV., den Schöpfer des Toleranzedikts von Nantes, verschont man nicht. Der Schädel des bon roi wird gestohlen und erst 2010 wiederentdeckt. Es ist eine vandalische Zeit. Die Bilderstürmerei der Revolutionskommissare schädigt den kulturellen Besitz Frankreichs mehr, als je eine fremde Armee vermag.
Auf Widerstand stößt die Dechristianisierungspolitik vor allem auf dem Land. Hier leben 85 Prozent der Franzosen, hier schlägt das Herz Frankreichs. Auf dem Land ersetzt das Geläut der Dorf kirche die Uhr. Der Angelus ruft die Bauern zu den Mahlzeiten. Die religiösen Feste geben dem Jahr seine Gliederung. Jetzt schweigen die Glocken, und mit den gewohnten Feiertagen fehlen plötzlich die Märkte und der Tanz auf dem Dorfanger und damit die Fixpunkte im Dahinrauschen des Lebens. An vielen Orten wird der als Trost- und Segensspender und oft auch als Lehrer benötigte curé schmerzlich vermißt, weil nur noch regimetreue „konstitutionelle“ Priester die Sakramente spenden dürfen und viele Gemeindegeistliche lieber in die Verbannung gegangen sind, als den Eid auf die Verfassung zu leisten. Um mit der Gewohnheit zu brechen, daß der siebte Tag der Woche dazu da ist, dem Herrgott die Ehre zu erweisen, wird der Monat in Dekaden zu dreimal zehn Tagen eingeteilt.
Diese ganzen geschraubten Veränderungen, zu denen auch die Einrichtung des theosophischen Vernunftkults gehört, wirken künstlich und teilweise lächerlich. Den überzeugten Revolutionären dagegen sind sie bitter-ernst. Für sie ist die damnatio memoriae, die Auslöschung des sozialen Gedächtnisses, ein unabdingbares Vorprogramm. Erst wenn dieses Programm absolviert ist, kann der neue Mensch geschaffen werden. Allein, der alte Mensch pfeift auf die zweifelhaften Errungenschaften. Vor allem die einfachen Leute möchten am Hergebrachten festhalten, schon weil die Flut der Veränderungen sie überfordert. Es ist gar nicht so einfach zu begreifen, daß es die Monate Juli und August nicht mehr geben soll, man sich statt dessen an den „Wärmemonat“ thermidor gewöhnen muß, der als elfter Monat im republikanischen Jahreszyklus vom 20. Juli bis zum 18. August dauert, um dann vom „Fruchtmonat“ fructidor und dem „Nebelmonat“ brumaire abgelöst zu werden. Unsicherheit und die Angst, aus purer Ahnungslosigkeit gegen die gerade gültige Tagesparole zu verstoßen, züchten eine geduckte Haltung, die dem Wunschbild vom selbstbewußten citoyen entgegengesetzt ist. Man zieht den Kopf ein und wartet ab, wann der Sturzbach der Veränderung zum Halten kommt.
Auch Napoleon wartet ab. Sein Regiment ist der Armée d’Italie zugeordnet. Die Bezeichnung täuscht allerdings, denn im Augenblick hat die Armee einen Inlandsauftrag. Sie soll für den Konvent die Unruhen im Rhônetal niederschlagen. Die Begeisterung der Sodaten hält sich in Grenzen. Schließlich sind die Aufständischen in Toulon, in Marseille oder in Lyon Franzosen. Wie können sie Feinde Frankreichs sein? Das Problem ist, daß der Bürgerkrieg Neutralität nicht vorsieht, schon gar nicht für das Militär. Auch der Hauptmann Buonaparte muß Farbe bekennen. Gefühlsmäßig steht er auf seiten der Revolution. Hat er nicht in Brienne unter der Anmaßung verzogener Aristokratensöhne gelitten? Er kennt die Thesen der Auf klärer. Sie bestimmen den Zeitgeist und nehmen für den jakobinischen Standpunkt ein. Sie beeinflussen auch den jungen Mann aus Korsika. Die Abschaffung der Adelsprivilegien nennt er einen „Schritt zum Guten“22. Noch vor dem Bastille-Sturm wirft er die Frage auf, ob die erbliche Monarchie wirklich ein Segen für die Völker sei. Seine Antwort lautet: „Nur wenige Könige hätten es nicht verdient, abgesetzt zu werden.“ In einem schriftlichen Versuch vertritt er Rousseaus Vertragstheorie. Entweder stammen die Gesetze vom Volk, das sich seinem Fürsten freiwillig unterworfen hat, oder sie stammen vom Fürsten. Trifft das erste zu, hat sich der Fürst an den Vertrag zu halten. Im zweiten Fall müssen für den Fürsten Ruhe und Glück des Volkes die Richtschnur sein. Napoleons Fazit ist abstrakt, rechtfertigt aber zur Not die revolutionäre Praxis: „Was die menschlichen Gesetze angeht, so kann es deren keine geben, sobald der Fürst sie mit Füßen tritt“23. Aus den Pariser Fraktionsstreitereien zwischen Girondisten und den Anhängern der Bergpartei hält er sich heraus. Allerdings findet er, die Jakobiner seien „ohne gesunden Menschenverstand“24.
Eine sonderbare, aber folgenreiche Schrift verfaßt er 1793. Im „Souper de Beaucaire“ unterhalten sich ein Fabrikant aus Montpellier, zwei Bürger aus Nîmes und Marseille und ein Offizier über die Zwistigkeiten im Süden. In dem fiktiven Gespräch wirbt der Mann aus Marseille um Verständnis für den Aufstand gegen den Konvent. Marseille sei nicht gegen die Republik an sich, vielmehr vertrete sie die wahre Republik. Der Offizier, der zweifellos die Ansichten Napoleons zum Ausdruck bringt, sieht davon ab, Öl ins Feuer zu gießen. Auf eine Erörterung der ideologischen Standpunkte im Bürgerkrieg läßt er sich nicht ein. „Schüttelt das Joch der Handvoll Aristokraten ab, die euch führen, nehmt gesunde Grundsätze an, und ihr werdet keine wahreren Freunde haben als die Soldaten“, entgegnet er dem Sprecher der Aufständischen. Statt das Schwert des Propheten zu ziehen, appelliert er an die praktische Vernunft: Aus welchen Motiven heraus die Marseiller auch handeln – sie tun es vergeblich. Denn gegen die reguläre Armee haben sie keine Chance25.
Das „Souper“ gefällt in jakobinischen Kreisen. Offenbar hat der Autor den richtigen Ton getroffen. Der jüngere Bruder des „Unbestechlichen“, Augustin Robespierre, der als Kommissar des Konvents die Entwicklung im Süden überwacht, ist angetan. Er fördert von nun an den jungen Hauptmann, der auch bald bei der Belagerung von Toulon die Gelegenheit erhält, sich auszuzeichnen. Toulon ist der wichtigste Kriegshafen Frankreichs. Mit Hilfe der Aufständischen hat eine englisch-spanische Flotte den Hafen besetzt und 17 000 Soldaten angelandet. Das bedeutet die höchste Gefahrenstufe und hat eine ganz andere Qualität als die Kämpfe in Marseille, wo es nur galt, den Widerstand von Rebellen zu brechen. In Toulon geht es darum, eine Invasion zu verhindern.
Der englisch-spanische Brückenkopf ist von Einheiten der Armée d’Italie eingekreist. Unter einem unfähigen Kommandeur ist die Belagerung jedoch nicht vorangekommen. Die Lage ändert sich, als Napoleon, protegiert durch den Kommissar Robespierre, einen Angriffsplan ausarbeitet und den Befehl über die Artillerie erhält. In wenigen Tagen wird die Stadt genommen. Die feindliche Flotte verläßt fluchtartig den Hafen. Der Sieg ist außerordentlich prestigeträchtig, der entscheidende Anteil Napoleons unstreitig. Es ist sein erster Sieg, der Startpunkt einer militärischen Karriere ohnegleichen. Noch in einer weiteren Hinsicht stellt Toulon gleichsam das Basislager seines Aufstiegs dar: Bei den Gefechten um die Hafenstadt schließt der Artilleriehauptmann Bekanntschaft mit anderen ehrgeizigen Jungoffizieren, die er an sich bindet. Unter seinem Oberbefehl werden sie zum Schrecken der Feinde Frankreichs werden: Duroc, Marmont, Désaix, Junot.
Im Dezember 1793 erhält Napoleon die Ernennung zum Brigadegeneral. Damit würdigt der Wohlfahrtsausschuß in der Hauptstadt seine Verdienste bei der Abwehr der Invasion im Golfe du Lion. Der Anfang ist gemacht! Nachdem die Armée d’Italie untätig zugesehen hat, wie die aus Paris entsandten Rächer, unter ihnen der spätere Polizeiminister Fouché, im „befreiten“ Toulon wüteten, wendet sie sich nun ihrer eigentlichen Bestimmung zu. Sie rückt gegen das mit Sardinien verbundene Piemont vor. Ein von Napoleon vorgelegter Feldzugsplan trägt erste Früchte, doch dann bleibt die Offensive stecken. Die Gründe liegen in Paris. Zunächst kann sich der Wohlfahrtsausschuß nicht über das weitere Vorgehen an der Front einigen, dann hat er andere Sorgen. Am 9. thermidor, dem 27. Juli 1794, ist Robespierre gestürzt worden. Die Diktatur des Wohlfahrtsausschusses hat ein Ende. Robespierre und seine Gefährten besteigen den Richtkarren.
Für Napoleon bedeutet der Umsturz in Paris eine Beinahe-Katastrophe. Er wird verhaftet, was beweist, daß man ihn tatsächlich für einen Jakobiner hält. Fast zwei Wochen verbringt er in Haft. Die Anklage ist dünn und offensichtlich konstruiert. Das allein würde wohl nicht reichen, ihn vor dem Schafott zu retten, doch die neuen Herren, die Thermidorianer, verordnen im Zeichen der neuen Politik nur die allernotwendigsten Grausamkeiten. Außerdem wird man den talentierten jungen General vielleicht noch gebrauchen können. So kommt er frei und hat wieder eine Lektion gelernt: Die Revolution geht mit ihren Kindern um wie Saturn. Man muß auf der Hut sein, um nicht verschlungen zu werden.
Die Männer, die den Schlag des 9. thermidor führen, sind keine Konterrevolutionäre. Sie haben die Schreckensherrschaft mitgemacht, nicht in der ersten Reihe, aber widerspruchslos. Geputscht haben sie, weil sie ihre Haut retten wollten, ehe man auch sie auf den Karren wirft. Von allein wird die terreur nicht zum Stehen kommen. Außerdem liegt der Umsturz im Interesse der Republik. Macht das „Tugendregiment“ weiter, droht am Ende der royalistische Gegenschlag und damit die Vernichtung jenes Teils des Vermächtnisses von 1789, der unbedingt erhalten werden muß. Dazu gehört für die Thermidorianer die Abschaffung der Adelsprivilegien und ebenso unbedingt die Erhaltung der Nationalgüter, das heißt die Masse des Kirche und Adel entrissenen Landbesitzes. Diese Beute ist zu Schleuderpreisen an neue Besitzer übergegangen. Die Nutznießer sind Bürger, Bauern und nicht zuletzt führende Revolutionäre. Sie eint das gemeinsame Interesse, den prekären Besitz zu sichern. Mit diesen Neureichen, den Notabeln, schließen die Thermidorianer ein Bündnis. Es wird ein paar Jahre halten, und dennoch ist das fünf köpfige Direktorium, das nun an der Macht ist, von Anfang an ein schwaches Regime. In den Augen der radikalen Jakobiner sind die Thermidorianer Verräter. Die Royalisten differenzieren nicht. Ihnen gelten alle, die seit 1789 das Rad gedreht haben, schlicht als Königsmörder.
Napoleon hat den 9. thermidor überlebt, doch noch immer hängt ihm der Ruf eines Gefolgsmanns der Robespierre-Brüder an. Dieser Ruf mag ungerechtfertigt sein; gefährlich ist er allemal. Napoleon muß sich neu sortieren. Er hält sich im Hintergrund und knüpft Kontakte. Einem Stellungsbefehl zur Westarmee weicht er aus. Was in der Vendée Anfang 1793 mit lokalen Aufständen begann, hat sich zu einem regelrechten Krieg ausgewachsen, der mit größter Brutalität geführt wird. Rund eine viertel Million Opfer fordert die guerre franco-française26. Irgendwie gelingt es Napoleon, sich zu drücken. Ein Einsatz in der Vendée verspräche wenig Ehre und würde ihn tiefer in den Bürgerkrieg verstricken, als ihm lieb sein kann. Der Brigadegeneral der Artillerie zieht es vor, im Topographischen Büro unterzutauchen. Dort ist er aus der Gefahrenzone; außerdem kann es nicht schaden, sich mit elementaren Grundlagen der Kriegführung in fernen Ländern vertraut zu machen. Aber auf Dauer kann er dem Schlachtfeld Frankreich nicht entfliehen. Es kommt zu den Ereignissen des 13. vendémaire.
Den Royalisten haben der Umsturz und die blutige Abrechnung mit den Anhängern Robespierres Auftrieb gegeben. In mehreren Pariser Sektionen geben sie mittlerweile den Ton an. Sie glauben, nun sei die Reihe an ihnen. Das ist eine Fehlrechnung. Am 13. vendémaire, dem 3. Oktober 1795, gelingt es dem Direktorium ohne Anstrengung, ihren Aufstand niederzukartätschen. Napoleon hat sich der Regierung zur Verfügung gestellt. Sein Anteil am Erfolg der Operation ist nicht gering, wird aber von der Propaganda dermaßen vergrößert, daß er plötzlich als Retter der Republik vor der royalistischen Gegenrevolution gefeiert wird. Die Übertreibung nimmt der Général vendémaire, wie man ihn jetzt nennt, in Kauf. Anders als am 9. thermidor steht er diesmal auf der Seite des Siegers. Der Lohn läßt nicht lange auf sich warten. Am 24. Oktober wird Napoleon zum Divisionsgeneral ernannt; wenige Tage später erfolgt die Ernennung zum Oberbefehlshaber von Paris.
Der nächste Schritt der Annäherung an die neuen Machthaber folgt auf dem Fuße, ist aber völlig anderer Art. Napoleon hat Joséphine de Beauharnais kennengelernt. Von der sechs Jahre älteren Kreolin aus Martinique heißt es, sie sei wenn nicht die schönste, so doch die aufregendste Frau von ganz Paris. Sie ist die Witwe eines Revolutionsgenerals, der das Unglück hatte, noch knapp vor dem Ende Robespierres hingerichtet zu werden. Joséphine, die zwei Kinder hat und selbst kurzzeitig inhaftiert war, übt großen Einfluß auf Barras aus. Barras, ein korrupter Altadliger, ist der starke Mann des Direktoriums, Joséphine war seine Geliebte. Weshalb sie dem Werben Napoleons nachgibt, ist nicht ganz klar. Vermutlich sucht sie einen sicheren Hafen und sieht in dem jungen Korsen, dem von vielen eine große Zukunft vorausgesagt wird, den Financier ihres extravaganten Lebensstils. Die Heirat findet am 9. März 1796 statt. Bereits zwei Tage später reist Napoleon zur Italienarmee ab. Für ihn stehen bei der Verbindung Nützlichkeitserwägungen nicht im Vordergrund. Napoleon ist der in Liebesdingen weitaus erfahreneren Joséphine verfallen. Dennoch verschmäht er keineswegs die Vorteile, die ihre Verwobenheit mit dem neuen Establishment verspricht. Barras behauptet später großspurig, er habe den Oberbefehl über die Italienarmee, den Napoleon am 2. März erhält, dem Paar zur Hochzeit geschenkt.
Mit der Beförderung zum Chef der Italienarmee nimmt Napoleon gleich mehrere Sprossen auf der Karriereleiter. Wie schnell sich das Glücksrad gedreht hat! Vor drei Jahren, nach der Flucht aus Korsika, stand er vor dem Nichts. Vor zwei Jahren entging er nur knapp dem Tod unter dem Fallbeil. In Toulon hat er als tüchtiger Offizier auf sich aufmerksam gemacht. Seit dem 13. vendémaire kennt man seinen Namen auch in Paris, jener Stadt, in der nach einem Wort Rivarols, des Legitimisten und Emigranten, „die Vorsehung stärker wirkt als an jedem anderen Ort“27. Mit dem Italienfeldzug öffnet die Vorsehung Napoleon jetzt die Pforte zu einer höheren Sphäre des Ruhms. Er muß die Chance nur nutzen.
Die Armée d’Italie verfügt über rund 40 000 Mann. Die verbündeten Österreicher und Piemonteser bringen es dagegen auf eine Stärke von 70 000 Mann. Der Zustand der französischen Truppen ist erbärmlich, die Moral ist schlecht. Verglichen mit den beiden anderen unter der Trikolore kämpfenden Armeen hat die von Napoleon übernommene Streitmacht kaum Erfolge vorzuweisen und wenig Hoffnung, die Anerkennung des Vaterlandes zu erringen. Das sind keine guten Auspizien für den neuen Oberbefehlshaber. Er muß sich entscheiden: Soll er die Verhältnisse hinnehmen, wie sie sind? Gerade erst avanciert, befindet er sich nicht in der Position desjenigen, der Forderungen stellen kann. Oder soll er der Regierung die Leviten lesen? Napoleon schreibt dem Direktorium erst einmal eine drastische Eröffnungsbilanz. Die Armee sei „ohne Brot, ohne Disziplin, ohne Gehorsam“28. Selbstbewußt verlangt er den seit Monaten ausstehenden Sold. In Paris kann man über den forschen Ton nur staunen. Verblüfft sind auch die Soldaten, denn im ersten Armeebefehl verspricht ihnen der junge General das Land, wo Milch und Honig fließen: „Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt führen. Reiche Provinzen, große Städte werden in eure Hände fallen; dort werdet ihr Ehre, Ruhm und Reichtümer finden“. Dann zeigt Napoleon, was er kann. Nach einem Plan, den er im Topographischen Büro ersonnen hat, zerschneidet er die Verbindungslinien zwischen den beiden feindlichen Armeen. Österreicher und Piemontesen erhalten einen Vorgeschmack auf die siegbringende Kriegführung des aufsteigenden Sterns am Schlachtenhimmel: Basierend auf einer genauen Sondierung der Kampfzone, bringt er den Gegner vor allem durch die Schnelligkeit in Verlegenheit, mit der er seine Verbände bewegt29. Die Marschleistungen, die seine Soldaten vollbringen, sind außerordentlich. Rücksichtslos verlangt Napoleon das Äußerste an physischem Einsatz. Der Erfolg gibt ihm recht. Nach einer Serie von Blitzsiegen müssen die Piemontesen die Waffen strecken. Der Schlußpunkt wird bei Mondovi gesetzt. In einem mitreißenden Tagesbefehl eröffnet Napoleon seinen Männern, daß sie über Nacht zu Helden geworden sind:
Soldaten, ihr habt binnen vierzehn Tagen in sechs Schlachten gesiegt, 21 Fahnen, 25 Kanonen, mehrere Festungen genommen, den reichsten Teil von Piemont erobert; ihr habt 15 000 Gefangene gemacht, mehr als 10 000 Mann getötet oder verwundet. Ihr hattet euch bis jetzt für unfruchtbare Felsen geschlagen, welche durch euren Mut berühmt geworden, aber dem Vaterland ohne Nutzen sind; ihr steht jetzt durch eure Dienste der Holländischen und der Rheinarmee gleich. Von allem entblößt, habt ihr alles ersetzt. Ihr habt ohne Kanonen Schlachten gewonnen, ohne Brücken Flüsse überschritten, ohne Schuhe Eilmärsche gemacht, ohne Branntwein und oft ohne Brot biwakiert. Nur republikanische Scharen, nur Soldaten der Freiheit waren fähig zu ertragen, was ihr ertragen habt 30 .
Nachdem Piemont aus dem Krieg ausgeschieden ist, wirft sich Napoleon auf die Österreicher. Sie werden am 10. Mai 1796 bei Lodi schwer geschlagen. Mailand wird eingenommen. Aber die Österreicher wehren sich zäh; sie werfen neue Truppen in die Schlacht. Ein halbes Jahr lang dauert es, bis Mantua von den Franzosen eingenommen werden kann. Es bedarf noch der Siege bei Rivoli (14. Januar 1797) und bei Tagliamento (16. März 1797), wo Napoleon über Erzherzog Karl, den besten Feldherrn des schwer bedrängten Habsburgerstaates, triumphiert, ehe sich Österreich zum Präliminarfrieden von Loeben und schließlich zum Frieden von Campo Formio (17. Oktober 1797) bereit findet. Die Armée d’Italie steht zeitweilig 30 Kilometer vor Wien, 40 Kilometer vor Rom. Der Papst tritt Bologna, Ferrara und die Romagna an Frankreich ab. Venedig kapituliert kampflos. Die Lombardei wird als „Cisalpinische Republik“ französisches Protektorat. Fast beiläufig wird Korsika eingenommen. Eine Division genügt, um die Engländer zum Rückzug von der Insel zu zwingen. Mutatio rerum: „Nabulione“, der einst die Freiheit seiner Heimat auch gegen die Franzosen verteidigen wollte, besiegelt die endgültige Inbesitznahme der Insel durch die französische Republik.
In einem einzigen Jahr hat Napoleon Frankreich zur unumschränkten Herrin Obertaliens gemacht. Überall muß Österreich Positionen räumen. Das Habsburgerreich verzichtet auf seine niederländischen Besitzungen und sichert der Republik die Abtretung des linken Rheinufers zu. Endgültig soll darüber auf einem Friedenskongreß in Rastatt entschieden werden. Politisch hat Napoleon in weitgehender Unabhängigkeit vom Direktorium gehandelt. Die Verfassung der „Cisalpinischen Republik“ ist sein Werk, die Paragraphen des Vertrags von Campo Formio hat er in eigener Regie verhandelt. Auch das gehört zu den staunenswerten Hervorbringungen dieses Wunderjahres: Napoleon ist nicht nur auf dem Schlachtfeld ein Siegbringer. Er versteht es auch, das mit den Waffen erworbene Kapital gewinnbringend anzulegen.
Im Italienfeldzug entsteht der Mythos des genialen Feldherrn Napoleon. Seinem großen strategischen und taktischen Vermögen gleichwertig ist die Leistung, die er als Truppenführer vollbringt. Als er zur Italienarmee stößt, trifft er neben anderen auf die Generale Masséna und Augereau. Beide sind dienstälter und erfahrener. Sie dürften in dem 26jährigen einen Günstling des Direktoriums gesehen haben, eine Art politischen Kommissar, von dem allerhand zu erwarten ist, nur nicht, daß er eine reichlich heruntergekommene Armee aus dem Schlamassel zieht. Aber Napoleon überwindet ihr Mißtrauen. Offenbar verfügt der junge Korse über ein ungewöhnliches Maß an natürlicher Autorität.
Auch gelingt es Napoleon, die Herzen der einfachen Soldaten zu gewinnen. Bei Lodi glänzt er in kritischen Momenten durch persönliche Tapferkeit. Er ist der soldiers soldier31, der Anführer, für den man durch dick und dünn geht. Wenn Napoleon später sagt: „Ich gewinne meine Schlachten mit den Träumen meiner Soldaten“32, meint er das mystische Band, das ihn und seine Armee verbindet. Dieses Band wird die Katastrophe von 1812 überdauern, es wird seine Apotheose finden im berühmten Abschied des Kaisers von seiner Alten Garde im Schloßhof von Fontainebleau 1814 und in der Romanliteratur fortleben33. Selbstverständlich ist die napoleonische Propaganda an der Entstehung des Mythos beteiligt. Das Bild vom petit caporal, der sich für seine Leute in die Schanze schlägt, wird im Italienfeldzug von Zeitungen verbreitet, die der Oberbefehlshaber eigens gründet, Le courrier de l’armée d’Italie und La France vue de l’armée d’Italie. Natürlich sollen diese Blätter in erster Linie vom Ruhm des neuen Schlachtengottes künden. Sie tragen aber auch die Ruhmestaten der ganzen bisher scheel angesehenen Italienarmee nach Hause, nach Frankreich, und heben das Selbstwertgefühl der Soldaten. Der Korpsgeist, der auf diese Weise entsteht, trägt wesentlich zur Schlagkraft der Armee bei.
Dabei ist Napoleon niemand, der sich durch Nachsicht die Zustimmung seiner Leute erkauft. Wo er auf Schwäche trifft, kennt er keine Milde. Den Soldaten der 39. und der 85. Division, die ihre Stellung nicht gehalten haben, läßt er auf die Fahnen schreiben: „Sie gehören nicht mehr zur Italienischen Armee“34. Im August 1796 benotet er in einem vertraulichen Bericht an das Direktorium sein Führungspersonal: Den General Sérurier nennt er geistvoll, aber „schlaff, ohne Tätigkeit, ohne Kühnheit“. Über Abbatucci heißt es kurz und knapp: „Kann nicht 50 Mann kommandieren“, über Gaultier: „Gut für eine Schreibstube“35.
So formt er durch Anspruch und Beispiel eine Armee, der die nicht schlecht geführten Österreicher schließlich weichen müssen. Die Zeit ist vorbei, da die verbündeten Mächte wähnten, mit den wilden Haufen der Revolution kurzen Prozeß machen zu können. Die Republik hat sich Respekt verschafft. Daß ihr dies zuallererst durch ihre Waffentaten gelingt, wird für die weitere Entwicklung nicht folgenlos bleiben.
Die Siege der dreifarbenen Armeen sind hart erarbeitet und müssen auch gegen innere Widerstände errungen werden. Die revolutionäre Generalität ist anfällig für Korruption. Die in der Hauptstadt abwechselnd den politischen Ton angebenden Fraktionen greifen ständig in die operative Kriegführung ein und stiften dadurch Schaden. Das Gespenst des Verrats ist allgegenwärtig. 1793 wechselt Dumouriez die Front und flieht zu den Österreichern. Einen qualitativen Sprung bedeutet die Einführung der Wehrpflichtarmee durch Carnot. Frankreich kann jetzt die humanen Ressourcen weit besser ausschöpfen als seine Widersacher. Das Volksheer wird zum Träger jenes eigentümlichen Revolutionspatriotismus, den die Soldaten im Gepäck tragen, wo immer sie marschieren. Die Armee ist nicht mehr nur ein Bollwerk zum Schutz des Vaterlandes. Sie kämpft zugleich „international“ für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Jedenfalls läßt sich das behaupten. Auch Napoleon nutzt das revolutionäre Pathos, wenn er in dem oben zitierten Tagesbefehl nach dem Sieg bei Mondovi seine Soldaten lobt: „Nur republikanische Scharen, nur Soldaten der Freiheit waren fähig zu ertragen, was ihr ertragen habt“36. Frankreich führt einen politischen Krieg. Später wird Napoleon das messianische Motiv mehr und mehr zurücknehmen. Im Italienfeldzug aber setzt er es als Offensivwaffe ein. So heißt es in einer Proklamation vom 7. floréal des Jahres IV (26. April 1796):
Völker Italiens! Die französische Armee kommt, um eure Ketten zu zerbrechen! Das französische Volk ist der Freund aller Völker! Kommt ihm mit Vertrauen entgegen! Euer Eigentum, eure Religion und eure Gebräuche sollen geachtet werden. Wir führen den Krieg als edelmütige Feinde und wir wollen nur die Tyrannen bekämpfen, die euch unterdrücken 37 .
Eine Adresse Napoleons an die Bewohner Tirols vom 26. prairial des Jahres IV (13. Juni 1796) suggeriert, die französische Armee marschiere nur für einen guten Zweck:
Ich werde durch euer Gebiet marschieren, tapfere Tiroler, um den Wiener Hof zu einem Frieden zu zwingen, den Europa und seine Völker benötigen. Eure eigene Sache werde ich verteidigen. Lange genug seid Ihr durch die Schrecken eines nicht für die Interessen des deutschen Volkes, sondern für die Leidenschaften einer einzigen Familie unternommenen Krieges verletzt und erschöpft. Die französische Armee achtet und liebt alle Völker, aber ganz besonders die einfachen, ehrlichen Bewohner der Berge ... 38 .
Tatsächlich wird die Armée d’Italie an vielen Plätzen als Befreierin begrüßt. Noch hat die Revolution ihren Zauber nicht verloren. Noch hat sich nicht herumgesprochen, daß da, wo Toleranz stehen müßte, im Revolutionskatechismus eine Lücke klafft: „Man muß den Völkern, die ihre privilegierten Kasten unbedingt bewahren wollen, klar sagen: Ihr seid unsere Feinde. Und man muß sie entsprechend behandeln, denn sie wollen ja weder Freiheit noch Gleichheit“, hatte der Jakobiner Cambon im Dezember 1792 gedroht39. In der Lombardei weinen die Menschen den vertriebenen Österreichern keine Träne nach. Sie glauben an die Uneigennützigkeit der Revolutionstruppen und bauen darauf, daß der Friede ihnen die Selbstregierung bescheren werde. Doch es stellt sich heraus, daß das Freiheitsversprechen nicht viel mehr als Rhetorik ist. Die Republik ist finanziell klamm, und das Direktorium läßt Napoleon unmißverständlich wissen, daß der Reichtum der „befreiten“ Territorien abgezweigt werden muß, um in Paris die Kassen zu füllen. Den lombardischen Städten werden gewaltige Kontributionen auferlegt. Noch ärger ergeht es dem Papst. Weil Kirchenfeindlichkeit Teil des revolutionären Programms ist, braucht man dem Pontifex gegenüber noch nicht einmal den Schein zu wahren. Der Papst muß dafür, daß man ihm gnädig seinen Staat beläßt, neben einer hohen Geldsumme zusätzlich hundert Kunstwerke und fünf hundert wertvolle Manuskripte abliefern. Der organisierte Kunstraub im Namen der Freiheit wurde vom Wohlfahrtsausschuß eingeleitet. Napoleon führt ihn fort, und wohin die dreifarbigen Armeen ihren Fuß setzen, sind die Kunsträuber im Schlepptau und raffen Beute für den Louvre40.
Napoleon erfüllt die Plünderungserwartungen der politischen Führung in Paris in vollem Umfang. Kaltschnäuzig läßt er die Kontributionen eintreiben. Sich regende lokale Proteste werden ignoriert, soweit es geht. Gelegentlich sind Zugeständnisse erforderlich. Als sich nicht mehr verbergen läßt, daß unter denen, die sich in Italien die Taschen vollstopfen, auch einige Generäle sind, setzt er eine Untersuchungskommission ein. Die soll der Verschleuderung der erpressten Gelder nachgehen. Zwischen sich und den mutmaßlichen Übeltätern zieht er einen dicken Trennstrich. Die von ihm gesteuerten Gazetten heben hervor, daß Napoleon, dieser Mann, der „fliegt wie der Blitz und (zu-)schlägt wie der Donner“, trotz seiner einsamen Größe ein bescheidener Mensch geblieben sei: „Ich habe Könige zu meinen Füßen liegen sehen, ich hätte fünfzig Millionen mit nach Hause bringen können, ich hätte noch ganz anderes verlangen können; aber ich bin ein französischer Bürger, ich bin der erste General der Großen Nation; ich weiß, daß mir die Nachwelt Gerechtigkeit widerfahren lassen wird“, zitiert ihn La France vue de l’armée d’Italie. Für eine weitere der von ihm gegründeten Zeitungen, das in Paris erscheinende Journal de Bonaparte et des hommes vertueux, ist die Tugendhaftigkeit des Generals das zentrale Redaktionsprogramm41.
Dem Direktorium, dessen Habsucht notorisch ist, muß die Selbststilisierung Napoleons als Saubermann ein Stein des Anstoßes sein. Überhaupt bereitet der staunenswerte Erfolg des jungen Generals manchem in Paris Kopfzerbrechen. Zwar ist der Vertrag von Campo Formio für Frankreich überaus vorteilhaft, da er die Gebietszuwächse der Republik festschreibt. Die Thermidorianer könnten also mit dem Friedensschluß ihre bisher nicht üppige Erfolgsbilanz auf bessern. Dem steht entgegen, daß Napoleon die Urheberschaft an Sieg und Frieden allzu offen für sich persönlich beansprucht. Das Verhältnis der Direktoren zu ihrem protégé kühlt ab. Weil sie selbst schwach sind, mißfällt ihnen Napoleons Popularität. Weil er in Italien wie ein Vizekönig agiert, bezweifeln sie seinen Gehorsam. Ihr Argwohn richtet sich gegen den politischen Ehrgeiz des Generals Bonaparte, und dieser Argwohn ist durchaus begründet. Im Mémorial zitiert Las Cases Napoleon mit der Bemerkung, während des Italienfeldzugs sei ihm der Gedanke gekommen, „daß ich wohl auf der politischen Bühne eine ausschlaggebende Rolle spielen könnte“42.
Die politische Bühne, das ist Paris. Die Stadt bereitet dem Rückkehrer einen begeisterten Empfang. In den Theatern spielt man Die Brücke von Lodi. Die Straße, in der Napoleon und Joséphine wohnen, wird in Rue de la victoire umbenannt. Napoleon ist jetzt ein Star. Um so vorsichtiger muß er sein. Nur nicht den Verdacht auf sich ziehen, als strebe er die Militärdiktatur an! In dem nun folgenden Interim spielen alle Beteiligten mit verdeckten Karten. Öffentlich tritt Napoleon betont zurückhaltend auf. Fragt man ihn nach seinen Absichten, antwortet er ausweichend. Das Direktorium braucht ihn, möchte ihn aber nicht länger in Paris haben. Schließlich schickt man ihn an die Kanalküste. Er soll eine Invasion gegen England vorbereiten. Für Napoleon ist der Auftrag zweifellos attraktiv. Lorbeer verwelkt. Es kann nur gut sein, den in Italien erworbenen Ruhm aufzufrischen. Aber sehr rasch gelangt er zu der Einsicht, daß ohne eine gewaltige maritime Aufrüstung die Überquerung des Kanals mißlingen wird. Also überzeugt er das Direktorium davon, daß man England, den hartnäckigsten Widersacher der Republik, auch woanders treffen könne. Es beginnt das orientalische Abenteuer.
Der Expedition nach Ägypten hat, weil ihr der Erfolg versagt bleibt, immer der Beigeschmack des Mutwilligen angehaftet. In Frankreich ist die Expedition jedoch populär. Das liegt an dem märchenhaften Reiz, der ihr innewohnt. Mit seiner uralten und geheimnisvollen Hochkultur spricht Ägypten, das zu dieser Zeit ottomanische Provinz ist und von der Kriegerkaste der Mamelucken regiert wird, die Phantasie der Nation weit stärker an als der westindische Kolonialbesitz, von dem Frankreich übrigens nicht viel geblieben ist. Geostrategisch läßt sich die Herausforderung Englands am Roten Meer gut begründen. Wenn Frankreich die Landenge von Suez unter seine Kontrolle bringt, kann es den Seeweg zum reichen Indien sperren. Langfristig bietet sich Ägypten als ideale Ausgangsbasis für ein Ausgreifen nach Fernost an. So könnte man England ins Mark treffen.
Am 1. Juli 1798 landet die französische Flotte in Alexandria. Zum ersten Mal seit dem verhängnisvollen Kreuzzug Ludwig des Heiligen (1248) betritt ein christliches Heer wieder ägyptischen Boden. Im Gefolge der 38 000 Mann starken Armee befinden sich 200 Wissenschaftler und Künstler. Sie werden forschen, malen, sammeln, ein Institut d’Égypte gründen und dafür sorgen, daß in Frankreich nach der Rückkehr eine wahre Ägyptomanie ausbricht. Am 21. Juli schlägt Napoleon unweit von Gize das Reiterheer der Mamelucken. „Soldaten! Bedenkt, daß von der Höhe dieser Pyramiden Jahrtausende auf euch herabschauen“. Mit diesem Appell soll er die Soldaten in die Schlacht geschickt haben. Wie viele berühmte Sätze, die man in den Geschichtsbüchern liest und die Ausstellungen schmücken, ist auch dieser nicht belegt. Zuzutrauen wäre er ihm. Denn es gehört zu den Zauberkünsten Napoleons, seinen grognards zu suggerieren, daß ihre Arena die Weltgeschichte ist.
Nach dem Sieg bei Gize und dem Einzug in Kairo nimmt die Expedition eine unglückliche Wendung. Die hochsommerliche Hitze peinigt die Soldaten, der Wüstenkrieg kennt andere Gesetze als der in Tirol und in der Lombardei. Die Versorgung ist schwierig, und entgegen der Erwartung quittiert die Bevölkerung die Erlösung vom mameluckischen Joch keineswegs mit Jubelrufen. Dabei geben sich die Franzosen große Mühe, nicht als Eroberer aufzutreten. Napoleon, der zur Vorbereitung der Expedition den Koran gelesen hat, gibt strikte Order, Religion und Lebensart der Ägypter zu respektieren. Zum Fest des Propheten Ende August spielt eine französische Militärkapelle auf. Menou, ein General der Ägypten-Armee, heiratet die Tochter eines Bademeisters und tritt zum Islam über43. Mit gewohnter Tatkraft geht Napoleon daran, Straßen zu bauen, den Verkehr zu fördern und die Verwaltung zu verbessern. Doch trotz aller Anstrengungen lassen die Nachkommen der Pharaonen nicht davon ab, den Sendboten der großen abendländischen Revolution und ihren Motiven zu mißtrauen.
Dann erleidet das Expeditionskorps einen Rückschlag, von dem es sich nicht mehr erholt: Der britische Admiral Nelson vernichtet die französische Flotte, die er in der Bucht von Abukir überrascht hat. Damit sitzen die Franzosen in der Falle, während England eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, daß ihm auf See niemand gewachsen ist. Inzwischen hat die Pforte, die osmanische Reichsregierung, auf Drängen Englands und Rußlands Frankreich den Krieg erklärt. Napoleon marschiert der feindlichen Heeresmacht, die in Syrien steht, entgegen. Die Kämpfe werden mit außergewöhnlicher Härte geführt. In Jaffa läßt Napoleon 2500 osmanische Kriegsgefangene erschießen. Er rechtfertigt sich damit, daß andernfalls die eigenen Truppen verhungert wären. Den Makel der brutalen Handlung, die allen soldatischen Ehrbegriffen entgegensteht, empfindet er durchaus, daher läßt er Gros ein sentimentales Bild malen, Bonaparte visitant des pestiférés de Jaffa. Der menschenfreundliche General, der ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit Pestkranke besucht, soll die Erinnerung an das unmenschliche Massaker übertünchen.
Nachdem der Vormarsch der Franzosen bei Akko gestoppt worden ist, wird der Rückzug durch die Wüste zum Passionsweg. Die Armee verliert ein Drittel der gegen Syrien ausgerückten Soldaten. Am 25. Juli 1799 erringt Napoleon noch einmal einen glänzenden Sieg. Ausgerechnet bei Abukir, wo Nelson ein Jahr zuvor die französische Flotte zerstört hat, schlägt er vernichtend eine zweite türkische Armee. Doch schon am 22. August überträgt er den Armeeoberbefehl dem General Kléber, um einen Tag später Ägypten mit kleiner Begleitung auf zwei Fregatten zu verlassen. Zur Begründung gibt er folgende Erklärung ab: „Das Interesse des Vaterlandes, sein Ruhm, der Gehorsam und außerordentliche Ereignisse bestimmen mich, allein, inmitten feindlicher Geschwader nach Europa zurückzukehren“44.
Die Abreise von Ägypten nimmt paßgenau vorweg, was gut 13 Jahre später in Smorgoni geschieht: Nach einem militärischen Fehlschlag, herbeigeführt durch Klima und Krankheit, kehrt Napoleon plötzlich der Armee den Rücken. Und genauso wie 1812 sind es Ereignisse in Frankreich, die sein Verhalten diktieren: Der Krieg in Europa hat wieder Fahrt aufgenommen. Die italienischen Gewinne Napoleons sind verspielt worden. Der Autoritätsverfall des Direktoriums schreitet voran. Nach einer abenteuerlichen Slalomfahrt durch das Mittelmeer, immer in Gefahr, von Nelsons Jägern gestellt zu werden, landet Napoleon am 9. Oktober wohlbehalten im Golf von Fréjus, 16 Monate nachdem er Frankreich verlassen hatte. Als glücklicher Zufall erweist sich, daß im Augenblick seiner Rückkehr die Nachricht vom Sieg bei Abukir Paris erreicht. Die öffentliche Meinung glaubt die Expedition auf der Erfolgsspur. Als die Ägypten-Armee 1801 kapituliert, ist die Nation längst mit anderen Themen beschäftigt.
Napoleon betritt die Hauptstadt am 16. Oktober. Sie gleicht einem brodelnden Wasserkessel, dessen Deckel jederzeit in die Luft fliegen kann. Putschgerüchte aller Art schwirren herum. Man unterstellt wahlweise den Royalisten oder den Jakobinern, daß sie die Macht an sich reißen wollen. Der Heimkehrer aus dem Morgenland bunkert sich in der Rue de la victoire ein. Er hat mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Da ist einmal das sehr stürmische Verhältnis zu seiner Frau. Joséphine hat ihn betrogen. Napoleon weiß darüber Bescheid. Vertraute haben ihn informiert. Der Clan war immer gegen Joséphine. Jetzt fühlt er sich bestätigt. „Nabulione“ hat sein Herz einer Unwürdigen geschenkt. Vor allem die Mutter Letizia versprüht Gift. Weil Joséphine älter ist als ihr Ehemann, wird sie von der Schwiegermutter mit konstanter Bosheit la vielle tituliert. Der „Alten“ hält sie vor, daß sie außerstande sei zu tun, was nicht nur nach korsischer Auffassung vorrangige Pflicht der Frau ist, nämlich dem Mann Kinder zu gebären.
Die häuslichen Scherereien kommen ungelegen. Napoleons ganze Aufmerksamkeit ist durch die undurchsichtigen Verhältnisse in der Stadt gefordert. Wer wird den Schlag führen? Hat das Direktorium die Kraft, dagegenzuhalten? Jeder falsche Schritt, jede Fehleinschätzung kann verhängnisvoll sein. Im Haus an der Rue de la victoire machen jetzt viele ihre Aufwartung. Ständig sind Besucher da. Es kommen solche, die den populären General für irgendeine Fraktion anwerben wollen. Es kommen andere, die ihre Hoffnungen auf ihn selbst setzen und sich ihm als Unterstützer anbieten. Napoleon hält sich bedeckt. Äußerlich entspannt, nimmt er an den Sitzungen des Institut de France teil, das ihn als Mitglied aufgenommen hat. Trifft man ihn auf der Straße, trägt er nicht seine Generalsuniform, sondern den Gelehrtenfrack, mit dem sich die Weisen des Instituts kostümieren. So bewegt er sich in Paris wie ein Schauspieler ohne Engagement. Er wartet ab, weicht aus, beobachtet. Dabei ist ihm klar, daß er im Eskalationsfall dem Konflikt nicht entrinnen kann. Kluge Bebachter wie Christine Reimarus durchschauen Napoleons Nonchalance. Die Ehefrau des aus Schwaben stammenden Ministers Reinhard vertraut ihrem Tagebuch am 16. brumaire (7. November) eine subtile Momentaufnahme an: „Ich fand Bonaparte, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, bescheiden wie ein Beherrscher, einfach wie jemand, der auf alles Anspruch machen kann“45.
„Bescheidener Beherrscher“: Die Beschreibung würde ihm wohl gefallen. Ob er wirklich alles beanspruchen kann, ist jedoch die Frage. In vielen Rechnungen taucht er wegen seines Siegerimages als deus ex machina auf, das weiß er inzwischen. Aber kennt er alle Rechnungen? Was die republikanische Linke angeht, macht er sich keine Illusionen. Deren großer Alptraum ist die Militärdiktatur. Sie fürchtet den General, weil nur er für diese Rolle in Betracht kommt. Napoleon muß sich vorsehen. Wer will ausschließen, daß in diesen fiebrigen Novembertagen ein Brutus bereitsteht, um ihm ein cäsarisches Ende zu bereiten? Als das Direktorium dem Heimkehrer aus Ägypten in der ehemaligen, inzwischen zum Temple de la gloire umgewidmeten Kirche Saint-Sulpice ein Festessen mit 700 Gästen gibt, vertraut Napoleon aus Angst, vergiftet zu werden, allein dem Wein, den sein Brigadechef Duroc mitgebracht hat46.
Die Initiative zu den Ereignissen des 18. brumaire (9. November 1799) geht nicht von Napoleon aus. Den Anstoß gibt der Abbé Sieyès, Mitglied des Direktoriums. Es ist derselbe Emmanuel Joseph Sieyès, ehemaliger Generalvikar von Chartres, der mit seiner Anfang 1789 erschienen Schrift Was ist der Dritte Stand? die Lunte zum revolutionären Gemisch geliefert hatte47. Sieyès nimmt Kontakt zu Napoleon auf. Die Republik ist in Gefahr, wenn nicht rasch und entschlossen gehandelt wird. Darüber sind sich beide einig. Der Abbé sucht einen starken Arm; der Général vendémaire hat seine Tatkraft schon einmal unter Beweis gestellt. Sieyès will den Staatsstreich, aber in möglichst legaler Form. Jedenfalls soll ein Blutvergießen vermieden werden. Er strebt eine neue Verfassung mit einer deutlich stärkeren Exekutive an. Dazu sollen die beiden Kammern der Gesetzgebungskörperschaft ihre Zustimmung geben. Diese Kammern sind der Rat der Alten und der Rat der Fünf hundert. Nur im Rat der Alten kann Sieyès auf eine Mehrheit bauen. Das Problem wird der Rat der Fünf hundert sein, dem zwar Napoleons jüngerer Bruder Lucien vorsitzt, in dem aber die jakobinische Partei den Ton angibt.
Der Staatsstreich beginnt am festgesetzten Tag. Alles verläuft zunächst nach Plan. Napoleon werden die in Paris stehenden Truppen unterstellt. Der Rat der Alten erklärt sich einverstanden mit dem, was die Verschwörer empfehlen, und verfügt sich nach außerhalb der Stadt, nach Saint Cloud, wo man dem Druck der Straße nicht ausgesetzt ist. Doch im Schloß von Saint Cloud widersetzen sich die Fünf hundert. Als Napoleon mit dem Hut in der Hand den Saal betritt, wird er mit Rufen wie „Tod dem Tyrannen!“ und „Nieder mit dem Diktator!“ empfangen. Napoleon verliert die Fassung, er hält wirre Reden und läßt sich aus dem Saal herausdrängen. In dem allgemeinen Tumult rettet Lucien die Situation, indem er die Truppen, die das Schloß umstellt haben, mit einer dramatischen Ansprache gegen die Versammlung in Rage versetzt. Am Ende werden die Fünf hundert auseinandergejagt. Als Stunden später beide Kammern wieder zusammentreten, sind die Befürworter unter sich. Die Widerspenstigen haben es vorgezogen, sich in Sicherheit zu bringen. So kann nun auch das letzte Kapitel aus dem Drehbuch der Verschwörer abgespult werden. Die Nationalversammlung hebt die Verfassung des Jahres III auf; sie vertagt sich selbst und überträgt die Exekutivgewalt auf drei provisorische Konsuln: Sieyès, Roger-Ducos und Napoleon. Im Exil wird Napoleon den Vorwurf, man habe am 18. brumaire die Gesetze übertreten, als naiv abtun. Es habe eine „gebieterische Notwendigkeit“ zu handeln bestanden, erklärt er und fügt hinzu: „Ebensogut könnte man den Seemann beschuldigen, daß er sein Schiff beschädige, wenn er die Masten kappt, um nicht unterzugehen“48.