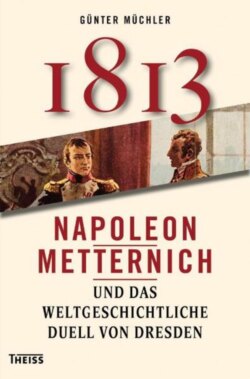Читать книгу 1813 - Günter Müchler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Kapitel
Ein magischer Moment
Ihr Zweikampf ist vielleicht die dramatischste Episode unserer modernen Geschichte. Jahrelang haben sie im Verborgenen gearbeitet, um den Tag zu erwarten, an dem sie vor aller Öffentlichkeit gegeneinander antreten.
Albert Sorel
Napoleon Bonaparte hat nie aufgehört, unsere Phantasie zu beschäftigen. Obwohl letztlich gescheitert und elend gestorben, gehört er zum Titanengeschlecht der Menschheitsgeschichte, vergleichbar Alexander dem Großen, dem er nacheiferte. Er war Eroberer, Staatsmann und Reformer. In welcher Rolle er am meisten glänzte, wird der Betrachter je nach Standpunkt entscheiden. Napoleon selbst zog den Code civil all seinen Siegen vor, allerdings erst dann, als vom Ertrag seiner Eroberungen nichts mehr geblieben war. Herausragend ist ohne Zweifel die Breite seines Schaffens.
„Einem Großen traut man gern Größe in jeder Hinsicht zu. Da scheint fast nur Licht, kaum Schatten zu sein“, beobachtet Christian Meier. Das Helldunkel gehört aber nun einmal zur condition humaine. Friedrich II. von Preußen war ein Menschenverächter. Cäsar konnte feige sein. Auch bei Napoleon variiert die Beurteilung je nach Stand der Sonne. Nimmt man die moralische Person, überwiegt wohl der Schatten. Über sich hat er gesagt: „Ein Mensch wie ich ist ein Gott oder ein Teufel“1.
Napoleons Leben ist gleich groß im Aufstieg und im Fall. Das macht die Besonderheit seiner Biographie aus. Wie eine einzige Herausforderung, ja Lästerung der Erfahrung erscheint uns sein Aufstieg, wie ein donnerndes Memento menschlicher Begrenztheit sein Fall. Bei Alexander bewundern wir das kühne Ausgreifen. Er starb, ehe er untergehen konnte. Cäsar wurde im Zenit von Macht und Ansehen ermordet. Friedrichs letzte Lebensjahrzehnte verliefen unspektakulär. Dagegen mußte Napoleon den vollen Preis für seine Überhebung entrichten. Zunächst kennt seine Lebensbahn nur ein Immer-höher, Immer-weiter. Dann kommt die Peripetie der russischen Katastrophe. Von nun an ist alles nur noch ein Herabstürzen. Und seltsam, hier setzt die Unwiderstehlichkeit seiner Biographie ein. Im Niedergang gewinnt sie an Höhe. Wie sich der taumelnde Riese gegen das Unvermeidliche stemmt, im Revancheversuch des Jahres 1813, in der Kampagne von Frankreich 1814, schließlich im phantastischen Abenteuer der Hundert Tage: Erst durch die Verstoßung des Glücklichen aus dem Olymp gewinnt das Lebensdrama Napoleons die Eindringlichkeit einer Tragödie, erst im Scheitern wird es zum Gleichnis.
Warum gelang es Napoleon nicht, das Errungene zu halten? Die meisten Ursachen sind tausendfach benannt: Die Überspannung der Kräfte Frankreichs, die Gegenkräfte, die die Fremdherrschaft in den Vasallenstaaten weckte, eklatante Fehler wie die spanische Intervention und der russische Krieg. Außerdem fielen Napoleons Erfolge schädigend auf ihn zurück. Der Lauf seiner militärischen Siege war das Lernprogramm der Verlierer. Doch weder die Addition seiner Mißgriffe noch die Fortschritte seiner Gegner erklären ausreichend, weshalb er scheitern mußte.
Den Schlüssel finden wir in der ersten Hälfte des Jahres 1813. In der Spanne von sechs Monaten schafften die Widersacher Napoleons, was ihnen in zwanzig Jahren des Krieges gegen die Revolution nicht gelungen war: Sie schlossen sich zu einem umfassenden Bündnis zusammen, einem Pakt ohne Kündigungsrecht. Den ersten Schritt dazu tat der Zar mit seinem Entschluß, es nicht bei der Vertreibung der Grande Armée vom russischen Boden zu belassen, sondern den Krieg nach Mitteleuropa zu tragen. Den endgültigen Durchbruch bewerkstelligte die österreichische Diplomatie.
Die Herauslösung des Habsburgerstaats aus dem Bündnis mit Frankreich und die Kehrtwende zum Kriegsalliierten von Rußland, Preußen, England und Schweden war eine politische Glanzleistung. Metternich vollbrachte sie in einem sich hinziehenden, verdeckt geführten und jederzeit mit Handlungsalternativen versehenen Prozeß. Dieser kam am 26. Juni zum Abschluß. An diesem Tag empfing Napoleon Metternich im Dresdner Palais Marcolini zu einer Unterredung. Sie dauerte achteinhalb Stunden. Als Metternich Dresden verließ, war der Weg in den Krieg frei. Österreich würde sich auf die Seite der Feinde des Grand Empire schlagen. Es entstand die Weltkriegskoalition, der Napoleon unterliegen mußte.
Es ist lohnenswert, einen genauen Blick auf die legendäre entrevue von Dresden zu werfen. Wie es die Geschichte nach einem Wort Jakob Burckhardts bisweilen liebt, sich auf einmal in einem Menschen zu verdichten, so schafft sie dann und wann ein singuläres Ereignis, das blitzlichtartig eine diffuse Szenerie erhellt. Das sind Augenblicke seltener Klarsicht, magische Momente, in denen schwer verständliche Taten und Unterlassungen plötzlich einen Sinn erhalten. Im besten Fall brechen sie die Siegel einer ganzen Epoche auf und offenbaren die Gebundenheit menschlichen Handelns. Die Dresdner entrevue war solch ein magischer Moment.
Die meisten Geschichtswerke schlagen einen Bogen um die Begegnung im Palais Marcolini. Das hat Gründe. Während des gesamten Gesprächsmarathons waren der Kaiser der Franzosen und der österreichische Außenminister unter sich. Die Unterredung hatte also keine Ohrenzeugen. Über Inhalt und Verlauf sind wir nur durch die natürlich gefärbten Erzählungen der Akteure informiert. Außerdem endete das Treffen ohne Aplomb. Bis zur Kriegserklärung schleppte sich der Waffenstillstand weitere sechs Wochen dahin. Zuerst mußten die Rüstungsanstrengungen abgeschlossen werden. Außerdem bedurfte der von Metternich mit Formstrenge betriebene Koalitionswechsel Österreichs noch der Schlußinszenierung einer von niemandem ernst genommenen Friedenskonferenz, ehe die Waffen sprechen konnten.
In seinen autobiographischen Schriften beschreibt Metternich seine Beziehung zu Napoleon als Schachpartie, „während welcher wir uns nicht aus den Augen ließen, ich, um ihn matt zu setzen, er, um mich sammt (sic) allen Schachfiguren zu zermalmen“2. Bezogen auf die erste Jahreshälfte 1813 ist der Vergleich nicht zu hoch gegriffen. In dieser Phase lieferten sich Metternich und Napoleon einen Zweikampf, der mit großer Subtilität und bei höchstem Einsatz ausgetragen wurde. Zunächst ein Fernduell, steuerte er zwingend auf das Finale in Dresden zu.
Es handelte sich um ein Kräftemessen zweier Männer, die nach Wesen und Herkommen gegensätzlicher nicht sein konnten: hier Metternich, der galante Genußmensch; dort Napoleon, der rastlos und rücksichtslos Schaffende. Hier der selbstgewisse Grandseigneur, dort der aus dem Nichts gestiegene Usurpator. Der eine diente einem Kaiser, der andere wurde Kaiser. Der eine trug den Frack des Diplomaten, der andere den Rock des Soldaten. Zum Sinnbild wird das Duell dadurch, daß in ihm die unversöhnlichen Gegensätze der Epoche aufeinanderprallten: das Alte und das Neue, Ordnung und Bewegung. Das Ergebnis konnte nur in der Niederwerfung des einen oder des anderen Prinzips bestehen.
Von Ebenbürtigkeit waren die Akteure zunächst weit entfernt. Napoleon war trotz der Niederlage des Jahres 1812 noch immer der Hegemon Europas, Metternich der Minister einer bestenfalls zweitrangigen Macht, die froh sein konnte, daß sie überhaupt noch existierte. Seine Bilanz als Diplomat und Politiker wies bis dahin keine außergewöhnlichen Erfolge auf, statt dessen eine Reihe markanter Fehler. Der Stern des Staatsmannes Metternich ging erst 1813 auf.
Dagegen war Napoleon schon lange die alles überstrahlende Erscheinung der Zeit. Als General hatte er die Gegner der Revolution in die Knie gezwungen, als Erster Konsul den Bürgerkrieg im Land beendet, als Kaiser ein Großreich geschaffen, wie es Europa seit Karl dem Großen nicht gesehen hatte. Er war Bändiger und zugleich Fortsetzer der Revolution, Feldherr und homme d’état, ein Soldatenkaiser, dessen Leben nur dem einzigen Zweck zu folgen schien, Grenzen zu überschreiten und die Bewegungsgesetze der Politik zu widerlegen. Seine Anhänger versahen ihn mit allen Superlativen. Selbst Christuszüge wurden ihm zugeschrieben. Von ähnlicher Kraßheit waren die Verdammungsurteile, die über ihn gesprochen wurden. Für seine Gegner personifizierte er das Böse schlechthin. „Satans ältesten Sohn“ nannte ihn Ernst Moritz Arndt. In seiner letzten Phase glich der Kampf gegen den Imperator einem Kreuzzug.
Es ist die Maßlosigkeit der Beurteilung durch Freund und Feind, die uns hilft, die Wirkung Napoleons auf seine Zeitgenossen zu ermessen, eines Menschen, der selbst kein Maß kannte. Wenn ein Spötter wie Heine in ihm stets den „großen Kaiser“ sah, Goethe ihn zum „Kompendium der Welt“ erklärte und Hegel beim Vorbeiritt des Mannes auf dem Schimmel die Fassung verlor, erahnt man die Faszination, die von Napoleon ausgegangen sein muß. Das Empfinden des eigenen „Knirpstums“, das nach Burckhardt das untrügliche Zeichen für die Anwesenheit historischer Größe ist, befiel bei ihm selbst grundkritische Geister. Mit niemandem wurde das Beiwort „genial“ so verschwenderisch verbunden wie mit Napoleon. Uns Heutige beschleicht hierbei ein Unbehagen. In Anbetracht des schrecklichen 20. Jahrhunderts haben wir ein Problem mit der schieren Größe einer Herrschergestalt. Das frühe 19. Jahrhundert dachte da unschuldiger. Noch nicht ernüchtert durch die Erfahrung des Mißbrauchs, statt dessen durch die bewunderten Marmorgestalten der Antike mit dem Titanischen vertraut, erblickten die Menschen in Napoleon erschauernd den stupor mundi.
Dieser Staunenswerte war nach der Pulverisierung seiner Großen Armee in Rußland ein Gezeichneter. Doch noch einmal raffte er sich auf. In dem Irrglauben, das Rad der Zeit lasse sich zurückdrehen, stampfte er mit ungeheurer Energie eine neue Grande Armée aus dem Boden. Eine letzte Schlacht sollte seinen Nimbus wiederherstellen und das Großreich retten. Bei Lützen und bei Bautzen bewies er noch einmal seine überlegene Feldherrnkunst. Aber die Kraft reichte nicht aus, seine Feinde zu Boden zu werfen.
Unterdessen war ihm in Metternich ein großer Gegenspieler erwachsen. In der Manier eines Entfesselungskünstlers führte Metternich Österreich zunächst aus der Bindung an Frankreich heraus. Eine Vermittlung, um die ihn niemand gebeten hatte, verschaffte ihm Handlungsfreiheit zwischen den Konfliktparteien. Von allen Seiten umworben, wartete er klug ab, bis der Habsburgerstaat seine Rüstung vollendet hatte und stark genug war, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen.
Napoleon durchschaute Metternichs Spiel nicht von Anfang an. Als er es durchschaute, blieb er in fatalistischer Weise untätig. Er unterließ es, die Abschreckungswirkung seiner militärischen Anstrengungen durch eine politische Offensive zu flankieren. Um den Stellungswechsel Österreichs zu verhindern, hätte er Konzessionen anbieten und größere Teile seines Reiches opfern müssen. Davon hielt ihn nicht nur sein Starrsinn ab. Was als politische Lähmung erscheint, war in Wirklichkeit die Ohnmacht des allmächtigen Diktators3. Klar und frei von Selbstmitleid erkannte Napoleon, daß er aus der Bahn seiner Biographie nicht heraustreten konnte. Er war ein Eroberer, und für den Eroberer ist Nachgeben Aufgeben. Er war ein Emporkömmling, und für den Emporkömmling gibt es im Stürzen kein Halten. Weder sein Kaisertum noch die Vermählung mit einer habsburgischen Prinzessin und die Geburt eines Erben hatten den Mangel an Legitimität, der seine Herrschaft zerbrechlich machte, zu beseitigen vermocht. Wettmachen ließ sich der Mangel nur, solange seine Feinde ihn fürchteten.
Metternich erfaßte Napoleons Schwachstelle. Der Kaiser werde keinem Verzichtsfrieden zustimmen. Er werde alles wagen, um nichts zu verlieren. Auf bauend auf diesem Kalkül, konnte der Diplomat sein kaltblütiges Doppelspiel wagen. Das Dresdner Aufeinandertreffen bestätigte seine Rechnung. Napoleon unternahm im Palais Marcolini keinen ernsthaften Versuch, Österreich durch Verlockungen auf seine Seite zu ziehen. Kaiser Franz werde nicht Beihilfe leisten zur Vernichtung des Vaters seines Enkels. An diese Hoffnung klammerte er sich.
Die entrevue erbrachte keine Wende. Die Ereignisse waren vorgezeichnet. Zwanzig Jahre Revolutionskrieg ließen sich nicht ungeschehen machen, die Logik der napoleonischen Herrschaft nicht verändern. Insofern liegt die Bedeutung der entrevue weniger im Ereignishaften als in der Sichtbarmachung. An diesem 26. Juni wurde nicht Geschichte gemacht, wohl aber eine Geschichte entschlüsselt, die Geschichte vom notwendigen Fall Napoleons. Hinter den geschlossenen Türen der Sommervilla in der Dresdner Friedrichstadt rollte ein Psychodrama ab. Den Höhepunkt erreichte es, als Napoleon Metternich erklärte, warum er nicht anders könne, als der Spur seines Fatums zu folgen: „Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, zwanzigmal geschlagen zu werden. Jedesmal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt. Ich bin nur der Sohn des Glücks. Ich würde von dem Tag an nicht mehr regieren, an dem ich auf hörte, stark zu sein, an dem ich auf hörte, Respekt zu erheischen.“
In seiner Unbedingtheit hatte dieses Geständnis etwas Erschütterndes. Der Herr der Welt räumt ein, daß er ein Gefangener ist. Er hat verloren, was für den Feldherrn wie für den Politiker die Voraussetzung des Erfolgs ist: die Wahl der Mittel. Ihm bleibt nur der Krieg. Darin, daß Napoleon seine Blöße ausgerechnet dem Hauptwidersacher vorzeigt, so als könne nur dieser ihn verstehen, liegt das Überwältigende dieser Szene.
Der Sieg im Dresdner Duell gehörte Metternich. Der Diplomat bezwang den Eroberer. Das ist erstaunlich im Ausgang eines Zeitabschnitts, der ganz von Gewalt geprägt war. Natürlich bewirkte den Sturz Napoleons nicht Metternich allein. Es bedurfte zweier Kriegsjahre, bis der Beunruhiger Europas unschädlich gemacht und als prisonnier de guerre auf der Felseninsel St. Helena weggesperrt war. Aber als Konstrukteur der Weltkriegskoalition ist Metternichs Anteil an Napoleons Fall größer als der Blüchers und Wellingtons oder gar des preußischen Landsturms.
Letztlich ging das Grand Empire unter, wie noch jedes Reich untergegangen ist, das auf Zwang und Unterdrückung beruhte. Metternich hatte es kommen sehen. In einem wurde der Pragmatiker und Glaubens-Minimalist niemals wankend, nämlich in der Überzeugung, daß Napoleons Universalreich gegen die natürliche Ordnung verstieß und deshalb keinen Bestand haben würde. Es war diese Überzeugung, die ihm im magischen Moment von Dresden den entscheidenden Vorteil verschaffte.