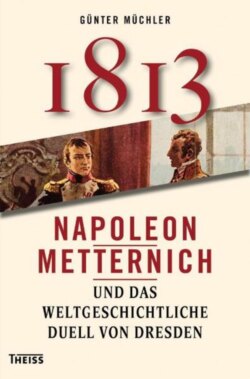Читать книгу 1813 - Günter Müchler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel
Smorgoni
Am 5. Dezember 1812 verlassen drei Reisewagen Smorgoni. Es ist Nacht und der Weg nicht einfach zu halten. Hier und da hemmt eine Schneewehe gefährlich die Fahrt. Dessen ungeachtet schlagen die Kutscher ein hohes Tempo an. Fast gehetzt rollen die Wagen Richtung Westen, und schon bald haben sich die wenigen Lichter der kleinen Stadt in der Dunkelheit verloren.
Smorgoni liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Minsk und Wilna. Mehr ist über die Ansiedlung nicht zu sagen, als daß sie einst polnisch war, jetzt russisch ist und über eine ansehnliche jüdische Gemeinde verfügt. An diesem Tag aber tritt Smorgoni, ohne es zu wissen oder gar dafür zu können, aus der Bedeutungslosigkeit heraus und wird zum Sinnbild menschlicher Vergeblichkeit.
Die Nacht ist eisig und still. Der Schnee verschluckt den Hufschlag der Pferde. Vom Mondschein nur spärlich beleuchtet, gleiten die Kutschen wie ein Geisterzug dahin. Im ersten Wagen sitzen, unkenntlich in ihre Pelze gedrückt, zwei Männer. Es sind der Kaiser Napoleon und Caulaincourt, Herzog von Vicenza, sein Großstallmeister. Vor ihnen auf dem Bock sitzt neben dem Kutscher der Leibwächter Roustam, ein Mameluck, den Napoleon einst aus Ägypten mitgebracht hat. Im zweiten Wagen folgen die Generäle Duroc, Herzog von Friaul, und Mouton, Graf von Lobau; im dritten General Lefèbvre-Desnouettes, der polnische Dolmetscher Graf Wonsowicz sowie der Sekretär Baron von Fain und Constant, der Diener des Kaisers. Den Abschluß bildet eine Kavallerieeskorte.
Die berühmteste Schlittenfahrt der Geschichte beginnt also tatsächlich im Reisewagen. Erst am 7. Dezember wechselt der Kaiser die vergleichsweise bequeme Berline gegen einen Schlitten. Caulaincourt hat ihn aufgetrieben. Es ist ein wunderliches Gefährt, ein einstmals rot gestrichener Kasten, den man auf Kufen gesetzt hat, in dem es zieht und der den Schnee fast ungehindert eindringen läßt. Immerhin erlaubt der Umstieg, das Tempo zu beschleunigen, und darauf kommt es an. Am Ende wird man für die 2200 Kilometer bis zum Fahrtziel Paris ganze 13 Tage gebraucht haben, obwohl Unfälle die Reisenden auf halten. Einmal bricht der Schlitten halb auseinander, ein andermal kracht die Deichsel.
Wie riskant die Reise ist, zeigt sich gleich am Anfang. Gegen Mitternacht erreicht der geheimnisvolle Zug Oszmiana. Die Ortschaft war am Abend zuvor von einem Kosakenschwarm angegriffen worden. Kosaken sind auch jetzt überall in der Nähe. Wer genau hinschaut, erkennt ihre Biwakfeuer nicht weit rechts und links der Straße. Kosaken sind die Meister des Kleinen Krieges. Sie tauchen aus dem Nichts auf, schlagen zu und sind wieder fort. Ihre Brutalität ist gefürchtet. Sich zwischen ihren Nachtlagern hindurchzuschlängeln, ist lebensgefährlich. Aber es muß sein. Nach kurzer Rast befiehlt Napoleon um 2 Uhr den Auf bruch. Eine Schwadron polnischer Lanzenreiter, die in Oszmiana gelagert hat, soll den Treck decken. Der Kaiser verteilt Pistolen und gibt den Polen eine Order, die sie erbeben läßt: Sie sollen ihn erschießen, falls er in die Hand des Feindes geriete.
In Smorgoni hat sich Napoleon von seiner Armee abgesetzt. Armee ist eigentlich das falsche Wort, denn von der riesigen Heerschar, mit der der Kaiser Ende Juni über den Njemen gegangen war, um Rußland in die Knie zu zwingen, existieren nur noch versprengte Reste. Ein Blitzsieg sollte es werden. In drei Monaten würden sie sich wiedersehen, hatte Napoleon der Kaiserin Marie-Louise geschrieben. Ein halbes Jahr später haben verlustreiche Kämpfe, mehr noch aber Kälte und Krankheit, Hunger und heillose Panik das an die 400 000 Mann starke Invasionsheer ausradiert1. Nicht viel mehr als 10 000 Halbtote sind übriggeblieben, genau weiß es niemand. In Smorgoni hat Napoleon den Oberbefehl dem König von Neapel, Murat, übertragen. Der soll die Heerestrümmer auflesen, sich nach Wilna zurückziehen und warten. Warten auf die Rückkehr des Kaisers.
Wie eine Flucht erscheint die Abreise Napoleons. So kommt es, daß die Verzweiflung derer, die den Rückmarsch bis zu diesem Tage überlebt haben, in Empörung umschlägt. Und es geschieht das Unvorstellbare. Soldaten verhöhnen und vermaledeien ihren Anführer, der stets ihr Idol gewesen war. Noch vor wenigen Tagen, im Überlebenskampf an der eisigen Beresina, hatten sie aus heiseren Kehlen ihr vive l’Empereur herausgeschrien und sich mit versiegender Kraft aufs andere Ufer gerettet.
Die Beresina! Vor dieser letzten Schlacht vertraut Napoleon Caulaincourt an: „Sollten wir nicht übersetzen können, werden wir uns die Kugel geben“2. Drei Tage dauert das desperate Manöver. Es wird zum Inferno. Alles scheint sich gegen die elend Zurückflutenden verschworen zu haben: Die Beresina, ein Rinnsal, ist zum reißenden Fluß geworden, mit schweren Eisschollen bedeckt. Der Versuch, die einzige Brücke zu verteidigen, scheitert. Hastig werden zwei Behelfsbrücken gebaut, nur eine hält. Nachdem sie gesprengt ist, bleiben Tausende auf dem falschen Ufer zurück, dem Feind zur Beute. Später wird man trotzdem von einem Sieg sprechen. Die Russen waren an Zahl dem Kaiser turmhoch überlegen. Nur aus Furcht vor dem „Ruf seiner Waffen“ hätten sie die Schlinge nicht zugezogen, urteilt Clausewitz3. Wie auch immer, der Durchbruch an der Beresina war der letzte Dienst, den Napoleon seiner ehemals stolzen Grande Armée leisten konnte. Schon vorher ist sein Entschluß gefaßt, die Flucht nach vorn zu wagen.
«Übergang über die Beresina». Der Rückzug der französischen Armee am 26.–28. November 1812 auf einem Gemälde von January Suchodolski (um 1859).
Nicht vor den Russen flieht Napoleon. Er flieht vor dem entsetzlichen Anblick dieser Trümmer-Armee, der ihn anklagt. Er kann diesem Klumpen zerlumpter Soldaten nicht mehr nützlich sein. Er muß nach Paris! Dieser Gedanke ist in seinem Kopf, seit er am 6. November von einem Putschversuch in der Hauptstadt erfahren hat. Das Umsturzunternehmen des Ex-Generals Malet, das mit der Behauptung operierte, Napoleon sei tot, ist zwar im Keim erstickt worden. Aber wenn schon ein Irrer den Thron ins Wanken bringen kann, dann ist der Kaiser in der Hauptstadt nötiger als in Litauen, gleich wie man im Heer darüber denkt.
Die Männer im Schlitten schweigen. Jeder hängt seinen Gedanken nach. In Wilna und Kowno war gerade mal Zeit für einen Pferdewechsel und eine kurze Mahlzeit. Napoleon will nicht aufgehalten werden. Nur jetzt keine Erklärungen! Er wird sie geben, zur rechten Zeit. Das 29. Bulletin hat er fertig in der Tasche. Am 3. Dezember hat er es in Molodetschno fertiggestellt. Das Bulletin wird vom Sterben der Grande Armée berichten, der größten Streitmacht, die die Geschichte gesehen hat. Es wird beweisen, daß allein die mörderische Natur den Kaiser bezwungen hat. Und es wird mit dem Satz enden: „Die Gesundheit Seiner Majestät war nie besser“.
Napoleon vergräbt sich tiefer in seinen grünen, mit Goldquasten besetzten Pelz. Selten war er auf die wunderbare Maschine seines Verstandes so angewiesen wie jetzt. Wie kein anderer besitzt er die Fähigkeit, sich auf ein Ziel zu konzentrieren und diesem alles unterzuordnen. Diese Gabe hat ihm in kritischen Momenten jenen winzigen Vorsprung verschafft, den der Sieger braucht. Ganz nebenbei hilft sie, störende Bilder zu bannen und Selbstzweifel auszuroden. Bei ihm, so hat er einmal gesagt, ordneten sich die Gegenstände wie die Schubladen eines Schrankes. „Wenn ich eine Angelegenheit unterbrechen will, schließe ich ihr Fach und öffne das einer anderen. Wenn ich schlafen will, schließe ich alle Fächer und schlafe ein“4. Auch jetzt findet er Schlaf. Der Mechanismus funktioniert.
Aber ganz läßt ihn das Geschehene nicht los. Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Bis Moskau war der Feldzug ein Siegeszug gewesen. Gewiß, den entscheidenden Schlag hat er nicht setzen können. Ein Sieg, so überwältigend wie Austerlitz, dann der Friedensschluß. Das war sein Plan gewesen. Es ist anders gekommen, Gott weiß, warum. Aber nirgendwo hat das Heer des Zaren die Szene beherrscht. Niemand kann behaupten, den Unbesiegbaren besiegt zu haben. Selbst Borodino läßt sich mit einiger Mühe als Erfolg deuten. Die Schlacht hätte besser geschlagen werden können, das ist nicht zu bestreiten. Doch am Ende hat der russische Generalissimus, der einäugige Kutusow, das Weite gesucht.
Die Weite, diese unendliche Weite des russischen Riesenreiches! Er hat sie unterschätzt. Er hat die strategischen Möglichkeiten nicht gesehen, die sie dem geduldigen Verteidiger bietet. Rußland ist so ganz anders als die Kriegsschauplätze, auf denen seine Adler triumphiert haben. In Italien, in Deutschland hat er mit untrüglichem Blick die Bedingungen des Raums gelesen, hat er die Feinde so gestellt, wie er sie brauchte. Durch die Sicherheit und Schnelligkeit seiner Operationen hat er die Aktion selbst dann diktiert, wenn seine Armee an Zahl unterlegen war. In Rußland war er es, der über die größere Streitmacht verfügte. Doch selbst das war zu wenig, um einen Gegner zu fassen, der einfach nur zurückwich und verbrannte Erde hinterließ.
Wäre er nicht ein Meister des Verdrängens, Napoleon wüßte sehr wohl, welche Fehler er gemacht hat. Falsch war es, nicht in Wilna oder spätestens in Smolensk haltzumachen. Aber nach der Eroberung von Smolensk lag Moskau verführerisch nahe und damit die Aussicht, durch die Einnahme der Stadt den Krieg zu beenden. Dann der Horror, Moskau menschenleer vorzufinden, bar jeder Vorräte, in Brand gesetzt vom eigenen Gouverneur. 26 Tage hat er in Moskau gewartet, in der Annahme, Alexander sei nur allzu bereit, Frieden zu machen. Als er am 19. Oktober mit nur noch 90 000 Mann Moskau verließ, um den Rückmarsch anzutreten, war es zu spät. Der Winter brach aus. Dieses Warten war sein Kardinalfehler. Es ist der einzige, den er im Schlittengespräch mit Caulaincourt zugibt.
Ein barbarisches Reich ist dieses Rußland. Es widerspricht jeder Erfahrung. Dabei hatte Napoleon geglaubt, die Russen zu kennen. Er hat ihre Armeen besiegt und ist ihren Diplomaten begegnet. Vom Zaren Alexander war er damals, 1807, beim Rendezvous auf dem Njemen, geradezu bezaubert. Wäre er eine Frau, er würde sich in Alexander verlieben, hatte er Joséphine von Tilsit aus geschrieben. Nun gut, über die Jahre ist ihm Alexander zu eigenmächtig geworden. Trotzdem hätte er niemals mit einer so unerbittlichen Kriegführung gerechnet. Aber stehen die Russen auf heimischem Boden, werden sie zu Barbaren. Die Zivilisiertheit fällt von ihnen ab wie Stuck von der Decke. Mit eigener Hand haben sie Moskau niedergebrannt, das heilige Moskau, seine Paläste in Schutt und Asche gelegt. Wie soll ein Franzose das verstehen?
Ohne Pause zieht der Schlitten mit Herrn von Reyneval – um nicht erkannt zu werden, hat der Kaiser den Namen eines ehemaligen Legationssekretärs von Caulaincourt adoptiert – seine Bahn. Inzwischen ist man in Polen angelangt. Die strenge Kälte hält an. Zeitweilig fällt das Thermometer auf minus 35 Grad Celsius. Wenigstens muß man nicht mehr befürchten, streunenden Kosaken in die Hände zu fallen. Das Großherzogtum Warschau ist vergleichsweise sicherer Boden; es bildet den östlichsten Bezirk im Orbit des Gand Empire. Formell dem sächsischen König untertan, handelt es sich um ein Satellitengebilde, das man den Rheinbundstaaten vergleichen kann. Der Unterschied besteht darin, daß die Polen in Napoleon den Heiland sehen, der gekommen ist, nach Rußlands Unterwerfung ihr altes Reich wiederherzustellen. Nun, da die Kunde vom Rückzug der Grande Armée Warschau erreicht hat, ist die Ernüchterung groß.
Die entspannte Sicherheitslage hat die Atmosphäre im Schlitten-Kasten gelockert. Je länger die Reise dauert, desto mehr staunt Caulaincourt über die Contenance des hohen Reisegefährten. Der Kaiser ist wieder er selbst. Er doziert über Strategie, er beginnt Wortgefechte mit seinem Großstallmeister. Der ist ein mutiger Mann, keiner der Schönredner, die Napoleon sonst umschwärmen. Caulaincourt hat vom Rußlandfeldzug abgeraten, schon deshalb, weil dahinter nie ein überzeugender politischer Plan stand. Auch jetzt hält er mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Napoleon läßt den Widerspruch gelten, er braust nicht auf. Scherzhaft zupft er den Herzog von Vicenza, wenn der sich allzusehr ereifert, am Ohrläppchen. Kein Wort verliert er während der ganzen Reise über die Zerstäubung seiner Armee, über die Leiden der Soldaten, über das Los der bei Murat Zurückgebliebenen. Die Schublade mit dem Kapitel Katastrophe hat er geschlossen.
Warschau wird am Vormittag des 10. Dezember erreicht. Von der Pradabrücke gehen Napoleon, Caulaincourt und der Dolmetscher Wonsowicz zu Fuß durch die Vorstadt. Der Mann im grünen Pelz mit der Zobelmütze steigt in einem Hotel ab, das wie zum Hohn den Namen seines Alptraums England trägt, im Hotel d’Angleterre. Von Caulaincourt läßt er den französischen Geschäftsträger zum Rapport einbestellen. Der Abbé de Pradt fällt aus allen Wolken, als er plötzlich vor dem Kaiser steht. Napoleon kanzelt ihn ab. Aus dem Großherzogtum sei viel zu wenig Unterstützung für die Armee gekommen. Dann macht er den Gesandten zum rhetorischen Sparringspartner. Er erprobt an ihm die Argumente, die in den nächsten Tagen und Wochen mantrahaft das russische Debakel erklären sollen: Der Winter habe den sicheren Triumph geraubt. Tausende von Pferden habe die Armee jede Nacht verloren und so weiter.
Dann verblüfft er den Abbé mit einem Satz, der wie eine Vanitas-Gravur über der Schlittenfahrt des „Herrn von Reyneval“ stehen könnte: Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas. Er wiederholt ihn wenig später gegenüber einer Gruppe polnischer Magnaten, die er in aufgeräumter Stimmung im l’Angleterre empfängt. „Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt! Nicht wahr, meine Herren?“ Die Selbstironie verfängt. Sie täuscht vor, der Kaiser sei Herr der Lage. Für einen Moment richtet er die Kleinmütigen auf. Die Gräfin Anna Potocka, deren Schwiegervater Stanislas Potocka an der Begegnung teilnimmt, notiert: „Der verführerisch-blendende Eindruck, den dieser außerordentliche Mann auf seine Zuhörer auszuüben pflegte, hatte sich abermals gezeigt: Mein Schwiegervater, der uns völlig niedergeschlagen verlassen hatte, kehrte voller Hoffnung zurück – und dabei war er doch über das Alter hinaus, in dem man sich Illusionen hingibt!“5
Napoleon ist ein glänzender Schauspieler. Wahrscheinlich war er niemals besser als jetzt in der Rolle des gestolperten Schlachtengotts. Es ist nicht wirklich etwas geschehen! Das muß er sich selbst glauben machen, damit es die anderen glauben können. Die Wahrheit würde lauten: „Meine Herren, soeben ist die größte Armee der Geschichte untergegangen.“ Doch die Wahrheit verbietet sich. Sie wäre der endgültige Untergang. Sein Großreich, das weiß er, wird durch Zwang und Überlegenheit zusammengehalten. Die Verbündeten werden in dem Augenblick abfallen, in dem er Schwäche zeigt. „Mein Reich ist zerstört, wenn ich auf höre, Furcht zu erregen“6. Das ist das unerbittliche Gesetz seiner Herrschaft. Deshalb darf er die Dinge nicht beim Namen nennen. Ein Kaiser, so erklärt er Caulaincourt in einem seltenen Augenblick der Offenheit, müsse immer en scène sein7. Das gilt jetzt mehr denn je. Die Scharade ist existenznotwendig. Aber sie birgt die Gefahr in sich, daß Rolle und Wirklichkeit sich unentwirrbar vermischen. Wie weit ist Napoleon vom Selbstbetrug entfernt?
Von Warschau jagt der Schlitten nach Dresden. Du sublime au ridicule.An keinem Ort tritt der jähe Absturz des Kaisers so brutal hervor wie in Dresden. Von hier aus war er vor einem halben Jahr nach Rußland aufgebrochen. Zuvor hatte die kursächsische Residenzstadt die glanzvollste Revue des Empire gesehen. Der Fürstentag vom 17. bis zum 28. Mai war eine Inszenierung des paneuropäischen Imperators gewesen und zugleich eine Ansicht der durch die Ereignisse von 1789 umgepflügten Welt: Napoleon Seite an Seite mit Kaiser Franz von Österreich. Bonaparte und Habsburg. Revolution und Legitimität. Der homme nouveau aus dem korsischen Irgendwo und der Souverän des ehrwürdigsten europäischen Staates. Mit dieser Begegnung machten die gloriosesten und verrücktesten zwei Jahrzehnte, die der Kontinent erlebt hat, gleichsam Inventur. Für einen Moment schien der blutige Riß der Zeit verklammert, die Koexistenz des Neuen mit dem Alten möglich. Dresden war für zwei Wochen der Mittelpunkt des Universums und Napoleon der Augustus. Jetzt, sechs Monate später, steht das Universum auf dem Kopf.
Des Kaisers Schlitten erreicht Dresden am 13. Dezember um Mitternacht. Es ist stockfinster, niemand ist auf der Straße, so daß der Postillon eine Weile braucht, bis er das Anwesen des französischen Gesandten findet. Wie der Abbé de Pradt in Warschau, so erschrickt der Graf de Serra, als er im Sekretär de Reyneval den Kaiser erkennt. Ein paar flüchtige Worte werden gewechselt. Herr de Serra findet seine Fassung wieder, Napoleon macht sich an die Arbeit. Er diktiert eine Depesche an Kaiser Franz, eine an König Murat, eine weitere an Berthier, den Generalstabschef. Ein Bote wird ins Schloß geschickt, um den König zu holen. Als Friedrich August eintrifft, hat Napoleon eine Stunde geschlafen. „Die Monarchen blieben drei viertel Stunden beieinander“, heißt es in Caulaincourts Erinnerungsprotokoll8. Um fünf Uhr, immer noch bei Dunkelheit, verläßt der Schlitten Dresden.
Die Reise ist eine Tortur. Tag und Nacht ist man unterwegs von Poststation zu Poststation. Pferdewechsel, eine warme Suppe oder ein Becher Kaffee, dann zurück in die drangvolle Enge des „Käfigs“. Am ärgsten setzt die beißende Kälte zu. Napoleon schreibt einen Brief. Weil seine Finger vom Frost erstarrt sind, kommt nur Unleserliches heraus. Ein zweiter Versuch, wieder muß er den Brief zerreißen. Bei jedem Halt die Hoffnung auf Nachrichten. Sind Stafetten da, schaut der Kaiser ungeduldig zu, wie Caulaincourt mit steifen Fingern versucht, die Geheimziffern einzustellen, die den Postsack sichern. Welche Neuigkeiten gibt es aus dem Lager der Verbündeten? Ist Paris ruhig? Was schreibt Marie-Louise? Nichts verbessert die Laune Napoleons so sehr wie ein Brief der Kaiserin.
Je weiter es nach Westen geht, desto mehr drehen sich die Schlittengespräche um die Zukunft. Napoleon ist voller Tatendrang. Er gibt Einblick in seine Pläne. Verfassungsreformen sind notwendig. Er will die Industrie heben, die letzten Spuren des Bürgerkriegs tilgen. Was er geschaffen hat, ist gut, aber noch instabil. Das gilt auch für das Fundament der Dynastie. „Frankreich braucht mich noch zehn Jahre“, erklärt Napoleon Caulaincourt. „Stürbe ich früher, dann wäre alles, ich sehe es deutlich, ein Chaos, und alle Throne würden stürzen, wenn der meines Sohnes fiele“9.
Für seine Pläne benötigt Napoleon Frieden. Zuvor aber braucht er noch eine letzte Schlacht.