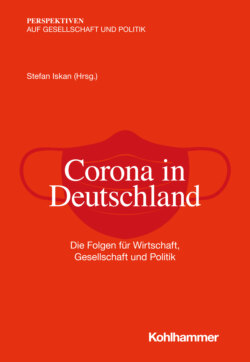Читать книгу Corona in Deutschland - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Seuche als Strafe
ОглавлениеDie erste Denkfigur begreift die Krankheit als eine »göttliche Strafe« für menschliche Verfehlungen. Daher gilt es, durch genaue Gewissensprüfung die Verfehlung zu eruieren, damit entsprechende Entsühnungsmaßnahmen die göttliche Vergebung sichern können. Die Überlieferung der alten Kulturen – von den Annalen des alten Sumer (= Kultur von ca. 6. Jahrtausend v. Chr. – 2. Jahrtausend v. Chr. im heutigen Iran) über die sieben ägyptischen Plagen bis hin zu den Vorzeichenkatalogen der römischen Republik – ist voll von entsprechenden Überlegungen, in denen Seuchen, Naturkatastrophen oder bedrohliche Vorzeichen als Strafen der Götter gedeutet wurden.
Durch Opfer, Prozessionen, Tempelbauten oder Herrschaftswechsel mussten die Vergehen gesühnt werden, bis das jeweilige Unheil abgewendet und die Götter als versöhnt gelten konnten. Bereits der Gründungstext der griechischen Literatur, die homerische Ilias (7. Jahrhundert v. Chr.), setzt mit der Beschreibung einer Seuche ein: Apollon bestraft das griechische Heer für die Verfehlungen seines Großkönigs Agamemnon. Dieses Denkmodell sollte bis in die christliche und mittelalterliche Literatur Bestand haben, als Seuchen ebenfalls als Strafen Gottes für menschliche Verfehlungen interpretiert wurden und oft zum Auslöser weitreichender religiöser Reformen werden konnten.
Interessant ist dabei, dass schon in der Antike eine Verlagerung der Argumentation vom Bereich individueller moralischer Verfehlungen hin zu einem kollektiven politischen Versagen zu bemerken ist. In Athen etwa suggeriert die berühmte Beschreibung der Pest durch Thukydides (Historiker aus dem 5./4. Jahrhundert v. Chr.), welche den Höhepunkt athenischer Selbstglorifizierung markiert, dass man die damalige Seuche als eine Strafe für die Hybris der eigenen politischen Handlungen wahrnahm. Die radikaldemokratische Politik und der Ausbau des athenischen Bündnissystems wurden von den Kritikern als skrupellose Maschinerie angesehen, die nur dazu diente, die eigene Macht auf Kosten anderer auszubauen. Und auch in Rom wurde die Antoninische Pest als Strafe der Götter für die römische Plünderung des Apollon-Tempels von Ktesiphon (= Hauptstadt des Partherreichs) angesehen.
Es ist also kaum verwunderlich, dass auch heute inmitten der Coronavirus-Krise allenthalben die Frage nach dem moralisierenden »Warum?« diskutiert wird. Zwar bleibt das Element der unmittelbaren göttlichen Strafe für individuelle sittliche Verfehlungen auf kleinere religiöse Zirkel beschränkt. Zu nennen sind etwa der auch im Westen einflußreiche radikal-muslimische Diskurs vom Coronavirus als der Strafe Allahs für die Sünden der abendländischen »Kreuzfahrernationen« oder die Uiguren-Verfolgungen der chinesischen »Polytheisten«.
Im Westen begegnet man dagegen zunehmend dem Denkmuster, wir hätten es hier mit einer Reaktion der Natur auf die schier groteske Überheblichkeit des modernen Menschen zu tun, der irrigerweise glaubt, die gesamte Schöpfung beherrschen zu können. Die Seuche selbst erscheint dabei als nahezu beliebiger Auslöser einer Krise, die sich bereits seit Jahren, ja Jahrzehnten vorbereitet hat. Folglich wird in politischen Kreisen und in den Leitmedien die Frage nach der »post-Corona-Welt« regelmäßig mit der Forderung einer »neuen Normalität« verknüpft. Diese müsse sich irgendwie durch größeren Respekt für Mitmenschen und Umwelt kennzeichnen. Dieser lobenswerte Vorsatz bedient sich der impliziten psychologischen Verknüpfung zwischen Pandemie und einer (wie auch immer gearteten) kollektiven Verfehlung. Das Narrativ der »Strafe« wird von der Seuche bedient. Es bezeichnend, dass gegenwärtig vor allem der ökologische Diskurs den Platz der vorher religiösen Argumentation übernommen hat.