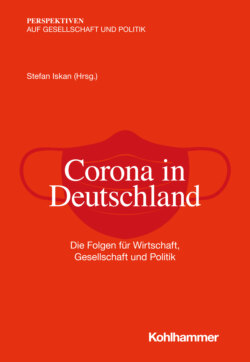Читать книгу Corona in Deutschland - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst!« Stefan Iskan
ОглавлениеEs sind Zeiten, die sich wohl kaum einer von uns hat vorstellen können. Zeiten, wie man sie allenfalls aus einem Hollywood-Blockbuster kannte. Nicht wenige sprechen sogar von einem »Albtraum« in Dauerschleife. Was lokal im chinesischen Wuhan begann, ist zu einem Jahrhundertereignis geworden: die Corona-Pandemie. Weltweit kämpfen Staaten zeitgleich gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Allein oder allenfalls in Verbünden. Und ein Ende oder gar die aus der Pandemie resultierenden Folgen sind noch keineswegs in Gänze absehbar. Deutschland, Europa und die gesamte Weltgemeinschaft sind auf einen harten Prüfstand gestellt. Alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereiche werden seit Monaten maximal gefordert: das Gesundheits-, Wirtschafts-, Sozial- und Bildungssystem.
Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 hat keine Krise zeitgleich alle Bürger betroffen. Und wohl kaum jemand hat bereits am 7. Januar 2020 geahnt, was in den kommenden Monaten auf jeden einzelnen von uns zukommen würde. An jenem Tag gelang es der World Health Organization (WHO) zufolge chinesischen Behörden den Erreger 2019-nCoV zu identifizieren (WHO online 2020a): das neuartige Coronavirus, das als Ursache für die gemeldeten Fälle von Lungenentzündung mit bislang unbekannter Ursache ausgemacht wurde. Jene Fälle wurden seit Dezember 2019 aus der chinesischen elf Millionen-Stadt Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei, gemeldet. Es sollten weitere zwei Monate folgen, bis die Menschen realisierten: 2020 wird ein komplett »anderes« Jahr.
Am 18. März 2020 richtete Bundeskanzlerin Angela Merkel schließlich in ihrer historischen Fernsehansprache zur Corona-Pandemie einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger (Bundesregierung online 2020a):
»Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.«
Und wer bis dahin die Tragweite der Herausforderung noch nicht erkannt hatte, dem dürfte sie wohl spätestens am 23. März 2020 klar geworden sein. An jenem Tag trat die von Bund und Ländern beschlossene Kontaktsperre in Kraft (vgl. Bundesregierung online 2020b). Heute, vier Monate nach der Ansprache der Frau Bundeskanzlerin, formulieren Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: »Wir haben echt verdammtes Glück gehabt!« (vgl. Bayerische Rundfunk online 2020a). Denn aus medizinischen Gesichtspunkten scheint Deutschland in der ersten Welle verhältnismäßig noch mit einem »blauen Auge davongekommen« zu sein. Freilich: Der Verlust eines jeden einzelnen Menschen schmerzt! Doch verglichen mit den Todesfallzahlen, wie sie etwa aus den USA, Brasilien, Großbritannien, Italien, Spanien oder auch Mexiko verstärkt berichtet werden, sah das Virus in der ersten Welle in Deutschland noch verhältnismäßig beherrschbar aus. Allerdings stehen wir aktuell noch vor vielen Unbekannten mit ungewissem Ausgang: ökonomisch, sozial, politisch. Vor allen Dingen aber medizinisch. Und das auf unbestimmte Zeit.
Am 23. Januar 2020 betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den Tagesthemen der ARD unter Bezugnahme des damaligen aktuellen Kenntnisstands des Robert-Koch-Instituts (RKI), dass bei der neuen Lungenkrankheit das Infektionsgeschehen im Vergleich zur Grippe milder sei (vgl. Tagesschau online 2020a und 2020b). Am 26. Februar sah Jens Spahn schließlich die Bundesrepublik Deutschland am Beginn einer Epidemie und bat seine Ministerkollegen aus den Ländern, ihre Pandemiepläne entsprechend zu aktualisieren und gegebenenfalls auch in Kraft zu setzen (vgl. Tagesschau online 2020a und Tagesschau online 2020c). In den Tagesthemen führte der Bundesgesundheitsminister aus, dass man nicht »das gesamte öffentliche Leben in Deutschland, Europa und der Welt beenden« könne (vgl. Tagesschau online 2020a). Der weitere Geschichtsverlauf ist bekannt: Es folgte ein beispielloser Lockdown des öffentlichen Lebens und auch der Wirtschaft – weltweit und nahezu zeitglich. Seither ist eine regelrechte »Aufmerksamkeitsökonomie« unter Virologen und »Crash-Propheten« entbrannt.
In den folgenden 14 Tagen folgte der Exportstopp medizinischer Schutzausrüstung durch den Krisenstab der Bundesregierung (4. März). Der Appell an Veranstalter, Großevents mit mehr als 1 000 Teilnehmern abzusagen und die Warnung vor Reisen nach Italien (10. März). Deutschlands Leitindustrie, die Automobilindustrie, wurde systematisch und regelrecht kontrolliert heruntergefahren. Das war insbesondere in der Woche vom 16. bis zum 21. März gut zu beobachten. Die letzten Fließbänder wurden am
Abb. 1: Der Zeitstrahl zeigt in komprimierter Form ausgewählte Ereignisentwicklungen von Januar bis Juni 2020. Aufgrund der Komplexität und teilweise weltweit synchron erfolgten Geschehnisse kann an dieser Stelle keine vollumfängliche Darstellung gewählt werden (vgl. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle online 2020, Bundesgesundheitsministerium online 2020, New York Times online 2020, Tagesschau online 2020d, Tagesschau online 2020e und Tagesschau online 2020f). Quelle: Eigene Darstellung.
Samstag gestoppt. Am Montag darauf trat schließlich die von Bund und Ländern beschlossene Kontaktsperre in Kraft (23. März).
Gerade diese Bilder dürften viele Menschen noch vor Augen haben: Weil die örtlichen Friedhöfe in Bergamo überfüllt waren, transportierte die italienische Armee Corona-Tote ab (vgl. Bayerischer Rundfunk online 2020b und Südtirol News online 2020). Nach Ausbruch des Coronavirus und des damit verbundenen Ausnahmezustandes sind in Norditalien die Versorgungsketten der Supermärkte und damit der Bevölkerung punktuell zusammengebrochen. Bürgerkriegsähnliche Zustände, die in den hiesigen Medien nicht transportiert wurden, waren die Folge. Inzwischen ist die italienische Volkswirtschaft wie die gesamte Weltwirtschaft von den Folgen der Pandemie stark getroffen (vgl. Germany Trade and Invest online 2020). Nicht wenige Ökonomen erwarten, dass die Weltwirtschaft auf die schwerste Rezession seit der »Great Depression« von 1929 zusteuert. Einem »Schreckens-Zustand«, dem sich alle Regierungen und Notenbanken seit Beginn der Corona-Krise mit aller Kraft entgegenstemmen.
Wie in Italien waren beispielsweise auch im Elsass die Notaufnahmen in den Krankenhäusern so sehr überlastet, so dass eine Triage wie unter Kriegszuständen erforderlich war. Als Triage wird dabei in der Notaufnahme die Methodik beschrieben, anhand derer Notfallpatienten in sehr kurzer Zeit nach Behandlungsdringlichkeit priorisiert und verfügbaren Behandlungsressourcen zugeordnet werden (vgl. Christ u. a. 2010, S. 892). Berichte machten die Runde, wonach älteren Notfallpatienten Beatmungsgeräte zugunsten jüngerer COVID-19-Erkrankter weggenommen und diese Menschen damit ihrem Schicksal überlassen wurden. Es fällt schwer, sich auszumalen, welchen physischen vor allem aber auch psychischen Belastungen das medizinische Personal in diesen Situationen ausgesetzt war.
Zeitgleich war vielerorts in Deutschland zu hören: »Dieses Virus ist doch ein Witz. Viel schlimmer wiegt, dass mein Lieblings-Golf-Club gerade schließt. Und was soll ich jetzt machen?« Oder: »Das Coronavirus tötet nur alte Menschen und die werden sowieso sterben. Das entlastet endlich unsere Rentenkassen« (sinngemäß und Wortlaut nach diversen Foreneinträgen und Berichten im Internet wie etwa Refinery29 online 2020).
Heute wissen wir: Eine Coronavirus-Infektion kann jeden treffen. Allerdings gibt es altersabhängig unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, im Anschluss daran auch eine COVID-19-Erkrankung zu entwickeln. Und auch der Verlauf von COVID-19 und mögliche Komplikationen sind von Risiken abhängig. Dazu zählen neben dem Alter auch bestimmte Vorerkrankungen. Es muss also zwingend zwischen Infektion und Erkrankung unterschieden werden (siehe hierzu auch Timo Ulrichs in diesem Buch).
Zu Beginn der Corona-Krise fanden Politiker drastische, ja sogar martialische Worte. Nicht selten wurde der Krieg als Vergleich bemüht. Ein »Krieg gegen das Coronavirus«, wie es etwa Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron angesichts der damaligen Lage in seinem Land formulierte (vgl. Deutschlandfunk online 2020). Und Papst Franziskus sah die Europäische Union angesichts des Coronavirus gar vor »einer epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt«, (vgl. Domradio online 2020).
Den Worten folgten Taten: Länderübergreifend wurden Maßnahmen und Einschränkungen ergriffen, die in der Tat an »Kriegszeiten« erinnern können. In den USA hatte Präsident Donald Trump das »Defense Production Act« aktiviert (vgl. The White House online 2020). Das Gesetz, das es dem Staat erlaubt, dringend benötigte Produkte von Unternehmen fertigen zu lassen. Und auch in Deutschland hat man zu Beginn der Pandemie immer wieder aus dem Konzern-Umfeld erfahren, dass die Produktion etwa von Beatmungsgeräten, Schutzausrüstung oder Desinfektionsmittel geprüft werden würde.
Militär-bezogene Themen standen auch außerhalb von »Kriegsregionen« zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im Blick. Am 4. März 2020 legte das Verteidigungsministerium den ersten Bericht über extremistische Verdachtsfälle in der Bundeswehr vor. Im Blickpunkt stehen hier staatsfeindliche Einstellungen, wie etwa Reichsbürgertum oder auch Rechts- und Linksterrorismus (vgl. Bundesministerium für Verteidigung online 2020). Im gleichen Zuge wurde und wird bis heute immer wieder von rechtsextremen Verdachtsfällen im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) in Calw berichtet, denen der Militärische Abschirmdienst MAD entsprechend nachgeht (vgl. Bundeswehr online 2020a und Deutscher BundeswehrVerband online 2020). Am 19. März 2020 und damit kurz vor dem Lockdown hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer zudem im Zuge einer Razzia in zehn Bundesländern erstmals bundesweit eine Reichsbürger-Gruppierung verboten (vgl. ZDF online 2020). Diese Themen sind deswegen von Relevanz, da sich im Zuge der Lockerungen seit etwa Mai unterschiedliche Demonstrationsströmungen gegen die eingeschlagene »Corona-Politik« gebildet haben. Während einige beispielsweise gegen eine Impfpflicht protestieren, werden laut Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt auch Veranstaltungen wahrgenommen, die von Rechtsextremisten unterwandert werden sollen (vgl. Welt online 2020).
Die Verunsicherung unter den Menschen ist groß. Und sie war es vor dem Lockdown auch – jedoch möglicherweise aus einem anderen Grund. Lange Güterzüge mit militärischem Gerät, wie etwa Panzern, waren kurz vor dem Lockdown zu sehen. Darunter auch Panzerkolonnen in der Nähe des damals heruntergefahrenen Stuttgarter Flughafens. Einige vermuteten in den sozialen Netzwerken, dass die Panzer im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Lockdown und damit der Absicherung »systemrelevanter Infrastruktur, Medienhäuser und Fabriken« zusammenhängen würden. Es sollte sich später herausstellen, dass diese noch logistische Ausläufer der am 13. März 2020 eingestellten NATO-Übung »Defender Europe 2020« waren. Jene Übung, welche durchaus auch abseits der großen Berichterstattung die größte Truppenverlagerung der USA nach Europa seit 25 Jahren sein sollte. Als logistische Drehscheibe war Deutschland in dieser Übung im Zentrum gestanden (vgl. Bundeswehr online 2020b).
Der Aspekt der bereits im Vorwort angerissenen »Systemrelevanz« der Logistik kam aber auch an anderen Stellen zum Vorschein. Etwa in Form abgerissener Lieferketten in der Industrie kurz vor dem Lockdown. In der Absicherung der Versorgung von Supermärkten. Im massiven Umrüsten von Passagierflugzeugen zu »reinen« Frachtmaschinen, um weltweit Fertigungsanlagen, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung für die Corona-Pandemie verfrachten zu können. Meldungen von verschwundenen, konfiszierten und von Regierungen dringend erwarteten Sendungen mit Schutzausrüstung machten die Runde (vgl. Tagesschau online 2020g). An der deutschpolnischen Grenze staute sich im Zuge der Grenzschließungen vor dem Lockdown die Lkw-Abfertigung auf bis zu 60 km (vgl. Deutsche-Verkehrs-Zeitung online 2020). Bilder, wie wir sie sonst nur aus krisen-geplagten Regionen dieser Welt kennen dürften.
Aber auch in anderer Hinsicht zeigte sich die »Systemrelevanz« der Logistik: um etwa »gestrandete« Deutsche zurückzuholen, hatte das Auswärtige Amt im März ein beispielloses Rückholprogramm gestartet. Bis zum 24. April 2020 wurden rund 240 000 Bürgerinnen und Bürger eingeflogen. Mitte Juni machten in diesem Zusammenhand dann Meldungen die Runde, wonach das Auswärtige Amt nachträglich die Kosten weiterbelasten würde (vgl. Tagesschau online 2020h). Und während in Deutschland die Menschen zu Beginn der Pandemie damit beschäftigt waren, vordergründig Toilettenpapier, Nudeln, Konserven und Mehl zu »hamstern«, haben sich die Bürger in anderen Staaten, wie etwa den USA und Ungarn, weiter mit Waffen eingedeckt – aus Angst vor Unruhen (vgl. NTV online 2020).
Auch weitere negative Schlagzeilen machten die Runde. So etwa ein Sportartikelhersteller, der vorgeprescht war, als die Bundesregierung über etwaige Neuregelungen in der Corona-Krise, allen voran zur Miete und zum Verbraucherschutz ab April, informierte (Bundesregierung online 2020c). Manches Großunternehmen, wie etwa der Sportartikelhersteller, konnte es in der Folge kaum abwarten, zu verkünden, dass man die Miete für geschlossene Läden ab April nicht mehr bezahlen würde. Erst der öffentliche Druck sorgte für eine Klarstellung der Sachlage bzw. ein Umdenken (vgl. Absatzwirtschaft online 2020).
Und heute? Heute lassen sich Unternehmen finden, die in Büros »zum Schein« desinfektionsähnliche Produkte aufstellen, um »formal« etwaige Hygieneauflagen zu erfüllen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Viele ihrer Mitarbeiter befinden sich trotz Lockerungen noch immer im »auf einmal möglich gewordenen« digitalen Homeoffice. Aber auch Verdachtsfälle kommen auf, in denen Unternehmen zwar für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld anmelden, diese jedoch voll durcharbeiten lassen.
Und die Börsen? Im März noch herrschte eine regelrechte »Weltuntergangsstimmung« an den Finanzmärkten. In Folge des »Doppelschlags« vom 9. März und 12. März 2020 erlebte der deutsche Leitindex DAX den schnellsten Tagesverlust in seiner Geschichte. Grund war die sich zuspitzende Corona-Krise und ein »Preiskrieg« am Ölmarkt. Alles, was schnell den »Cash-Bestand« erhöhte, wurde schließlich hektisch verkauft. Aktien. Edelmetalle. Rohstoffe. Doch wer glaubte, die Börse würde angesichts der abgestürzten Realwirtschaft im Tal der Tränen verharren, der staunte nicht schlecht als ab Mitte Mai eine »neue« Rallye an den Finanzmärkten zu beobachten war.
Seither kennt die Börse weitgehend wieder nur eine Richtung: und zwar nach oben. Hoffnung und Optimismus in den Kursen, wie es professionelle Marktbeobachter immer wieder bezeichnen, scheinen überhandzunehmen. Und das obwohl es gegenwärtig kaum positive Lichtblicke aus der Realwirtschaft zu vermelden gibt. Ja sogar das Infektionsgeschehen scheint in Deutschland Richtung Ende Juni wieder deutlich zuzunehmen. Vor einer möglichen zweiten Welle wurde von Seiten der Virologen schon länger gewarnt. Einzelne Städte und Regionen werden wieder in einen lokalen bzw. regionalen »Lockdown Light« überführt (vgl. Tagesschau online 2020h). Und Unternehmensvertreter befürchten: Sollte es zu einer zweiten Welle mit einem zweiten harten »Lockdown« kommen, dann könnte es in der Wirtschaft »erst so richtig hässlich« werden.
Vor dem Hintergrund dieser skizzierten Situationsbeschreibung stellt sich nun die Frage, wie sich Deutschland inmitten der großen
Abb. 2: Die »Corona-Pandemie« als interdisziplinäres Themenfeld: Aufbau des Buches. Quelle: Eigene Darstellung.
Pandemie entwickelt. Und vor allen Dingen, welche Perspektiven sich hieraus für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für die bevorstehende Zeit ergeben.
Folgende Fragestellungen sind daher für die nachfolgenden Beiträge leitend:
Historisch: Gab es in der Geschichte bereits vergleichbare Phänomene? Und was können wir aus historischen Vergleichen lernen? Medizinisch: Wie schnell bzw. lässt sich der Coronavirus in den Griff kriegen? Was wissen wir und welche Maßnahmen sind überhaupt sinnvoll? Ökonomisch: Wie ist es um die Wirtschaft bestellt und welche Szenarien liegen dem Weg aus der Corona-Krise zugrunde? Technologisch: Wie wirken sich die Folgen des Coronavirus auf die technische Infrastruktur und die weitere digitale Transformation aus? Und führt die Corona-Krise zu einer Beschleunigung in der Digitalisierung und Automatisierung? Politisch: Was kann und muss die Politik in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und Radikalisierung unternehmen? Und zuletzt medial: Welche Rolle kommt der Berichterstattung in der Corona-Krise zu? Wie sehr ist die sachliche Berichterstattung von »Framing« geprägt? Die Struktur des Buches wird in Abb. 2 bildhaft widergegeben.