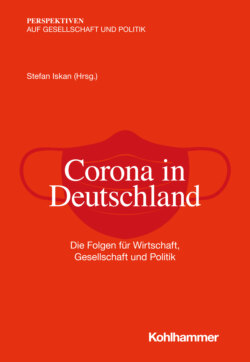Читать книгу Corona in Deutschland - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kampf gegen die Seuche
ОглавлениеNeben der Entsühnung der eigenen Sünden und der Ausweisung von Sündenböcken standen aber auch in der Vergangenheit bereits andere, aus einer materialistischen Perspektive »rationellere« Mittel zur Bekämpfung einer Seuche zur Verfügung.
Die Abriegelung des eigenen Herrschaftsgebietes war eine erste, logische Maßnahme, um Kontakt mit von der Krankheit betroffenen Territorien zu verhindern. Diese altbewährte Taktik wurde beispielsweise bereits von Marc Aurel angewandt, der versuchte, Italien während der Antoninischen Pest abzuriegeln. Und auch König Kasimir III. (1310–1370) verordnete vor dem Hintergrund des »Schwarzen Todes« die Grenzschließung Polens: Seiner Maßnahme verdankte das Land, weitgehend unbeschadet der Pest entgangen zu sein. Wahrscheinlich erklärt diese historische Erfahrung die schnelle und harte polnische Grenzschließung im Jahre 2020. Und in der Tat scheint auch diese Maßnahme von ähnlichem Erfolg gekrönt zu sein, denn in Polen sind die Zahlen von Covid-19-Erkrankungen (bislang) auffällig niedrig.
Neben der Isolierung der Krankheit durch Schließung der Grenzen wurde in der Vergangenheit gleichzeitig oft auch eine Isolierung der Kranken selbst veranlasst. Diese wurden in eigens errichtete Krankenhäuser oder Quarantäneanlagen gesperrt Man denke etwa an den Tempel des Heilgottes Aesculap auf der Tiberinsel in Rom mit angeschlossener medizinischer Anlage oder an die unter Marc Aurel belegten Quarantäne-Lager mit ausgedehnten Thermalbereichen für die von der Antoninischen Pest befallenen Truppen. Diese Anlagen wurden aus Anlass einer grassierenden Seuche errichtet und stellen offensichtliche Vorläufer der in Wuhan wie auch anderswo eigens errichteten Coronavirus-Krankenhäuser dar.
Seuchen stellten aber auch seit jeher ein großes Risiko für das jeweilige Wirtschaftsleben dar. Versuche der Wirtschaftssteuerung im Kontext von Katastrophen findet man etwa, als nach dem Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. ein Stadtbrand und schließlich eine schwere Seuche ausbrach. Titus, der damals regierende Kaiser, reagierte in dieser Situation überaus offensiv und entschied, dass das Vermögen der beim Ausbruch des Vesuvs ohne Erben Umgekommenen zur Wiederherstellung der heimgesuchten Städte eingezogen werden sollte, verkaufte nach dem Brand von Rom eigenes Gut, um öffentliche Gebäude wiederherzustellen und »ließ kein Mittel der Religion und Arzneiwissenschaft unversucht, indem er alle Arten von Sühneopfern und Heilmitteln anwandte«, wie Sueton (Historiker 2. Jahrhundert n. Chr.) schrieb.
Nachdem die Antoninische Pest den damals schwunghaften Handel mit dem Süden Indiens fast ganz zum Erliegen gebracht hatte und die eben aufgenommenen Beziehungen zum chinesischen Reich zu einem vorzeitigen Ende gekommen waren, brach eine schwere Wirtschaftskrise im Römischen Reich an, von deren Folgen es sich nie mehr ganz erholen sollte. Kurze Zeit später, 250–271 n. Chr., brach die Seuche in Gestalt der Cyprianischen Pest nämlich erneut aus. Dabei lassen sich klare Interdependenzen zwischen den Pestepidemien, hieraus folgenden Inflationen, der Verringerung des Silbergehalts in der römischen Münzprägung zur Deckung der gestiegenen Kosten und schließlich der Hortung höherwertiger älterer Prägungen durch die Bürger beobachten. Vor dem Hintergrund dieses Teufelskreises vermochte das römische Reich dem gleichzeitig stetig steigenden Druck auf die Außengrenzen nur durch zwangsstaatliche Maßnahmen zu begegnen. Im Jahr 301 n. Chr. erließ Kaiser Diokletian ein Höchstpreisdikt, welches die damals grassierende Inflation zu bremsen suchte, indem für jedes Produkt ein Höchstpreis festgelegt wurde. Diese und ähnliche Maßnahmen trachteten die bis dato freie durch eine zunehmend staatsgesteuerte Wirtschaft abzulösen.
Auch hier lassen sich zumindest formal kaum Unterschiede zur Bandbreite der gegenwärtigen Maßnahmen erkennen: Sondersteuern, Zusammenbruch von internationalen Lieferketten, Inflation, direkte und indirekte Geldschöpfung, künstliche Preisfixierung, der Versuch, private Großzügigkeit öffentlichkeitswirksam zu inszenieren – blickt man in die Geschichte, findet sich wenig Neues unter der Sonne.