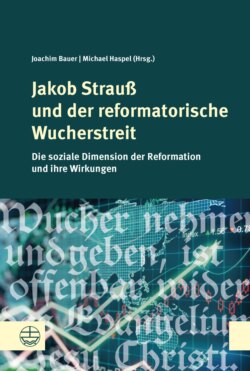Читать книгу Jakob Strauß und der reformatorische Wucherstreit - Группа авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINLEITUNG
ОглавлениеZins und Wucher spielten in den Auseinandersetzungen der Reformationszeit eine nicht unerhebliche Rolle. Ihre Bedeutung für die soziale Attraktivität reformatorischer Initiativen wird in der gegenwärtigen Rezeption der Reformation in Forschung, Kirche und Öffentlichkeit hingegen wenig beachtet. Der Eisenacher Reformator Jakob Strauß, Prediger an der Georgenkirche, hat 1523 51 Artikel gegen den Wucher veröffentlicht. Er wendet sich dabei nicht nur gegen überhöhte Zinsen, sondern verurteilt Geldverleih für Zinsen generell als nicht schriftkonform. Er schließt die damals üblichen Formen das Wucherverbot zu umgehen, wie etwa den Wieder- bzw. Rentenkauf, in seine Kritik ausdrücklich ein. Beim Rentenkauf wurde das Verleihen von Geld gegen Zinsen als Kaufgeschäft dargestellt. Als Sicherung diente in der Regel eine Immobilie, oft das Ackerland, von dem eine bäuerliche Familie lebte. Wurde dies im Falle des Zahlungsverzuges gepfändet, waren die Eigentümer oftmals in ihrer Existenz bedroht. Gleichwohl wurde der Rentenkauf von der römisch-katholischen Kirche und reichsrechtlich zunehmend akzeptiert.
Ein wesentlicher Grund für die Zunahme von Finanzgeschäften ist die Entwicklung der Geldwirtschaft seit dem 12. Jahrhundert. Durch Fernhandel, Kreuzzüge und Kriege und nicht zuletzt die Entwicklung der herrschaftlichen Höfe und der Kathedralbauten gewinnt Geld enorm an Bedeutung und verschiedene Formen von Krediten entfalten sich. Die entstehenden staatlichen Strukturen befördern deshalb die Entrichtung der Abgaben in Geld statt in Naturalien.
Neben jüdischen Geldverleihern und den Klöstern treten in diesem Kontext auch christliche Geldverleiher hinzu, die teilweise in Konkurrenz zu den jüdischen geraten. In diesem Zusammenhang verstärken sich anti-judaistische Klischees, obwohl über lange Zeit das Verleihen von Geld durch Juden an Christen als feste gesellschaftliche Institution angesehen wurde.
Theologie und Kirche sahen sich durch die wirtschaftliche Entwicklung herausgefordert, einerseits das biblische Zinsverbot aufrechtzuerhalten, andererseits aber auch das wirtschaftlich notwendige Kreditwesen zu ermöglichen. Hier hat es in der Scholastik durchaus produktive Ideen, etwa bei Gabriel Biehl und auch bei Luthers Kontrahenten Johann Eck gegeben.
Strauß und Luther nehmen hier konservative Positionen ein. Sie halten mit Aristoteles Geld an sich nicht für fruchtbar – was nicht unbedingt der ökonomischen Praxis gerade im Süden und Westen Europas entsprach. Deshalb traten sie für die Durchsetzung des biblischen Zinsverbotes beim Geldverleihen ein, akzeptierten allerdings moderate Pachtzinsen auf Land und Immobilien. So können wir vorläufig festhalten, dass sich im reformatorischen Wucherstreit theologische Fragen, insbesondere das Bibelverständnis, mit ökonomischen, insbesondere der Geldtheorie, mischen.
Hinzu kommt eine weitere Dimension. Die höhere Abgabenlast, Missernten und die Pest hatten schon im 15. Jahrhundert die Schuldenlast in großen Teilen der Bevölkerung erhöht. So wird es auch aus Eisenach berichtet. Die Wucher-Kritik von Jakob Strauß hatte also wesentlich eine soziale Dimension. In Eisenach kommt hinzu, dass seine Artikel nicht etwa gegen Banken und Spekulanten, sondern gegen die geistlichen Herren in Eisenach gerichtet sind, die Geld und Land für hohe Zinsen vergeben. So richtet sich Strauß’ Wucherkritik nicht gegen jüdische Geldverleiher, wenn auch anti-jüdische Ressentiments in seinen Schriften erkennbar sind.
Viele Bürger wurden, etwa wenn durch Missernte die Zahlungen nicht geleistet werden können, überschuldet und Strauß versucht hier Gerechtigkeit zu schaffen. Er prangert aber nicht nur das Zinsnehmen an, sondern vertritt die Auffassung, dass auch diejenigen, die Zinsen geben, Sünde tun. Deshalb ist für Jakob Strauß die Zinsfrage primär eine theologische und erst sekundär eine sozialethische. Für ihn ging es um die Frage, welches Handeln aus dem Glauben folgt. Entscheidend ist für ihn ein wörtliches Verständnis der Bibel und er unterscheidet – anders als Luther – nicht zwischen der Sphäre des Glaubens und der Sphäre der Politik und Wirtschaft.
In der damaligen Situation ist das sozialer Sprengstoff. Und für die Mehrheit der Menschen eine attraktive Option, ihre sozialen Probleme zu lösen und gleichzeitig das Seelenheil zu gewinnen. Die reformatorische Botschaft Strauß‘ hat die kirchliche Praxis der römisch-katholischen Kirche und deren Finanzierungsgrundlage zugleich im Kern angegriffen. Auch die Finanzierung der weltlichen Herrschaft war dadurch bedroht.
Die Wucher-Frage ist auch insofern reformationsgeschichtlich spannend, weil sie zumindest indirekt mit der Ablassproblematik verbunden ist. Beides waren wichtige Einnahmequellen der Kirche. Viele derer, die den Ablass für richtig erachteten, hielten auch das Zinsnehmen für erlaubt, z. B. Luthers Gegner Johann Eck, der eng mit den Fuggern in Beziehung stand.
Die sozialethische Dimension der theologischen Auseinandersetzungen in der Reformationszeit wird meist wenig beachtet. Aber sie war wichtig, denn die hohen Zinsen hielten diejenigen, die kein eigenes Kapital und keinen Landbesitz hatten, oft über Generationen hinweg in Abhängigkeit und Armut. Und für viele Menschen damals in Eisenach und Mitteldeutschland werden die theologischen Begründungen vermutlich nicht immer durchschaubar gewesen sein. Sie haben wohl auch deshalb so enthusiastisch auf die Botschaft der Reformatoren gehört, weil die geistliche Freiheit auch Befreiung aus weltlichen Zwängen verhieß.
Mit Strauß in Eisenach begegnen wir einem eigenständigen Reformator, dessen reformatorische Kritik sich nicht auf die Wucherfrage beschränkt, sondern auch die Reform der Buße, der Sakramente und des Gottesdienstes umfasst. Damit gehört er zu den Reformatoren, die im Thüringer Raum bis 1525 die reformatorische Bewegung prägen und durchaus eigene und andere Akzente als Luther und die Wittenberger Theologen setzen. Erst der Bauernkrieg hat Herzog Johann veranlasst, die reformatorische Bewegung gemäß dem Wittenberger Modell zu zentralisieren und in das territorialstaatliche Herrschaftsgefüge domestizierend einzufügen.
Die reformatorischen Ansätze waren in dieser Hinsicht wirtschaftlich attraktiv: Man brauche keinen Ablass mehr kaufen, um das Seelenheil zu erlangen, man brauche den geistlichen Herren keine Abgaben mehr entrichten und schließlich auch keine Zinsen mehr bezahlen.
Diese Zusammenhänge und die daraus resultierenden Fragen wurden in der Tagung »Vom Wucher zur Internationalen Finanzkrise. Die soziale Dimension der Reformation und ihre Wirkungen« aufgegriffen, die vom 11.–13.November 2016 in Eisenach gemeinsam von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Evangelischen Akademie Thüringen veranstaltet wurde. Dabei kam es einerseits darauf an, die historischen Ereignisse in Eisenach weiter zu erhellen und in den weiteren Zusammenhang der Reformation und deren Historiographie einzuordnen. Andererseits wurde bewusst versucht, die Themen auch diachron zu verfolgen und nach Wirkungen in der weiteren Geschichte und sogar Anknüpfungspunkte an die gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten zu identifizieren. Die Beiträge der Tagung werden nun der weiteren Öffentlichkeit in diesem Band zugänglich gemacht.
Für die Einordnung des Wucherstreits in die reformatorischen Geschehnisse ist die Analyse der Sakraltopographie Eisenachs im 15. und 16. Jahrhundert von großer Bedeutung. Denn ein wichtiges Argument, warum der Wucherstreit gerade hier stattgefunden hat, war bislang die hohe Dichte an Klerikern. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass bis zu 10 Prozent der Bevölkerung dem geistlichen Stand angehört haben. Diese Perspektive hinterfragt Thomas T. Müller in seinem Beitrag »Wucherstreit im Pfaffennest. Anmerkung zur Vor- und Frühreformation in Eisenach« und korrigiert sie in seinen Ausführungen nach unten. Entscheidend für den Wucherstreit bleibt dennoch, dass sich ein Großteil des Grundbesitzes in der Hand der geistlichen Korporationen befand und dieser wohl zu erheblichen Zinsen verpachtet wurde. Da die Schuldverhältnisse über Generationen hinweg ihre Fortsetzung fanden, gestaltet sich die Situation immer unklarer. Manche Häuser und manche Äcker waren so mit Erbzins belastet, dass sie nicht mehr wirtschaftlich bewohnt bzw. bewirtschaftet werden konnten. Vor diesen realen sozialen Verhältnissen ist der Wucherstreit in Eisenach besser zu verstehen.
Die politischen Verhältnisse und Zuständigkeiten untersucht Dagmar Blaha in ihrer Analyse »Die Beziehungen Eisenachs zum Weimarer Hof unter Johann dem Beständigen«. Eisenach, das sich seit dem 12. Jahrhundert zu einer reichsfürstlichen Residenz entwickelt hatte, erlebte seit der Verlagerung der Residenz nach Weimar ab dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts einen Niedergang. In Weimar war mit der Mutschierung (Verwaltungsteilung unter Beibehaltung des gemeinsamen Besitzes) zwischen Kurfürst Friedrich von Sachsen und seinem Bruder, Herzog Johann, ein zweites Herrschafts- und Verwaltungszentrum im Territorium des Kurfürstentums Sachsen entstanden. Von hier aus verwaltete Herzog Johann die thüringischen, fränkischen und Teile der vogtländischen Besitzungen der Ernestiner. Sein Beauftragter und Verbindungsmann im Gebiet um Eisenach war der Amtmann. Ebenfalls war der Schultheiß wichtig, der in der Stadt die Rechte des Fürsten stellvertretend für ihn auch gegenüber dem städtischen Rat wahrnahm. Diese, im Beitrag vorgestellte Konstellation, hatte erheblichen Einfluss auf den Verlauf und die Behandlung des Wucherstreites am Weimarer Hof.
In ihrem Beitrag »Die Soziale Frage in der Reformationszeit« geht Siegrid Westphal davon aus, dass es eine Wechselwirkung von sozialer Entwicklung und Reformation gab. Allerdings wurde diesem Zusammenhang in der Reformations- und Lutherforschung bislang wenig Aufmerksamkeit zuteil. Ein wichtiger Faktor war die demographische Entwicklung. Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert setzt ein Bevölkerungsanstieg ein, wodurch besonders klein- und unterbäuerliche Schichten wachsen. Die Löhne sinken, die Preise steigen. Die verarmende Landbevölkerung zieht in die Städte. Dies kann man daran erkennen, dass dort Bettelordnungen festgelegt werden.
Ein wichtiger Faktor war, dass die Erträge der Landwirtschaft von Grundherren und Pächtern durch Zinsen und Abgaben, die zunehmend auch als Geldzahlung gefordert werden, verstärkt abgeschöpft werden. Dies führte zur Überschuldung und verstärkte die Zins-/Wucherproblematik. Mit diesem Beitrag wurden die bislang lokal erhobenen Befunde in eine überregionale Perspektive eingefügt. Dabei kann man sehen, dass der Eisenacher Wucherstreit exemplarisch für vielfältige soziale Konflikte, nicht zuletzt im Zusammenhang der Zins- und Wucherproblematik, steht.
Zur Erschließung des Themas müsse man, so Joachim Bauer in seinen einleitenden historiographischen Anmerkungen seiner Abhandlung »Die Bedeutung von Jakob Strauß in der frühen ernestinischen reformatorischen Bewegung«, bereit sein, alternative reformatorische Ansätze neben Luther zu akzeptieren. Die gegenwärtige wissenschaftliche, kirchliche und gesellschaftliche Diskussion im Rahmen des Reformationsgedenkens sei noch viel zu sehr dem 19. Jahrhundert mit seinem Luther-Nationalmythos verhaftet. Die christlich-soziale Dimension der Reformation bleibt dabei viel zu wenig berücksichtigt.
Demgegenüber sei – insbesondere im Thüringer Raum – mit einer reformatorischen Vielfalt zu rechnen, da hier, anders als im Kurkreis des ernestinischen Territoriums, bis 1525 keine Vereinheitlichung und Zentralisierung durch die Wittenberger Theologie stattgefunden hat. Offensichtlich war Johann, mehr als sein Bruder Friedrich, aktiv an der reformatorischen Umgestaltung seines Territoriums und dabei durchaus an unterschiedlichen Ansätzen interessiert. Dabei spielte die Gruppe der Prediger eine besondere Rolle. Dies gilt eben auch mit Blick auf Eisenach und Jakob Strauß. Man kann etwa an den Reise- und Logisabrechnungen der fürstlichen Kasse nachweisen, dass Strauß vielfach als Berater Johanns in der Weimarer Residenz weilte. Nur so kann man sich auch erklären, dass Johann ihn mit der ersten Visitation im Eisenacher Amt beauftragt hat. Darüber hinaus wird erkennbar, dass der Wucherstreit nicht nur eine lokale Bedeutung hatte, sondern dass er Ausdruck eines eigenen umfassenderen reformatorischen Ansatzes von Jakob Strauß war. Strauß hat zudem seinen eigenen theologischen Überlegungen und Überzeugungen entsprechend den Gottesdienst, die Sakramente, das Kirchenwesen in Eisenach reformiert und steht damit für einen wichtigen Beitrag zur frühen reformatorischen Bewegung im ernestinischen Territorium.
»Die Diskussion um den Wucher in ihrer Bedeutung für die von Wittenberg ausgehende Reformation« stellt Stefan Michel in seinem Beitrag vor. Eingangs analysiert er die Bedeutung der Kirche in den wirtschaftlichen Konflikten vor der Reformation und stellt fest, dass es auf Grund der Stellung der Klöster einen wirtschaftlich begründeten Anti-Klerikalismus gab. Insbesondere die Städte wurden durch die Privilegien der Klöster und durch ihren enormen Landbesitz im Umfeld der Städte in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Durch Pacht- und Zinsgeschäfte fiel oft verpfändetes bzw. beliehenes Land in die Hände der Klöster, deren Besitz dadurch stetig wuchs. Dies brachte die Bürger nicht selten in Abhängigkeit. Michel exemplifiziert dies am Beispiel eines Konfliktes der Stadt Grimma mit dem dortigen Augustinerkloster. Vor diesem Hintergrund entfaltet er dann den Standpunkt Martin Luthers zu Besitz und Wucher.
Am Beispiel des Geldverleihers Shylock aus Shakespeares »Kaufmann von Venedig« macht Fritz Backhaus in seinem Artikel »Die Entwicklung des Wuchertopos zur antijüdischen Polemik« die im 16. Jh. virulenten anti-jüdischen Stereotypen deutlich.
Auch bei Jakob Strauß bildet die Stereotype des »jüdischen Wucherers« die negative Folie für die Christen und seine Wucherkritik und auch Luther rezipiert und reflektiert diese Stereotype. Diese Polemik steht allerdings im Widerspruch zur realen Situation. Es gab auf Grund der Pogrome kaum noch größere jüdische Gemeinden. Juden waren faktisch gesellschaftlich kaum präsent und spielten in weiten Teilen Deutschlands keine herausragende Rolle im Geldgeschäft. Mehr noch, die jüdische Bevölkerung war insgesamt gefährdet und lebte überwiegend in prekären Verhältnissen. Man kann also schon für das 16. Jahrhundert von einem Antijudaismus ohne Juden sprechen.
Auch im modernen Antisemitismus, der sich von der ursprünglich vermeintlichen religiösen Begründung löst, wird die Stereotype des jüdischen Geldverleihers propagiert. Sie verbindet so alten und neuen Antisemitismus.
In seinem Beitrag »Vom Wucherstreit zur aktuellen Krise der globalen Finanzwirtschaft« schlägt Maximilian Kalus den Bogen von der Finanzkrise im Frühkapitalismus der Reformationszeit in die Gegenwart – und entdeckt bei allen Unterschieden doch auch etliche Entsprechungen. Zunächst ordnet er den Eisenacher Wucherstreit wirtschafts- und sozialhistorisch ein, um so die Grundlage für einen Vergleich mit der Gegenwart zu schaffen. Er argumentiert, dass in Deutschland die Geldmenge durch Silber gedeckt werden konnte, anders als etwa in Frankreich, wo Wechsel, also Buchgeld notwendig waren, um die Geldmenge zu erhöhen. So wurde realwirtschaftlich das Bankenwesen notwendig, um (größere) Investitionen und damit auch wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dies führte zu einer doppelten Konfliktlage für die römisch-katholische Kirche. Zum einen widersprach die empirische Notwendigkeit von Krediten der normativen theologischen Lehre der Kirche; zum anderen waren Rentengläubiger oft kirchliche Institutionen, was erheblich zum Antiklerikalismus beitrug – wie etwa auch in Eisenach.
Nach Kalus lassen sich durchaus Parallelen zwischen der damaligen wirtschaftlichen Situation und der heutigen Finanzkrise ziehen. So spielten etwa Finanzinnovationen (Derivate) eine Rolle, dadurch wächst das Risiko von Spekulation und Preisverzerrung, was wiederum zur Verschärfung sozialer Konflikte führen kann. Eine besondere Rolle spielt die Überschuldung – damals wie heute: Wenn Kredite nicht mehr bedient werden können, kann dies innerhalb kürzester Zeit zu Bankenkrisen führen, die zum wirtschaftlichen Zusammen bruch führen können. Damals wie heute.
In seinem Beitrag »Wucher. Eine biblische Erinnerung an Lk 6,27–35« analysiert Rainer Kessler eine der zentralen Bibelstellen des Wucher-Diskurses, auf die sich auch Jakob Strauß bezieht. Er macht dabei auf zwei wichtige Kontexte aufmerksam. Zum einen ist diese Textstelle im Zusammenhang mit dem Erlassjahr zu sehen. Alle sieben Jahre wurden die Schulden erlassen. Es könnte also in dem Text um eine Ermahnung gehen, Kredite auch dann zu geben, wenn ein solcher Schuldenerlass bevorsteht. Zum an deren ist aber auch ein Zusammenhang mit den Vorstellungen des Klientelwesens im hellenistischen Raum, den der Evangelist ja mit im Blick hat, wahrscheinlich. Dort war der Kredit immer an die Erwartung von Gegenleistungen gebunden. Dies wird im biblischen Text abgelehnt. Mit dieser sozialgeschichtlichen Einordnung macht Kessler deutlich, dass die Bibel insgesamt und dieser konkrete Text nicht wie ein Rezeptbuch angewandt werden können. Es bedarf der interpretierenden Übertragung und Aktualisierung. Allerdings, so Kessler, wird die Intention deutlich, dass auch im Bereich der Finanzwirtschaft nicht nur egoistische Interessen verfolgt werden sollen, sondern Regeln zum Schutz der Schwachen nötig sind, um auch die Wirtschaft nach Kriterien der Lebensdienlichkeit und des Gemeinwohls zu gestalten.
Um Sprachgewaltigkeit und Argumentationsführung nachvollziehbar werden zu lassen, erfolgt im Anhang des Bandes eine Präsentation der Streitschriften des Predigers Jakob Strauß gegen den Wucher, zusammengestellt und bearbeitet von Carlies Maria Raddatz-Breidbach. Zum einen werden Reprints im ursprünglichen frühneuhochdeutschen Wortlaut geboten. Zum anderen werden sie in einer dem heutigen Deutsch angenäherten und kommentierten Übertragung abgedruckt, die jedoch die ursprüngliche Diktion der Strauß’schen Texte weitestmöglich erkennen lässt. Deutlich geworden ist durch die Tagung und die hier versammelten Texte, über wie wenig empirisch gesichertes historisches Wissen wir immer noch hinsichtlich der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zur Reformationszeit verfügen. In unserem Falle handelt es sich ja mit Eisenach um einen herausgehobenen Ort der Reformationsgeschichte – und doch wissen wir wenig über die konkreten Verhältnisse, obwohl sie für die Einführung und Durchsetzung der Reformation entscheidend waren. Die Reformationsdekade ist zwar nun zu Ende, die eigentlichen Reformationsjubiläen kommen aber erst noch. Das lässt hoffen, dass in den kommenden Jahren mehr Energie in die Erforschung der Sozialgeschichte der Reformation investiert wird – Lutherbücher sind inzwischen ja genug erschienen. Mit Blick auf das anstehende Gedenken des Bauernkrieges wird es unumgänglich sein, diese Fragen zu vertiefen.
Wir hoffen, mit diesem Band einen Anstoß, an einigen Stellen eine Grundlage und viele Anknüpfungspunkte bieten zu können.
Es ist natürlich schwer, am Ende eines solchen Projektes so etwas wie einen inhaltlichen Ertrag zu formulieren. Aber einiges kann man festhalten. Zunächst einmal wird man nicht umhinkommen festzuhalten, dass sowohl Luthers als auch Strauß’ fundamentale Zins-Kritik auf einer verkürzten Aufnahme der biblischen Tradition beruht. Mit Blick auf die neutestamentliche Referenzstelle Lukas 6,27–35 hat Rainer Kessler in diesem Band aufgezeigt, wie das Zinsverbot der Hebräischen Bibel schon bei Jesus und seinem Zeitgenossen Rabbi Hillel auf die jeweiligen Zeitumstände angewendet und dabei unterschiedlich aufgefasst wird. Mit Blick auf den alttestamentlichen Zusammenhang, etwa 2. Mose 22,24; 3. Mose 25,35–37 und 5. Mose 23,20–21, ist anzunehmen, dass sowohl Strauß als auch Luther die Unterscheidung von Not- und Investitionskredit nicht beachten. Alle diese Stellen beziehen sich eindeutig auf einen Kredit an einen sich in Not befindlichen Angehörigen des eigenen Sozialverbandes. Da sollte es ethisch eigentlich selbstverständlich sein, dass die Not, etwa eines Familienangehörigen, nicht ausgenutzt, sondern, so möglich, selbstlos mit einem zinslosen Kredit geholfen wird. Aber gilt dies auch für rein kommerzielle Kredite?
Weder Strauß noch Luther waren in der Lage, diese Differenzierung in die Interpretation der Bibeltexte einzutragen. Beide vertraten die aristotelische Geldtheorie, nach der Geld nicht fruchtbar sein konnte. Die Vorstellung, dass eine auf Kredit beruhende Investition einen Ertrag erbringt, der einen Zuwachs des Geldes darstellt und insofern auch eine Zinszahlung rechtfertigt, blieb ihnen fremd. In dieser Hinsicht teilten sie ein verkürztes Verständnis des Kreditwesens ihrer Zeit, indem sich das Streben nach risikolosem Gewinn, das die Reformatoren zu Recht geißelten, und die Grundlage einer auf Kredit beruhenden kapitalistischen Produktionsweise mischten. Oberdeutsche römisch-katholische und reformierte Theologen waren da deutlich moderner. Luther ist von dieser Position aus pragmatischen Gründen – nicht aus prinzipiellen – abgerückt, insofern der Zins moderat blieb.
Insbesondere bei Strauß wird man nicht umhinkönnen festzustellen, dass er ein fundamentalistisches Bibelverständnis hatte und über keine entwickelte Hermeneutik verfügte. Der biblische Text war für ihn unmittelbar normativ. Weder historisch noch in seinem eigenen Zeitzusammenhang konnte er ihn kontextuell rekonstruieren und interpretieren. Dabei unterschied er auch nicht zwischen der Wortmacht des Evangeliums und der weltlich-politischen Macht des Gesetzes. In der Sache war seine Wucherkritik, soweit wir das heute beurteilen können, wohl angemessen. Die Begründungen dafür lassen sich aber schwer aufrechterhalten.
Gleichwohl wird an Jakob Strauß’ Position zum Wucher deutlich, wie wichtig soziale Faktoren – in lokal je unterschiedlicher Weise – für die Akzeptanz und Durchsetzung der Reformation waren. Ob von den Reformatoren intendiert oder nicht, die Botschaft der Befreiung wurde neben ihrer religiösen Dimension auch politisch und wirtschaftlich verstanden. An diesem Punkt ist wohl auch die Kritik aus dem Zusammenhang des theoretischen Ansatzes der »Frühbürgerlichen Revolution« nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Erwartungen, insbesondere die der Bauern und unterbäuerlichen Schichten, zum Teil des Bürgertums – ganz unabhängig davon wie berechtigt sie waren – wurden nicht erfüllt und die Menschen, mit Hinblick auf die Entwicklungen ab 1525, enttäuscht.
Spätestens ab dem Bauernkrieg ist die »Soziale Frage« von den Wittenberger Reformatoren nicht ausreichend beachtet und nicht mehr mit dem Anliegen der Reformation der Kirche und der Gesellschaft verbunden worden. Luthers eigener theologischer Ansatz und seine frühen Schriften hätten dazu gleichwohl eine gute Grundlage liefern können. Diese sozialethische Abstinenz hat wohl nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass ab 1525, gewiss aber seit dem Dreißigjährigen Krieg auch die lutherische Kirche sich zur Obrigkeitskirche und damit das Untertanenchristentum entwickelte. Der »regierbare Untertan« war die Erwartung, nicht die prophetische Kritik an unhaltbaren sozialen und politischen Zuständen.
Mit diesem Band wird eine gute Text- und Forschungsbasis geboten, um an diesen Themen weiter zu arbeiten. Wir wünschen uns, dass das vielfältig geschieht und verbinden dies mit der Hoffnung, dass nun die Zeit der anstehenden eigentlichen Reformationsjubiläen auch dazu genutzt wird, darüber nachzudenken, was diese Fragen für den Weg der Kirche und die verantwortliche Gestaltung unserer Gesellschaft bedeuten können. Landraub, Überschuldung, Klimawandel, Hunger, Despotie sind, global gesehen, heute so aktuell wie damals im Deutschland des 16. Jahrhunderts.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren dieses Bandes und allen, die ihn möglich gemacht haben. Unser herzlicher Dank gilt Sebastian Tischer für die redaktionelle Betreuung des Bandes. Ganz besonders danken wir Frau Raddatz-Breidbach, die den Abdruck der Texte von Strauß ermöglicht und die Übertragung, Kommentierung und Erschließung besorgt hat. Wir hoffen, dass dies nicht nur den Zugang zu den Texten erleichtert, sondern auch die Auseinandersetzung mit der Sache befördert.
Zu danken haben wir den Kooperationspartnern und besonders den Unterstützern, ohne die die Tagung und damit der vorliegende Band nicht möglich gewesen wären: der Bundeszentrale für politische Bildung, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Freistaat Thüringen und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Neudietendorf / Weimar / Jena zu Michaelis 2017
| Prof. Dr. Michael Haspel | Prof. Dr. Joachim Bauer |