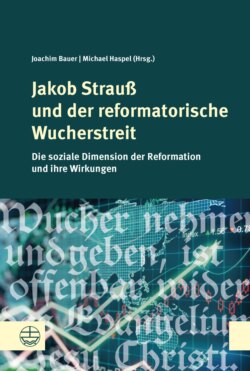Читать книгу Jakob Strauß und der reformatorische Wucherstreit - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SOZIALE FRAGE
IN DER REFORMATIONSZEIT
ОглавлениеSiegrid Westphal
Ist die Rede von der Sozialen Frage, dann verbindet man dies gemeinhin mit den sozialen Missständen, die infolge der europäischen Bevölkerungsexplosion und der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert eintraten. Diese Phänomene lassen sich nicht eins zu eins auf das 16. Jahrhundert übertragen. Dennoch regen sie dazu an, nach dem Verhältnis von gesellschaftlichen Entwicklungen und reformatorischem Geschehen sowie möglichen Wechselwirkungen zu fragen.
Zum einen: Gab es in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts demographische Veränderungen, die soziale Missstände zur Folge hatten? Zum anderen: Führten wirtschaftliche Veränderungen zu sozialen Problemen? Hinter allem steht die Frage, inwiefern soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen das reformatorische Geschehen beeinflusst haben. Damit wird vor allem der Kontext beleuchtet, innerhalb dessen sich der Wucherdiskurs der Reformationszeit abgespielt hat.
Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst die bisherige reformationsgeschichtliche Forschung danach untersucht, welche Antworten sie darauf gegeben hat, dann werden die demographischen Rahmendaten in den Blick genommen und die wirtschaftlichen Entwicklungen skizziert, bevor abschließend überlegt wird, welche Verbindungen es zwischen diesen Phänomenen und dem Wucherdiskurs der Reformationszeit gegeben hat.
1. ZUM STAND DER FORSCHUNG
Die bisherige Forschung wirft erhebliche Schwierigkeiten auf. Noch in jüngster Zeit musste der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann konstatieren, dass sich die Reformationsgeschichtsschreibung und die Lutherforschung lange Zeit nicht für wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte interessiert haben und allenfalls die marxistische Geschichtswissenschaft sowie die Bauernkriegsforschung einen Zusammenhang zwischen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen mit der Reformation hergestellt hat.1 Neben dem Bauernkrieg rückten insbesondere die Städte als Zentren der Reformation in den Blick, wobei überwiegend größere Städte und Reichsstädte mit ihren sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Interesse waren.2 Robert Scribner hat jedoch zu Recht mehrfach darauf hingewiesen, dass die Betrachtung der Reformation als ein Phänomen der Stadtgeschichte das Geschehen unzulässig verkürze, denn in der Reformationszeit lebten nur etwa zehn Prozent der Menschen in Städten.3 Und diese Städte besaßen häufig den Charakter von Ackerbürgerstädten und waren deshalb stark von der Agrargesellschaft geprägt.
Konjunktur besitzt momentan die Auseinandersetzung mit dem Wucher- und Armutsdiskurs der frühen 1520er-Jahre.4 Kontrovers wird dabei die Frage diskutiert, ob die dort formulierten Positionen eher aus theologisch-ethischen Überlegungen oder wirtschaftlich-sozialen Rahmenbedingungen resultierten.
Thomas Kaufmann vertritt dabei die Position, dass am Anfang reformatorischen Ordnungshandelns die Armuts- und Bettelproblematik stand. In vielerlei Hinsicht hätten die theologischen Meinungsführer und literarischen Akteure der frühreformatorischen Bewegung dabei mit Einstellungen, Mentalitäten und Verhaltensformen übereingestimmt, »die in den städtischen Gesellschaften um 1500 tief verwurzelt waren«,5 nämlich dass der Bettel von obrigkeitlicher Seite bekämpft und reguliert werden müsse, dass dabei die einheimischen Armen unterstützt und fremde, vagierende Bettler kriminalisiert werden müssten und dass dabei auf das Kirchengut zurückgegriffen werden könne. Im Zusammenhang mit dem Bettelwesen wird auch auf Luthers Haltung zum Zinsnehmen verwiesen.
Eine andere Position wird von Philipp Robinson Rössner vertreten, der Luther als Wirtschaftsdenker sieht.6 Er habe mit seiner anschaulich-intuitiven Wirtschaftstheorie zur Vorstellung beigetragen, dass Wirtschaft ethischen Standpunkten genügen müsse und die Märkte Regeln brauchten.7
Sowohl Kaufmann als auch Rössner setzen ihre Aussagen in Beziehung zu wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der Reformationszeit. Aus seiner These, dass spätmittelalterliche Stadtgesellschaft und reformatorisches Ethos große Affinität aufwiesen, leitet Kaufmann nun folgende Schlussfolgerung ab: »Soweit ich sehen kann, bieten die sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Befunde zum frühen 16. Jahrhundert keinen Anhaltspunkt dafür, die demographische Entwicklung und die soziale Lage einschließlich der Lebensmittelversorgung für ernster und bedrückender zu halten, als ein oder zwei Jahrzehnte zuvor oder danach«8.
Rössner konstatiert dagegen, dass die Wirtschaft im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts nicht gewachsen sei und Deflation geherrscht habe. Sowohl die pro Kopf umlaufende Geldmenge als auch ihre Umlaufgeschwindigkeit hätten sich vermindert. »Reallöhne und Pro-Kopf-Einkommen stagnierten oder gingen zurück (1500–1600) ebenso wie der Urbanisierungsquotient und damit auch der Beitrag des Agrarsektors zum Sozialprodukt. […] Lediglich die Gesamtbevölkerung wuchs […]«9. Rössners Fazit lautet: Die Ausformulierung von Luthers Denken geschah »unter den Vorzeichen einer wirtschaftlichen Krise und Stagnation«10.
Obwohl beide Historiker auf ein und dieselbe Literatur zurückgreifen, kommen sie zu völlig konträren Aussagen mit Blick auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der frühen Zeit der Reformation. Gab es nun eine Wirtschaftskrise mit daraus resultierenden sozialen Missständen oder nicht? Und wenn ja, um welche Missstände handelte es sich dann?
2. DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG
Nach dem jetzigen Stand der Forschung, die auf mikrogeschichtlichen Untersuchungen beruht und auf dieser Basis Hochrechnungen vornimmt, setzte seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein Bevölkerungswachstum ein.11 Im Zeitraum von 1500 bis 1560 soll die Bevölkerung in den deutschen Territorien mit jährlichen Wachstumsraten von im Schnitt sieben Prozent von rund neun Millionen auf 13,5 Millionen gestiegen sein.12 Für das Ottobeurer Klosterterritorium hat Peter Blickle beispielsweise auf der Basis der Leibeigenschafts- und Untertanenverzeichnisse für den Zeitraum von 1450/80 bis 1548 einen Bevölkerungszuwachs um rund 50 Prozent konstatiert.13 Teile Thüringens waren dagegen weniger extrem vom kräftigen Bevölkerungswachstum betroffen. Die Forschung geht hier von jährlichen Wachstumsraten von 1,4 Prozent aus.14 Dies hatte zunächst für den ländlichen Raum erhebliche Konsequenzen. Infolge der Zunahme der Bevölkerung und aufgrund der spezifischen ländlichen Erbrechte kam es zu einer Verknappung der landwirtschaftlichen Nutzflächen – mit nachhaltigen Folgen für die Sozialstruktur und Agrarverfassung. In den Realteilungsgebieten ließen wiederholte Hofteilungen immer kleinere, unwirtschaftliche Parzellen entstehen. Peter Blickle spricht für eine Reihe von Gebieten von einer Zunahme der Sölden um fast 40 Prozent.15 »Die Vermehrung der Seldner (Kleinbauern) und Kleinhäusler und das Anwachsen der Familiengrößen auf den Bauernhöfen deuten auf eine demographisch begründete Verschlechterung der Land-Mann-Relation«16. Auch in Gebieten mit relativ günstigem Erbrecht, der Erbleihe, wie in Thüringen, kam es zu Verschlechterungen. Mitunter wurde der Kreis der Erbberechtigten auf eine Person beschränkt, so dass deren Familienangehörige sozial herabsanken.
Dadurch wuchs die Zahl von landarmen und -losen Dorfhandwerkern, Tagelöhnern, Gärtnern, Häuslern usw. an. In manchen Regionen, u. a. in Thüringen, sollen unterbäuerliche Schichten bis zu 50 Prozent der Landbevölkerung ausgemacht haben.17 Das Überangebot an Landlosen drückte die Löhne. So stand einem sinkenden Anteil für den Markt produzierender Bauern ein wachsender Anteil von solchen gegenüber, die am Rande des Existenzminimums lebten. Diese Entwicklung ließ seit Ende des 15. Jahrhunderts die sozioökonomischen Spannungen auf dem Lande anwachsen, vor deren Hintergrund erst die Sprengkraft der weiteren Konfliktfelder verständlich wird.
Die Problematik der ländlichen Armut, die aufgrund mangelnder Organisation nicht aufgefangen werden konnte, führte seit dem 15. Jahrhundert »zu einem starken Stadtstreben der Armen, was von der Stadtbevölkerung zunehmend als ›Bedrohung der Gesellschaft‹ wahrgenommen und allgemein als Bettlerplage rezipiert wurde«18. »Die entstehenden Versorgungslücken und Spannungen suchte man« schon in vorreformatorischer Zeit »durch Bettelordnungen obrigkeitlich einzudämmen, welche eine Kontrolle der Bedürftigkeit bzw. Arbeitsfähigkeit und durch das Ausstellen von Bettelberechtigungen eine Reglementierung der Bettelnden einführten«.19 Magistrate griffen damit in einen Bereich der kirchlichen Zuständigkeit ein. Ursachen des Bettelns wurden dabei kaum reflektiert, stattdessen das Betteln nicht nur reglementiert, sondern auch kriminalisiert. Aus der Not heraus entstanden Bettlergemeinschaften mit bestimmten Bettelstrategien, die als kriminell angesehen und verfolgt wurden.
Diese Entwicklungen hatten ihren Ausgangspunkt im Spätmittelalter, wurden jedoch in der frühen Reformationszeit aufgegriffen und durch neue theologisch-ethische Begründungen fundiert. Ein spezifisch reformatorischer Lösungsansatz war der Gemeine Kasten.20 Aus der Kontinuität der Armutsproblematik zwischen Spätmittelalter und Reformationszeit jedoch zu schließen, dass das Bevölkerungswachstum für die Sozial- und Wirtschaftsethik der Reformation keine Rolle gespielt habe, greift zu kurz, da die konkreten Problemlagen immer noch bestanden.
3. VERÄNDERUNGEN DER WIRTSCHAFTSFORMEN UND DEREN SOZIALE FOLGEPROBLEME
Als zweiter Faktor der Sozialen Frage gelten soziale Begleit- und Folgeprobleme, die sich aus Veränderungen der herrschenden Wirtschaftsformen ergeben. Für das frühe 16. Jahrhundert ist hier der Agrarsektor dominierend, da die große Mehrzahl der Menschen auf dem Land (75 bis 80 Prozent) lebte und sich fast ausschließlich von der Bewirtschaftung von Grund und Boden ernährte. Die Produktivität des Bodens war vom Arbeitskräfteeinsatz und damit von demographischen Faktoren sowie den klimatischen Verhältnissen abhängig. Ertragssteigerungen konnten kaum erzielt werden, zu Agrarreformen in größerem Stil kam es erst im 18. Jahrhundert.21 Auch viele Einwohner von Kleinststädten erwirtschafteten sich ihren Lebensunterhalt durch die Bearbeitung von Ackerflächen, die außerhalb der Stadtmauern lagen und unterschiedlichen Grundherren gehörten.
Neben dem Agrarsektor spielte in einigen Regionen des Reichs das Montanwesen eine wichtige Rolle, so auch im thüringisch-sächsischen Raum. Hier war es vor allem der Silber- und Kupferbergbau und -handel, der Teilen der Bevölkerung in abhängiger Lohnarbeit den Lebensunterhalt ermöglichte.22 Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsteilung war in diesem Bereich weit fortgeschritten. Der Anteil der nichtagrarischen Erwerbsbevölkerung war überdurchschnittlich hoch und musste durch Getreidelieferungen aus agrarisch geprägten Regionen versorgt werden.23 Durch starke Überproduktion trat ab Ende des 15. Jahrhunderts eine Krise im Montanwesen ein, die durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch verschärft wurde.24 Neugründungen wie die Saigerhütten im Thüringer Wald konnten die abnehmenden Fördermengen im Silberbergbau (Erzgebirge, Tirol) während der Montankrise nicht völlig ausgleichen. Der erhöhte Finanzbedarf des komplizierten und aufwändigen Saigerhüttenverfahrens überstieg zudem die finanziellen Möglichkeiten der einheimischen Unternehmer, so dass Fremdkapital bei den großen Händlern und Handelsgesellschaften aus Nürnberg und Augsburg aufgenommen werden musste. Es kam zu Monopol- und Kartellbestrebungen einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Kaufleuten, die das Montanwesen zu dominieren versuchten. Die enormen Gewinnspannen, die auf den afrikanischen Märkten und im Indischen Ozean mit dem Verkauf des Silbers gewonnen werden konnten, führten zudem zum Silberabfluss und dadurch bedingt zu einer Silberknappheit in Zentraleuropa. Es stand nicht mehr genug Silber zum Ausmünzen zur Verfügung. Dadurch waren die Landesherren, die über das Münzregal verfügten, dazu gezwungen, regelmäßig »Anpassungen des Feingehalts der Münzen nach unten« (Devaluationen) durchzuführen.25 Münzhortung und damit eine Verminderung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes waren weitere Folgen der Silberknappheit.26 In letzter Konsequenz hatte dies eine Absenkung des Preisniveaus zur Folge, so die neueste Erkenntnis der Forschung, die damit die älteren Thesen von Wilhelm Abel über die Agrarkrisen in Frage stellt.27 Nicht zuletzt deshalb bemühten sich Kaiser und Reich seit Ende des 15. Jahrhunderts um Münzreformen, die häufig von Unruhen und Aufständen begleitet waren.28 Denn jede Münzreform hatte »beträchtliche Abwertungen der umlaufenden Silbernominalen« zur Folge, an welche die Preise, aber nicht die Löhne angepasst wurden.29 Dadurch ergab sich ein Absinken der Kaufkraft.
Der Großteil der Bauern dürfte jedoch vom Marktgeschehen ausgeschlossen gewesen sein, da sie für ihre eigene Subsistenz wirtschafteten.30 Für sie galten die Regeln des Feudalsystems, das auf der Abschöpfung der bäuerlichen Produktion durch die Grundherren beruhte, die überwiegend in Form von dinglichen Abgaben und persönlichen Diensten, in geringem Maße aber auch schon in Form von Geldzahlungen erfolgte. Bei den Grundherren handelte es sich um den Landesherrn bzw. adlige oder kirchliche Obereigentümer des Landes, die den Bauern gegen entsprechende Leistungen das Land zur Bearbeitung überließen. In einigen Regionen des Reiches besaßen die Bauern aber auch erheblichen Eigenbesitz. Hohe Prozentzahlen bis zu 70 Prozent »stammen aus Herrschaftsgebieten, in denen die Leibeigenschaft, näherhin der Einzug liegenden Gutes, eine vergleichsweise geringe Rolle spielte«31.
Für Untersuchungen zur Agrarverfassung ist es also immer entscheidend, welche konkrete Wirtschaftsregion untersucht wird, weil es innerhalb des Reiches doch erhebliche Abweichungen gab.32
Die Lage des einzelnen Bauern wurde entscheidend mitbestimmt durch die dinglichen Abgaben und persönlichen Dienste, die an verschiedene Herrschaftsträger zu leisten waren. Die ländliche Bevölkerung lebte in einer ausdifferenzierten Form der Grundherrschaft, eine Person konnte mehreren Herrschaftsträgern zugleich unterworfen und verpflichtet sein. Die wichtigsten dinglichen Abgaben an die Grund- oder Leib-, Gerichts- und Zehntherren waren der Grund- bzw. Pachtzins, der Zehnt, der an die Kirche entrichtet werden musste, und der Handlohn bei Besitzveränderungen.33
Der jährlich zumeist in Naturalien, vor allem in Form von Getreide zahlbare Grundzins bzw. die Gülten, die an die Grundherren zu entrichten waren, konnten sich, bei großen regionalen Unterschieden, auf bis zu 30 bis 40 Prozent des Bruttoertrags belaufen.34 Obwohl die Getreidegülten häufig festgesetzt waren, sicherten sie die Bauern nicht ab. Vielmehr konnten Missernten zum Ruin der Bauern führen, da die Grundherren auf ihren Abgaben bestanden und die Bauern ihr Saatgut dafür opfern mussten. Für die Zeit zwischen 1350 und 1550 hat die Klimaforschung eine Übergangsphase zur Kleinen Eiszeit ausgemacht, die gekennzeichnet war durch eine »Verkürzung der Vegetationsperiode um ca. 14 Tage, einem verspäteten Einsetzen des Frühjahrs und einer Verfrühung winterlicher Witterungszustände«. Diese klimatischen Rahmenbedingungen führten zu deutlich schlechteren Ernten bzw. Ernteausfällen.35 Wenn Bauern die Abgaben nicht mehr leisten konnten, dann gaben sie das Land auf und liefen davon.36 Auch die Aufnahme von Krediten, um Ernteausfälle zu überbrücken, war gebräuchlich. Wenn diese nicht mehr bedient werden konnten, dann konnte es zu Pfändungen, der Verhängung des Kirchenbanns oder nach einer gewissen Frist gar zum Einzug des Pfands kommen. Auch das gewaltsame Eintreiben fälliger Gelder ist überliefert.37
Hinzu kam der ursprünglich nur von der Kirche verlangte, dann aber häufig in kirchenfremden Besitz gewechselte Zehnt, der in großen und kleinen Zehnt unterschieden wurde und im Prinzip alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse umfasste. Der sogenannte Kleinzehnt (Schmalsaat) traf besonders die dörfliche Unterschicht mit ihren bescheidenen Erträgen.38 Als dritte, vielerorts erst jüngst eingeführte Abgabe kam der bei Besitzveränderungen fällige Handlohn hinzu. Dabei handelte es sich um eine Abgabe, die bei Besitzwechseln von Liegenschaften des Lehnsgutes gezahlt werden musste und 5 bis 10 Prozent des Wertes des Lehnsgutes betrug.
Dazu traten die Forderungen der Landesherren, die ihren wachsenden Geldbedarf bzw. ihre Verschuldung durch neue direkte oder indirekte Steuern zu decken suchten.39 Bei indirekten Steuern war das sogenannte Ungeld auf Wein oder Bier weit verbreitet. Seit Ende des 15. Jahrhunderts wurde es flächendeckend und regelmäßig erhoben, wogegen es zahlreiche bäuerliche Proteste gab. Außerordentliche Steuern waren besonders unbeliebt, weil sie ursprünglich nur zu außergewöhnlichen Anlässen gefordert, dann aber in immer kürzeren Abständen erhoben oder schlicht zu regelmäßigen Steuern erklärt wurden.40
Schließlich bedeutete auch die um sich greifende Beschneidung der bäuerlichen Allmenderechte eine effektive wirtschaftliche Belastung der ländlichen und städtisch-ackerbäuerlichen Bevölkerung. Durch die weitgehende Bannung der Wälder und Gewässer wurden den Bauern traditionelle Nutzungsrechte entzogen, die für ihre Existenz von zentraler Bedeutung waren. Durch die landesherrliche Jagd sowie die Einforderung herrschaftlicher Triftrechte (Schäferei) kam es zu weiteren Restriktionen der bäuerlichen Wirtschaft.41
Die dinglichen Lasten waren immer wieder Gegenstand lokaler Beschwerden der Bauern und gehörten zu den zentralen Ursachen von bäuerlichen Unruhen. Dazu zählen auch die Frondienste, zu denen die Herrschaftsträger ihre Untertanen ebenfalls in immer stärkerem Maße verpflichteten.42 Sie konnten von Ort zu Ort völlig unterschiedlich sein und reichten von landwirtschaftlichen Tätigkeiten aller Art, Transport- und Spanndiensten, der Pflicht zur Beherbergung adliger Jagdgesellschaften bis zu gewerblichen Arbeiten wie Spinnen, Weben oder Brauen.
Die Belastungen, ob dinglich oder persönlich, ergaben sich aus der rechtlichen Minderstellung der Bauern, im extremen Fall durch die Leibeigenschaft.43 Die wesentlichen Merkmale davon waren – neben den oben genannten wirtschaftlichen Verpflichtungen – die Einschränkung der Freizügigkeit, das Verbot der Landflucht und der Verbürgerung sowie drastische Heiratsbeschränkungen (unangemessene Ehe). In Thüringen spielte die Leibeigenschaft in den 1520er Jahren jedoch kaum noch eine Rolle.
Schließlich sind die Bestrebungen der Landesherren zu nennen, im Zuge des Aufbaus frühmoderner Verfassungs-, Gerichts- und Steuerorganisationen (Territorialisierung) die autonomen dörflichen Organe (Gemeindeautonomie) durch landfremde und im römischen Recht ausgebildete Amtsleute, Vögte und Schultheißen zu ersetzen.44 Damit verbunden war die Verschriftlichung des Rechts und Verdrängung des alten Herkommens, das mündlich tradiert wurde. Es herrschte die Angst vor, dass die Festschreibung der Rechte zum Nachteil der bäuerlichen Bevölkerung ausfallen könnte.
Dagegen begehrten insbesondere die wohlhabenderen Bauern auf, die vorher die Dorfämter wahrgenommen hatten. Massiv erfolgte der Zugriff der Landesherren auf die Städte. Den selbstgewählten städtischen Organen wurden landesherrliche Amtsleute vorgesetzt, die städtische Gerichtsbarkeit erheblich eingeschränkt. Diese Eingriffe der Territorialfürsten in die bäuerliche und städtische Autonomie betrafen gerade die Ackerbürgerstädte namentlich des obersächsisch-thüringischen Raums, wie jüngst Uwe Schirmer betont hat.45
Im Bereich der sogenannten Mitteldeutschen Grundherrschaft, welche die Agrarverhältnisse Alt-Sachsens sowie Thüringens umfasst, waren die »Bauern gegenüber ihren Grundherren zins- und frondienstpflichtig«46. Ihrem Pfarrer hatten sie den Zehnten zu reichen. Der regionalen wie sozialen Mobilität der Bauern waren jedoch keine Grenzen gesetzt. Bauern und Gemeinden verfügten über eine Reihe einklagbarer Rechte und konnten ihre Angelegenheiten weitgehend autonom regeln. Sie waren selbstständige Rechtsobjekte. Uwe Schirmer ist es wichtig zu betonen, »dass sich die Erbzinslasten, die Anzahl der Frondienste oder die Abgaben an den Pfarrer während des Spätmittelalters und in der Frühen Neuzeit im obersächsisch-thüringischen Raum faktisch kaum verändert haben«47. Der Sachsenspiegel galt als Grundgesetz und behielt weiterhin Rechtskraft.
Wenn nun die wirtschaftlichen Belastungen offensichtlich nicht angestiegen und auch keine sozialen Beschränkungen vorhanden waren, dann müssen die Ursachen für die unstrittig vorhandenen Probleme und Konflikte auf einer anderen Ebene zu suchen sein.
Sicher können für die Montanregionen der Abfluss des Silbers und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen ein Faktor gewesen sein. Aber für den großen Agrarsektor, der auch im mitteldeutschen Raum dominierend war, dürften die Versuche der Grundherren, einzelne ländliche oder städtische Gewohnheiten »auszuhöhlen oder durch Neuerungen einzuschränken«, ausschlaggebender gewesen sein.48 Uwe Schirmer spricht von herrschaftlichen Entmündigungsversuchen und einer Regelungswut in vielen Bereichen, die die Bewahrung der gottgegebenen Ordnung und die Sorge um den Gemeinen Nutzen zum Ziel hatten, aber in die traditionellen Gewohnheitsrechte eingriffen und deshalb immer wieder die Gegenwehr der Untertanen hervorriefen.49 Das betraf sowohl das Konsumverhalten als auch Praktiken des Wirtschaftens und zielte auf die umfassende soziale Disziplinierung der Untertanen schon in vorreformatorischer Zeit, ein Vorgang, den die Forschung mit Territorialisierung und Policeygesetzgebung umschreibt.
Hinzu kamen Übernutzungserscheinungen der natürlichen Ressourcen, die sich auf die demographische Entwicklung zurückführen lassen. »Landesherrschaft und Stände trafen eine Vielzahl von Entscheidungen, die das Wirtschaftsleben der bäuerlichen und städtischen Gemeinden teilweise beträchtlich einschränkten«50. Das betraf neben der Nutzung des Waldes beispielsweise auch die Nutzung der Gewässer. Hinzu kamen Eingriffe in die Allmenderechte der Gemeinde und Versuche, einen Gesindezwang einzuführen und somit die zu leistenden Dienste auszuweiten.
4. FAZIT
Abschließend stellt sich nun die Frage, welche Rolle der Aspekt des Zinses und der damit verbundenen Wucherproblematik aus bäuerlicher Sicht spielte. Naheliegend ist es dabei, die zentrale Programmschrift des Bauernkriegs, die Zwölf Artikel der oberschwäbischen Bauern, in den Blick zu nehmen, die Ende Februar 1525 entstand und im April 1525 in den Aufstandsgebieten bereits weit verbreitet war. Die Forschung spricht von 25 verschiedenen Drucken, davon vier in Erfurt.51 Die sehr allgemein formulierten Forderungen ermöglichten es, sie durch regionale Beschwerden zu ergänzen oder nicht zutreffende Aspekte, wie in Thüringen die Leibeigenschaft, zu streichen.52 Den Zwölf Artikeln kam deshalb große integrative Wirkung zu.
Dabei fällt auf, dass der Aspekt des Wuchers in den Zwölf Artikeln überhaupt nicht genannt wird. Nur drei Artikel nehmen Bezug auf den Aspekt von Zinszahlungen und den aus der Grundherrschaft resultierenden Diensten. Artikel 6 und 7 beinhalten die Forderung nach der Reduzierung der Frondienste und der Einhaltung der in den Lehnsbriefen festgelegten Bestimmungen. Im Artikel 8 geht es um die Reduzierung und Neufestsetzung der Gülten.53 Zum einen wurden die Gültabgaben offenbar als unangemessen empfunden, zum andern die Erhöhung der Dienste unter Hinweis auf die Lehensverträge als Rechtsverstöße gebrandmarkt.54
Etwas anders gestaltet sich die Situation, betrachtet man eine thüringische Variante der Zwölf Artikel, die Ichtershäuser Artikel, welche die aufständischen Bauern um Georgenthal und Ichtershausen ihrem Landesherrn, Herzog Johann von Sachsen, am 28. April 1525 überreichten. Während der Artikel 4 im Stile der Zwölf Artikel die Abstellung neuer Frondienste fordert, gesteht Artikel 6 Zinszahlungen nur noch dem Landesherrn als legitimem Erbherren zu, »sonst nymandes mehr wider geistlichen nach weltlichen«55. Im Artikel 7 werden schließlich Geldgeschäfte im Zusammenhang mit »widerkeuff, widerzins nach haubtsumma« abgelehnt.56 Damit wird dezidiert Bezug genommen auf den im 16. Jahrhundert weit verbreiteten Renten- oder Wiederkauf, der es kreditwürdigen Personen erlaubte, ein Darlehen gegen eine jährliche Rentenzahlung von 5 bis 6 Prozent aufzunehmen. Diese Rentenzahlung wurde nicht auf das Darlehen angerechnet, auch ein teilweiser Abtrag des Darlehens war nicht vorgesehen. Die Rente (wiederkäuflicher Zins) konnte nur durch die vollständige Rückzahlung des Darlehens abgelöst werden. Bei langen Laufzeiten konnte es zudem vorkommen, dass die Summe der Rentenzahlungen die Darlehenssumme insgesamt überstieg.57 »In Thüringen war dieses Geldgeschäft mit Übervorteilung des Hauptsummengebers augenscheinlich so verbreitet, dass in mehreren dörflichen und städtischen Artikeln dagegen opponiert wurde«58.
Nun hat die Forschung auch für Eisenach und Umgebung festgestellt, dass es seit Ende des 15. Jahrhunderts zu einer zunehmenden Verschuldung von Höfen und Gütern kam.59 Gleichzeitig lässt sich aber keine wesentliche Belastungssteigerung durch höhere Abgaben an die Grundherren feststellen. Bei Erblehengütern war dies schon rein rechtlich nicht möglich. Woher kamen nun die Schulden? »Unerträglich hoch belastet konnten die Güter vor allem dann erscheinen, wenn der Grundherr trotz mehrerer Mißernten […] keine Zinsreduktion gewährte, sondern die Abgaben in voller Höhe eintrieb«, so Peter Blickle.60
Aber auch Finanzierungspraktiken wie der Zinskauf, der aus Sicht der Papstkirche nicht unter das kanonische Zinsverbot fiel und deshalb nicht als Wucher galt, trieben Bauern und Bürger in die Überschuldung, und zwar wenn sie nicht mehr in der Lage waren, die vereinbarten Zinsen bzw. Gülten zu zahlen, beispielsweise aufgrund von Ernteausfällen als Folge der klimatischen Rahmenbedingungen.61 Dass in solchen Fällen dann der völlige Verlust der Güter eintreten konnte, zeigt die ganze Relevanz dieser Problematik. Es ist aus Sicht der Betroffenen somit nicht das eigentliche Finanzgeschäft, sondern die bei Nichtbezahlung der vereinbarten Jahresrenten eintretende Verschuldung und der daraus resultierende mögliche Verlust des eingesetzten Gutes, die unter den Generalverdacht des Wuchers fielen. Die aus anderen Begründungszusammenhängen formulierte reformatorische Kritik am Wucher dürfte vielen Betroffenen als Ausweg aus der Verschuldung erschienen sein, auch wenn sie möglicherweise die theologischen Begründungszusammenhänge nicht verstanden haben.
1 THOMAS KAUFMANN, Wirtschafts- und sozialethische Vorstellungen und Praktiken in der Frühzeit der Reformation, in: DOROTHEA WENDEBOURG/ALEC RYRIE (Hrsg.), Sister Reformations II / Schwesterreformationen II. Reformation and Ethics in Germany and in England/Reformation und Ethik in Deutschland und in England, Tübingen 2014, 325–355, 325.
2 BERND MÖLLER, Reichsstadt und Reformation, Tübingen 2011.
3 ROBERT W. SCRIBNER, Religion und Kultur in Deutschland 1400–1800 (Studies in medieval and reformation thought 81), Göttingen 22006.
4 MICHAEL HASPEL, Der Protestantismus und die Soziale Frage. Die Geburt der Diakonie aus dem Geist der Sozialdisziplinierung, in: RALF KOERRENZ (Hrsg.), Armut und Armenfürsorge. Protestantische Perspektiven, Paderborn 2014, 119–134; HANS-JÜRGEN PRIEN, Luthers Wirtschaftsethik, Neuauflage, Nürnberg 2012; MICHAEL LAPP, »Denn es ist geld ein ungewis, wanckelbar ding.« Die Wirtschaftsethik Martin Luthers anhand seiner Schriften gegen den Wucher, in: Luther 83 (2012), 91–107; ANDREAS PAWLAS, Lutherische Berufs- und Wirtschaftsethik. Eine Einführung, Neukirchen-Vluyn 2000; ANDREAS PAWLAS, Lutherische Wirtschaftsethik in ihrer geschichtlichen und aktuellen Bedeutung, in: UDO KERN (Hrsg.), Wirtschaft und Ethik in theologischer Perspektive (Rostocker Theologische Studien 7), Münster 2002, 111–138; RICARDO RIETH, »Habsucht« bei Martin Luther. Ökonomisches und theologisches Denken, Tradition und soziale Wirklichkeit im Zeitalter der Reformation (Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte), Weimar 1996.
5 KAUFMANN, Wirtschafts- und sozialethische Vorstellungen und Praktiken (s. Anm. 1), 352.
6 PHILIPP ROBINSON RÖSSNER, Deflation – Devaluation – Rebellion. Geld im Zeitalter der Reformation (VSWG, Beihefte 219), Stuttgart 2012.
7 PHILIPP ROBINSON RÖSSNER, Luther – ein tüchtiger Ökonom? Über die monetären Ursprünge der Deutschen Reformation, in: ZHF 42 (2015), 37–74.
8 KAUFMANN, Wirtschafts- und sozialethische Vorstellungen und Praktiken (s. Anm. 1), 351.
9 RÖSSNER, Luther – ein tüchtiger Ökonom? (s. Anm. 7), 39.
10 Ebd.
11 CHRISTIAN PFISTER, Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie 1500– 1800 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 28), München 22007, 11.
12 MICHAEL NORTH, Von der atlantischen Handelsexpansion bis zu den Agrarreformen (1450–1815), in: MICHAEL NORTH (Hrsg.), Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick, München 2000, 107–191, 118.
13 PETER BLICKLE, Die Revolution von 1525, München 42004, 80.
14 PFISTER, Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie (s. Anm. 11), 11.
15 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 80.
16 PETER BLICKLE, Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300–1800, München 32012, 31.
17 RUDOLF ENDRES, Ursachen, in: HORST BUSZELLO / PETER BLICKLE / RUDOLF ENDRES (Hrsg.), Der deutsche Bauernkrieg, Paderborn u.a. 31995, 217–253, 222.
18 JULIA MANDRY, Integration und Ausgrenzung – Versorgung und Ablehnung. Ambivalenzen von Armut und Bettel zwischen Spätmittelalter und Reformation, in: WERNER GREILING / ARMIN KOHNLE /UWE SCHIRMER (Hrsg.), Negative Implikationen der Reformation? Gesellschaftliche Transformationsprozesse 1470–1620 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 4), Köln/Weimar/Wien 2015, 11–27, 17.
19 Ebd.
20 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), ebd.
21 NORTH, Handelsexpansion (s. Anm. 12), 125.
22 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 225f.
23 RÖSSNER, Luther – ein tüchtiger Ökonom? (s. Anm. 7), 42.
24 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 225.
25 RÖSSNER, Deflation – Devaluation – Rebellion (s. Anm. 6), 158.
26 RÖSSNER, Luther – ein tüchtiger Ökonom? (s. Anm. 7), 57.
27 RÖSSNER, Deflation – Devaluation – Rebellion (s. Anm. 6), 152–159.
28 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 240f.
29 A. a.O., 241.
30 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 51.
31 A. a.O., 52.
32 RÖSSNER, Deflation – Devaluation – Rebellion (s. Anm. 6), 133.
33 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 226.
34 A. a.O., 227.
35 RÜDIGER GLASER, Klimageschichte Mitteleuropas. 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 22008, 202.
36 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 228.
37 Ebd.
38 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 229.
39 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 68–71; ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 240.
40 Ebd.
41 A. a.O., 232.
42 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 66–68.
43 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 234 f.; BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 40.
44 ENDRES, Ursachen (s. Anm. 17), 243.
45 UWE SCHIRMER, Die Entmündigung der bäuerlichen Gemeinden als »negative Implikation« der Reformation? Beobachtungen aus dem thüringisch-obersächsischen Raum (ca. 1400–1600), in: WERNER GREILING / ARMIN KOHNLE /UWE SCHIRMER (Hrsg.), Negative Implikationen der Reformation? Gesellschaftliche Transformationsprozesse 1470–1620 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 4), Köln/Weimar/Wien 2015.
46 A. a. O., 166.
47 A. a. O., 167.
48 Ebd.
49 A. a. O., 171.
50 A. a. O., 194.
51 VOLKER GRAUPNER, Reformation und Bauernkrieg in Thüringen (Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen 5), Jena 2016, 32.
52 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 90–104.
53 GRAUPNER, Reformation und Bauernkrieg in Thüringen (s. Anm. 51), 49–53.
54 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 53.
55 GRAUPNER, Reformation und Bauernkrieg in Thüringen (s. Anm. 51), 50.
56 Ebd.
57 A. a. O., 51.
58 Ebd.; vgl. WIELAND HELD, Zwischen Marktplatz und Anger. Stadt-Land-Beziehungen im 16. Jahrhundert in Thüringen, Weimar 1988, 149–151.
59 FRANZISKA LUTHER, Die Klöster und Kirchen Eisenachs (1500–1530). Prologe zur Reformation und wie die Geistlichkeit vermeynen die Zinse aus etzlichenn armenn zu kelterenn, in: JOACHIM EMIG /VOLKER LEPPIN /UWE SCHIRMER (Hrsg.), Vor- und Frühreformation in thüringischen Städten (1470–1525/30) (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 1), Köln 2013, 403–435; HANS-JÖRG GILOMEN, Das Motiv der bäuerlichen Verschuldung in den Bauernunruhen an der Wende zur Neuzeit, in: SUSANNA BURGHARTZ u. a. (Hrsg.), Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus, Sigmaringen 1992, 173–189.
60 BLICKLE, Die Revolution von 1525 (s. Anm. 13), 55f.
61 MARKUS A. DENZLER, Das Problem des Wuchers im bargeldlosen Zahlungsverkehr des späten Mittelalters – Theorie und Wirklichkeit, in: PETRA SCHULTE / PETER HESSE (Hrsg.), Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie – Ethische Norm – Soziale Akzeptanz (VSWG, Beihefte 232), Stuttgart 2015, 95–114.