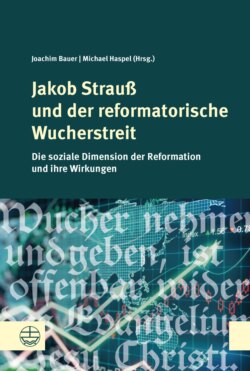Читать книгу Jakob Strauß und der reformatorische Wucherstreit - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
WUCHERSTREIT IM PFAFFENNEST
ОглавлениеAnmerkung zur Vor- und Frühreformation in Eisenach
Thomas T. Müller
Franziska Luther hat vor drei Jahren in ihrem Überblicksaufsatz über die Klöster und Kirchen Eisenachs in den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts treffend festgehalten:
»Ein Desiderat der Forschung in Bezug auf die Stadt Eisenach in vor- und frühreformatorischer, aber auch in mittelalterlicher Zeit bleiben auf den noch vorhandenen Archivalien basierende Einzelstudien zu den verschiedenen geistlichen Einrichtungen. Kritische ganzheitliche Betrachtungen der städtischen Interaktion zwischen Institutionen und Individuen unter modernen Fragestellungen müssen nachgeholt werden.«1
Diese Aussage hat weiterhin Bestand! Und so kann dieser Beitrag auch kaum mehr leisten, als einige weitere Anmerkungen zu jener für Eisenach so spannenden Zeit der Vor- und Frühreformation zu geben. Dies allerdings mit dem Prolog, dass davon unbenommen eines der dringendsten Vorhaben der Stadtgeschichtsforschung eine moderne Reformationsgeschichte für die ehemalige Residenzstadt am Fuße der Wartburg sein sollte.
1. ZUR SAKRALTOPOGRAPHIE EISENACHS AM VORABEND DER REFORMATION
Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die kirchliche Situation in Eisenach eine besondere und somit auch für den Verlauf der Reformation in der Stadt von spezieller Bedeutung gewesen sei. Joachim Rogge hat in diesem Kontext u. a. behauptet, dass jeder zehnte Bewohner der um 1520 etwa 3.000 bis 4.000 Einwohner zählenden Stadt dem geistlichen Stand angehört habe.2 Die Belege für seine Behauptung blieb er allerdings schuldig. Zwar ist heute nachgewiesen, dass vor allem in Bischofsstädten der Anteil der Geistlichen an der Gesamteinwohnerzahl durchaus 10 Prozent betragen konnte (z. B. in Worms oder Augsburg), der normale Durchschnittswert lag in den deutschen Landen um 1500 jedoch bei nur rund 2 Prozent.3
Da für Eisenach meines Wissens keine durchgängig tragfähigen Zahlen überliefert sind, können bei einer seriösen Betrachtung der Situation lediglich grobe Schätzungen vorgenommen werden. Nicht nur hierfür ist es hilfreich, zuvor einen knappen Überblick zur Sakraltopographie der Stadt am Ausgang des Mittelalters zu geben.4
Eisenach war um 1500 in drei Parochien aufgeteilt, unter denen – nach ihrem Wiederaufbau ab 1515 – der Pfarrei »St. Georgen« die bedeutendste Rolle zukam. Allein die Anzahl von 18 im Jahr 1506 verzeichneten Vikarien spricht für diese herausgehobene Bedeutung. Wohl deutlich älter war die Pfarrkirche »St. Nikolai«, an der 1506 immerhin neun Vikarien nachzuweisen sind. Zur Stiftskirche der Augustinerchorherren »B. Mariae Virginis« mit sogar 23 Vikarien gehörte die dritte und kleinste Parochie der Stadt.
Hinzu kam eine für die Größe Eisenachs doch recht erstaunliche und wohl nur durch ihre Funktion als einstige ludowingische Hauptresidenz zu erklärende Anzahl von Klöstern. Hierzu zählten zuvorderst das Katharinenkloster der Benediktinerinnen, welches auch über das Patronat der neben dem Kloster gelegenen Georgenkirche verfügte, sowie das ebenfalls mit Benediktinerinnen besetzte Nikolaikloster, dem das Patronat der gleichnamigen Pfarrkirche zustand. In der Innenstadt kamen noch das Franziskanerkloster »St. Michael« südlich der Georgenkirche, das Dominikanerkloster sowie das Karthäuserkloster hinzu.
Außerhalb der Mauern befanden sich zudem das Zisterzienserkloster Johannistal und der kleine Franziskanerkonvent »St. Elisabeth« am Fuße der Wartburg. Belegt sind 1506 zudem vier Vikarien an der Jakobskapelle im Nordwesten der Stadt. Hinzuzuzählen sind außerdem die Hospitäler »St. Clemens«, »St. Anna« und »St. Spiritus« sowie die wohl erst nach der Reformation zum Hospital umgewidmete Kapelle »St. Justus«.
Mehrfach wird bereits für das ausgehende 15. Jahrhundert über schwerwiegende wirtschaftliche und sittliche Probleme in den Klöstern berichtet. Belastbare Zahlen über deren Insassen liegen für das frühe 16. Jahrhundert jedoch kaum vor.5 Geht man nun in Anbetracht der insgesamt recht desolaten Lage von einer durchschnittlichen Besetzung der sieben Klöster mit etwa 15 Personen um das Jahr 1523 aus, kommt man auf rund 100 Personen, hinzuzuzählen wären die rund 60 Vikare sowie drei Pfarrer, mehrere Prediger und die Mitglieder des Chorherrenstifts.
Alles in allem halte ich eine Anzahl von rund 200 Männern und Frauen im geistlichen Stand, also von ca. 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung für eine realistische Schätzung. Damit hätte der Anteil der Geistlichen im »Pfaffennest« Eisenach um 1523 zwar klar über dem Durchschnitt gelegen, die von Rogge angenommene 10 Prozent-Marke allerdings noch deutlich unterschritten.
Anders verhielt es sich hingegen mit dem prozentualen Anteil des Grundbesitzes in der und um die Stadt. Hier verfügten die diversen kirchlichen Institutionen über den größten Teil der landwirtschaftlichen Flächen, über zahlreiche Gebäude und Zinsen.6 Doch auch hierzu dürfte eine vergleichende wissenschaftliche Untersuchung weitere wichtige Erkenntnisse erbringen.
2. ANMERKUNGEN ZUR FRÜHREFORMATION IN EISENACH
Obgleich Martin Luther bei seiner Predigt, die er am 2. Mai 1521 auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms in der Georgenkirche hielt, starken Zulauf gehabt haben soll, konnte sich die Reformation in Eisenach vorerst nicht durchsetzen.7 Und auch die evangelisch gesinnten Predigten des Franz Lambert (1485/87–1530), der im November 1522 in Eisenach das Johannesevangelium auslegte und den örtlichen Klerus zur Disputation aufforderte, brachten noch keinen endgültigen Durchbruch für die Reformation in der Stadt.8
Den brachte erst das Wirken des um das Jahr 1480 in Basel geborenen Predigers Jakob Strauß. Dieser war bereits in seiner Jugend in den Dominikanerorden eingetreten und hatte nachweislich 1515 und 1516 an der Universität Freiburg im Breisgau studiert.9 Als er 1521 in Hall in Tirol erstmals durch seine evangelischen Predigten auffiel, war er bereits zum Doktor der Theologie promoviert worden. In Hall fand er schnell eine große Zuhörerschaft, zog jedoch schon bald den Unwillen des Bischofs von Brixen auf sich. Während der Haller Rat durch taktische Manöver versuchte, einer Forderung nach der Ausweisung des Predigers zu entgehen, suchte Strauß in seinen Predigten weiter die bewusste Konfrontation mit der alten Kirche.10
Der Bischof von Brixen setzte sich schließlich durch und auf Drängen des inzwischen ebenfalls mit der Angelegenheit befassten vorderösterreichischen Regiments in Innsbruck wurde Strauß am 9. Mai 1522 vom Haller Rat mit einem Ehrengeschenk aus der Stadt verabschiedet.11 Sein Weg führte ihn nach Wittenberg, wo er sich wenig später an der Universität einschrieb.12 Doch schon im September 1522 erhielt er auf Vermittlung Martin Luthers (1483–1546) eine Stelle als evangelischer Prediger bei Graf Georg von Wertheim (um 1487–1530).13
Während sein neuer Dienstherr eine vorsichtige und schrittweise Einführung der Reformation in seiner tauberfränkischen Herrschaft plante und deshalb Strauß wohl auch entsprechende Anweisungen erteilt hatte, forderte jener die sofortige radikale Abschaffung aller der Reformation entgegenstehenden kirchlichen Einrichtungen. Der Bruch zwischen beiden kam schnell und endgültig. Bereits am 29. Oktober 1522 schrieb Georg von Wertheim seiner Frau, er wolle sich nach einem neuen Prediger umsehen, der »mer ain lerer, dan ein gebieter sey.«14
Dass Luther vom radikalen Eigensinn des von ihm Empfohlenen nicht sonderlich begeistert war,15 wundert wenig und dürfte das Verhältnis der beiden bereits zu diesem Zeitpunkt nachhaltig beeinflusst haben. Dabei war sich Strauß seines Rufes durchaus bewusst. Im Vorwort einer an Kurprinz Johann Friedrich von Sachsen (1503–1554) gerichteten Schrift beklagte er beispielweise nur wenige Monate später, dass er lediglich geringes Ansehen genieße, da er nicht heucheln oder liebkosen könne.16
Spätestens Ende November 1522 war Strauß wieder in Kursachsen, wo er an der Weimarer Disputation Wolfgang Steins mit den dortigen Franziskanern teilnahm.17 Durch die von Strauß besorgte Drucklegung der im Nachgang angefertigten schriftlichen Ausführungen der Disputanten wurde er weiteren Kreisen bekannt. Das Vorwort verfasste Strauß selbst. Es weist ihn als scharfzüngigen Vertreter der Reformation aus. Beendet hatte er es am 20. Januar 1523 bereits in Eisenach.18 Dort war er kurz zuvor – wohl auf Vermittlung Steins bei Herzog Johann – als Prediger an der Georgenkirche angestellt worden.
Fortan entwickelte er nicht nur eine umfangreiche Predigttätigkeit, er publizierte auch nahezu im Monatstakt. Am 9. Februar 1523 schloss er sein bald darauf in Erfurt erschienenes Beichtbüchlein ab19 und am 26. März 1523 beendete er seinen »Kurtz Christenlich vnterricht«, mit dem er gegen den auch in Eisenach üblichen Reliquienkult vorging. Durch jene »Abgötterei« würde bei den Bischöfen, Kaisern, Königen, Fürsten und dem einfachen Volk der gründliche christliche Verstand des lebendigen Gotteswortes ausgelöscht, polterte er.20
Noch vor dem Osterfest hatte er die individuelle Ohrenbeichte abgeschafft und durch eine allgemeine Formel ersetzt, die der Priester der Gemeinde vortrug und die diese dann wiederholte.21 Bereits in den ersten Monaten seiner Tätigkeit führte er zudem in Eisenach die Priesterehe ein und heiratete auch selbst.22
In dieser Angelegenheit, so erklärte er in einem noch im selben Jahr in den Druck gegebenen »Sermon« kämpferisch, helfe kein päpstliches Gesetz, kein Eid oder ein menschliches Gelübde. Natur bleibe Natur und an Gottes Wunderwerk dürfe nichts verändert werden. Aus diesem Grunde sei auch das grausame, tyrannische Gebot der priesterlichen Ehelosigkeit gegen »gotes werk und wort, auch der natur entgegen«.23 Zudem werde deutlich, welchen unschätzbaren Schaden dasselbe der Christenheit bereite. Denn dieses Eheverbot für Priester und Mönche habe nur zu Ehebrecherei, Unlauterkeit und der Verführung von Jungfrauen beigetragen.
Allerdings scheint es bei einigen der nun bald einsetzenden Hochzeitsfeiern Eisenacher Ex-Mönche zu Ausschweifungen gekommen zu sein. Denn Strauß hatte Anlass, darüber zu polemisieren, dass er nicht davon ausgehe, dass Schlämmen, Prassen, Föllen, Tanzen und Springen und anderes Teufelswerk als Belege für eine gute Ehe oder einen rechten christlichen Verstand herangezogen werden könnten. Stattdessen hätten nun die »feind[e] des Evangliums«, also die Altgläubigen, die willkommene Gelegenheit zu behaupten, von den »unsinnigen, abtrünnigen Christen« in Eisenach werde nur gelehrt, wie man ohne jegliche christliche Zucht und Ordnung allein nach der Fleischeslust lebe.
Aus diesem Grund ermahnte Strauß in seiner Predigt am Sonntag vor Christi Himmelfahrt (10. Mai) 1523 alle evangelischen Eisenacher, den Altgläubigen fortan keinen Anlass mehr zur Häme zu bieten, sondern lieber ein Beispiel für eine gute christliche Ehe abzugeben.24
Nachdem Strauß bereits um Ostern herum das Taufsakrament grundlegend und viel weitergehender als Luther umgestaltet hatte,25 begann sich zunehmend auch öffentlicher Widerstand gegen den dogmatischen Prediger zu regen. Ein konkreter Anlass dafür war seine Weigerung, beim Taufritus, wie bisher üblich, Chrisamöl zu verwenden.
Dies veranlasste einen Vater, sein Kind nicht in der eigentlich zuständigen Georgengemeinde, in welcher ja Strauß tätig war, taufen zu lassen, sondern in einer anderen Eisenacher Kirche, in der noch altgläubige Priester die Messe lasen. Jene gestalteten die Feier nun besonders prächtig, was wiederum Strauß veranlasste, sich der Angelegenheit in einer scharfen Predigt erneut anzunehmen. Dabei kritisierte er unter anderem die bislang übliche Praxis, Taufgeld zu verlangen. In seiner Kirche hingegen werde man »nyt umb gelt / aber wie Christus gebotten hat / gratis / umbsunst« getauft!26
Deutlich folgenschwerer war ein Vorfall, der sich am Dienstag, dem 14. Juli 1523, abends gegen sechs Uhr, zutrug. Während Strauß in der Georgenkirche zu den versammelten Gläubigen predigte, ließ ein altgläubiger Ratsherr auf dem der Kirche direkt benachbarten Rathaus fröhliche Musik aufspielen. Während die Schalmeien und Posaunen erklangen, forderte er die Umstehenden zum Tanz auf.
Nachdem bereits einige der Musiker den Dienst verweigert hatten, um die Predigt nicht weiter zu stören, verbot schließlich einer der Eisenacher Bürgermeister die Provokation. Wütend verließ der Ratsherr daraufhin das Rathaus und stürmte in die Kirche. Dort schrie er die versammelte Gemeinde an, sie solle Strauß keinen Glauben schenken, denn jener versuche nur, sie mit seiner ketzerischen Lehre zu verführen.
Strauß verwies ihn nicht nur der Kirche, sondern er verbot seinen Anhängern fortan auch außerhalb der Gemeinde jeglichen Umgang mit ihm. Wer sich diesem Urteil aus seiner Gemeinde widersetzen sollte, den träfe dieselbe Strafe, verkündete er. Zudem forderte er die Bürgerschaft auf, darüber nachzudenken, welchen Spott und welche Schande jener Mann dem Rat und der gesamten Gemeinde zu Eisenach eingebracht habe.27 Damit hatte Jakob Strauß an diesem 14. Juli 1523 in durchaus selbstherrlicher Weise und ohne jede Rücksprache mit weltlichen oder kirchlichen Instanzen den ersten Bann ausgesprochen, der jemals in einer evangelischen Kirchengemeinschaft verhängt worden ist.28
Dass jene Vehemenz, mit der Strauß all sein reformatorisches Tun vorantrieb, weder bei den Wittenberger Reformatoren um Martin Luther noch am herzoglichen Hof in Weimar auf Wohlwollen stieß, verwundert kaum. Doch die eigentliche Herausforderung war erst die konsequente Haltung des Predigers in der Wucherfrage. Obwohl bereits seit dem 12. Jahrhundert nach kanonischem Recht ein Zinsverbot für geistliche Institutionen bestand, war dasselbe im täglichen Geschäft durch allerlei spitzfindige Tricks de facto längst außer Kraft gesetzt.29 Das hieraus folgende sozial-theologische Problem der kirchlich geduldeten Ausbeutung von Christen durch Christen hatte auch Martin Luther erkannt. Bereits drei Jahre vor Strauß hatte er sich damit in seinem »[Großen] Sermon von dem Wucher« auseinandergesetzt.30
Strauß ging – immer auch die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit im Blick – in seinen 51 Thesen wider den unchristlichen Wucher jedoch deutlich weiter als Luther, wenn er kategorisch fordert: Niemand solle »um keines Gebots und keiner Gewalt willen den Wucher bezahlen« (These 29), sondern »ihr sollt einander leihen und nichts dagegen verhoffen« (These 51).31
Und doch war Strauß Realist. Er wisse wohl, schrieb er 1524 in einer weiteren Schrift gegen den Wucher, dass seine christliche Lehre den dummen, verblendeten Gemütern der »geltsuchtygen wuchersecke« seltsam und unmöglich erscheinen und ihnen Anlass für Gespött und Verachtung geben werde, auch dass sich wohl kaum einer danach richten werde, von einigen wahrhaften Gotteskindern abgesehen, denen mehr am Wort Gottes gelegen sei, als an allen Schätzen und Reichtümern dieser Welt. Dennoch sei es sein Auftrag, den Weg zur richtigen Auslegung der Heiligen Schrift zu lehren. »Es ergere sych darab, wer do wyll«!32
Mit dieser konsequenten Haltung sorgte er erneut für überörtliche Aufmerksamkeit. Selbst in der Schweiz wurde seine Wucherschrift mit Interesse gelesen. Konrad Grebel (um 1498–1526) und der Kreis der Züricher Prototäufer schrieben am 5. September 1524 an Thomas Müntzer, sie hielten viel Gutes von Jakob Strauß und etlichen anderen Predigern, welche von den nachlässigen Wittenberger Schriftgelehrten und Doktoren wenig geachtet würden.33
Grebel, der bereits am 15. Juli 1523 in den Besitz der 51 Artikel des Eisenacher Predigers gegen den Wucher34 gelangt war,35 zeigte sich anscheinend begeistert von dessen klaren Forderungen. In einem weiteren Brief bezeichneten die Züricher die Lehren von Strauß, Karlstadt und Müntzer als weit reiner als die der Wittenberger Reformatoren, welche jeden Tag aufs Neue aus einer Schriftverkehrung in die andere und von einer Blindheit in eine noch größere fielen. Es käme ihnen bald so vor, schrieben die Züricher, als wären die Wittenberger Papisten und wollten selbst Papst werden.36
Da die an Müntzer gerichteten Briefe ihren Empfänger nie erreichten, hat Strauß von seiner Wertschätzung durch die Züricher Prototäufer wohl ebenso wenig erfahren, wie es ihm wohl recht gewesen wäre, auf eine Stufe mit Thomas Müntzer gestellt zu werden. Beide hatten sich vermutlich erstmals 1522 in Weimar persönlich getroffen. Die Kontaktaufnahme, die am Rande der Disputation mit den Franziskanern37 erfolgte, ging von Müntzer aus, wie dieser später selbst aussagte.38
Im August 1524 traf sich Strauß mit Herzog Johann von Sachsen in Weimar, um mit ihm ausführlich über Müntzer, »seiner anhenger leer und der neuen geister halbenn, wie er sie genant«, zu reden. Strauß schlug dem Fürsten vor, Luther, Karlstadt, Melanchthon, ihn selbst und Müntzer zu einer Disputation einzuladen. Obwohl Herzog Johann tatsächlich geneigt war, dem Vorschlag zu folgen39 und sich auch Kurfürst Friedrich von Sachsen für eine solche Zusammenkunft aussprach40, kam diese – möglicherweise aufgrund der Septemberunruhen in Mühlhausen –41 jedoch nicht mehr zustande.
Es spricht allerdings nicht viel dafür, dass Jakob Strauß die Auffassungen Müntzers teilte. Wenngleich er sich selbst nicht dazu geäußert hat, ist ein überaus deutlicher Brief seines damaligen Mitarbeiters Georg Witzel (1501–1573)42 vom 11. März 1525 überliefert, in welchem dieser Müntzer dringend auffordert, seine Lehre von der göttlichen Offenbarung durch Visionen und Träume sowie seine den Aufruhr befördernde Schriftauslegung zu widerrufen. Stattdessen solle er sich vom Arzt Christus von dem satanischen Einfluss befreien lassen, der anscheinend über ihn gekommen sei.43
3. VISITATION, BAUERNKRIEG UND DEMISSION
Spätestens gegen Ende des Jahres 1524 begann Strauß seine reformatorische Tätigkeit auch auf das Eisenacher Umland auszudehnen. In Waltershausen führte er auf Luthers Empfehlung Dr. Johannes Draconites (um 1494–1566)44 als evangelischen Prediger ein. In Wenigenlupnitz installierte er den aus Vacha aufgrund seines evangelischen Bekenntnisses vertriebenen Georg Witzel. Die aus denselben Gründen aus Hersfeld vertriebenen Geistlichen Heinrich Fuchs und den (späteren Täufer) Melchior Rinck (um 1493–nach 1553) setzte er als Pfarrer in Marksuhl bzw. in Eckartshausen bei Eisenach ein.45
Um Struktur und Ordnung in seinem Kirchenwesen bemüht, erteilte Herzog Johann um die Jahreswende 1524/1525 an Jakob Strauß auch den offiziellen Auftrag, die Stadt Eisenach und die umliegenden Ämter zu visitieren. Ihm zur Seite stellte er seinen erfahrenen Rat Burghard Hundt von Wenkheim (gest. 1545). Gemeinsam nahmen beide vom 11. bis 15. Januar 1525 in der Stadt und dem Amt Eisenach die erste Visitation der Reformationsgeschichte vor. Am 17. März verfügte Herzog Johann die Fortsetzung der Visitation in den Ämtern Wartburg, Hausbreitenbach, Salzungen, Creuzburg und Gerstungen. Dabei wurden Strauß umfangreiche Vollmachten erteilt. Zudem erhielt der lokale herzogliche Verwaltungsapparat die Anweisung, ihn vollumfänglich zu unterstützen.46
Bei seinen Reisen beschränkte sich Strauß jedoch keineswegs auf die Visitation der Kirchenvertreter, er tadelte, so er dies für notwendig erachtete, Bürger ebenso wie einfache Bauern. Selbst Adlige und Amtleute kritisierte er für ihr Verhalten. Selbst jene, die ihn bislang auch gegen Widerstände unterstützt hatten, wie der Eisenacher Schultheiß Oswald, wurden nicht geschont. Dabei scheint allerdings jene Selbstherrlichkeit, die bereits Georg von Wertheim angeprangert hatte, erneut und überdeutlich zum Vorschein gekommen zu sein.47
Aus einem Brief an Georg Spalatin vom 10. April 1525 tritt klar hervor, dass Luther in Strauß inzwischen eine Gefahr für die Reformation in seinem Sinne sah. Spätestens zu diesem Zeitpunkt scheint er nicht zuletzt durch sein eigenständiges Agieren und die offenkundig fehlende Bereitschaft, sich dem Willen des Wittenbergers voll und ganz unterzuordnen, dessen anfängliches Wohlwollen vollständig verloren zu haben. Vielmehr noch: Luther wünschte sich die Absetzung des Predigers.48
Auch wenn es hierzu nicht kam, demissionierte Strauß einige Monate später in Folge des Bauernkrieges und ging nach Süddeutschland. Zuvor hatte er das Bedrohungsszenario durch die vor der Stadt lagernden Aufständischen jedoch noch geschickt zu nutzen gewusst, um die endgültige Vertreibung der letzten noch in den Eisenacher Klöstern verbliebenen Nonnen und Mönche durchzusetzen. Spätestens nach diesem anscheinend auch mit ikonoklastischen Ausschreitungen verbundenen antiklerikalen Akt war die Reformation in Eisenach nicht mehr rückgängig zu machen.
Allerdings setzte sich bereits in direkter Folge des Bauernkriegs in der Stadt unterhalb der Wartburg der Wittenberger Weg der Reformation durch und der Einfluss von Jakob Strauß auf die Eisenacher schwand zunehmend. Dies dürfte ein Hauptgrund für die Demissionierung des eigentlichen Reformators der Stadt gewesen sein.
Man habe schändlich »wider got vnd alle warhait« versucht, ihm die Schuld am Aufruhr aufzuladen und ihn nach seiner Flucht vor ihrem »unvermeydlichen haß« schriftlich und mündlich verleumdet. Selbst der Tod sei ihm angedroht worden, beklagte sich Strauß im Vorwort einer 1526 in Augsburg und Worms gedruckten Schrift.49
Eine neue Anstellung fand er – anscheinend erst nach längerer Suche – schließlich 1526 in Baden, wo er unter dem dortigen Markgrafen als Prediger arbeitete und im Juni eine Flugschrift gegen Ulrich Zwingli verfasste.50 Sie ist das letzte bislang bekannte Lebenszeichen des ersten Reformators der Stadt Eisenach.
Es wird davon ausgegangen, dass er bereits verstorben war, als sein ehemaliger enger Vertrauter Georg Witzel im Jahr 1533 in einem an Justus Jonas (1493–1555)51 gerichteten Pamphlet über Strauß schrieb:
»War es nicht genug, dass jener Mann, so lange er lebte, von euch gequält wurde, aus keinem anderen Grund, als weil er euch die Füße nicht küssen wollte? Bevor er vom Wucher schrieb und bevor er sowohl eure Sitten als die des evangelischen Volkes tadelte, hieltet ihr ihn für einen der vortrefflichsten Evangelischen, nachher aber wurde er verachtet wie kein Anderer!«52
1 FRANZISKA LUTHER, Die Klöster und Kirchen Eisenachs (1500–1530). Prologe zur Reformation und wie die Geistlichkeit »vermeynen die Zinse aus etzlichenn armenn zu kelterenn«, in: JOACHIM EMIG/VOLKER LEPPIN/UWE SCHIRMER (Hrsg.), Vor- und Frühreformation in thüringischen Städten (1470–1525/30). (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 1) Köln u. a. 2013, 403–435, hier 407–408.
2 JOACHIM ROGGE, Der Beitrag des Predigers Jakob Strauss zur frühen Reformationsgeschichte, (Theologische Arbeiten 4) Berlin 1957, 37.
3 RAINER POSTEL, Ouvertüre zur Reformation? Die spätmittelalterliche Kirche zwischen Beharrung, Reform und Laienfrömmigkeit, in: JÖRG DEVENTER/SUSANNE RAU/ANNE CONRAD u. a. (Hrsg.), Zeitenwenden. Herrschaft, Selbstbehauptung und Integration zwischen Reformation und Liberalismus, Festgabe für Arno Herzig zum 65. Geburtstag, Berlin 22006, 213.
4 Der nachfolgende kursorische Überblick folgt, sofern nicht anders angegeben, der zusammenfassenden Darstellung bei LUTHER, Klöster (s. Anm. 1), 410–420. Vgl. zudem ENNO BÜNZ (Bearb.), Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen von 1506, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen; Große Reihe 8) Köln/Weimar/Wien 2005.
5 Weder für das Kloster Johannisthal (GERD BERGMANN, Eisenach, St. Johannisthal, in: Germ Ben. IV–1, 573–579) noch für die beiden Franziskanerklöster (PETRA WEIGEL, Eisenach, St. Michael, in: MÜLLER/SCHMIES/LOEFKE (Hrsg.) unter Mitw. v. Jürgen Werinhard Einhorn OFM: Für Gott und die Welt – Franziskaner in Thüringen. Text- und Katalogband zur Ausstellung in den Mühlhäuser Museen vom 29. März – 31. Oktober 2008, Paderborn 2008, und UDO HOPF / INES SPAZIER / PETRA WEIGEL, Zelle der St. Elisabeth unterhalb der Wartburg, in: a. a. O., 226–227) sind in der einschlägigen Literatur genaue Zahlen genannt.
6 Ausführlich hierzu GERD BERGMANN, Eisenach in der frühbürgerlichen Revolution, (Eisenacher Schriften zur Heimatkunde 41) Eisenach 1989, 6–18.
7 BERGMANN, Revolution (s. Anm. 6), 18–19.
8 LUTHER, Klöster (s. Anm. 1), 422.
9 Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460–1656, Bd. 1, Einleitung und Text, bearbeitet und herausgegeben von HERMANN MAYER, Freiburg i. Br. 1907, 219 (Nr. 38).
10 FRANZ WALDNER, Dr. Jakob Strauß in Hall und seine Predigt vom Grünen Donnerstag 1522, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol 3 (1882), 3–39.
11 HERMANN BARGE, Jakob Strauß. Ein Kämpfer für das Evangelium in Tirol, Thüringen und Süddeutschland, (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 162) Leipzig 1937, 1–22.
12 KARL EDUARD FÖRSTEMANN (Hrsg.), Album Academiae Vitebergensis, Ältere Reihe, Bd. 1, 1502–1560, Leipzig 1841, 111.
13 WA Br 2, Nr. 535 (597) sowie WA Br 3, 88.
14 HEINRICH NEU, Geschichte der evangelischen Kirche in der Grafschaft Wertheim, Heidelberg 1903, 112.
15 WA Br 3, 88.
16 An den durchleuchtigistenn || hochgeborn F[ue]rst vñ herrn herrn Johanßen || Friderichen hertzogen zu Sachssen … || Das nit herren aber diener eyner yedenn Christ=||lichen versamlung zugestelt werdenn / beschluß=||reden vnd haupt artikel / wen gel[ue]stet/ mag sich || dar gegen h[oe]ren lassen / wirt im sunder zweyfel || auff Euangelischer leer Christlich vñ br[ue]derlich || gut bescheyd vnnd bewerung widerfaren.|| … D. Jacobus Straus || Ecclesiastes.||Erfurt 1523 (VD16 S 9472), Bl. A2 r.
17 HELMAR JUNGHANS u. a. (Hrsg.), Thomas-Müntzer-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 3, Quellen zu Thomas Müntzer, bearb. v. Wieland Held und Siegfried Hoyer, (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 25,3) Leipzig 2004, Nr. 68, 113 u. Nr. 175, 267.
18 Ob / dz aller hochwirdigeste Sacra=||ment / des leibs vnnd blutes / vnsers || heilmachers Christi / anders benenhet || moge werden dan eyn getrew Testa||ment … || Eine || newe Disputacion / geschrifft||lich gehalten Zwiessch||en den Barfuessern || Zw Weimmar /|| vñ Magister || Wolffgang Steyn / deß || … hertzogenn Hanszenn || Zw Sachsszenn. [et]c.Prediger. Erfurt 1523 (VD16 O 33).
19 Eyn new wunderbarlich Beycht=||p[ue]chlin in dem die warhafft gerecht beicht vnd pueß=||fertigkeit/ christenlichen gelert vnd angezeygt wirt /|| vnd k[ue]rtzlichen all tyranney ertichter men=||schlicher beycht auff gehaben / zcu seli=||ger rewe / frid vnd freid der ar=||men gefangen gewissen.|| D: Jacobus Strauss Ecclesiastes || zcw Eysennach in || D[ue]ringen.|| Erfurt 1523 (VD16 S 9492). Weitere Ausgaben erschienen noch 1523 in Straßburg (VD16 S 9496) und Nürnberg (VD16 S 9495). In Augsburg wurde die Schrift sowohl 1523 (VD16 S 9491) als auch 1524 (VD16 S 9497) gedruckt.
20 Ein kurtz Christenlich vnterricht des || grossen jrrthumbs / so im heiligthüm zů eren gehalten / das dan || nach gemainem gebrauch der abg[oe]tterey gantz gleich ist.|| D. Jacobus Strauß zu Eysenach || in Doringen Ecclesiastes. [Erfurt 1523] (VD16 S 9488), Bl. B1 r. (sic!).
21 FELICIAN GESS (Hrsg.), Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen. Bd. 1 (1517–1524), Leipzig 1905, 559, 565.
22 Am 18. Oktober 1523 ließ Luther Grüße an dessen Frau übermitteln (WA Br 3, 179) und im April 1524 war Strauß bereits Vater eines ehelichen Kindes (WA Br 3, 278).
23 »Es hilfft auch hie kain Babstes gesetz, ayd, oder menschlich gelübd. Natur bleyb natur und mag on gottes wunderwerck nit verkert werden. Derhalben auch das grawsam tyrannisch gebot den pristern auffgeladen, nit Eelich zu sein, wider gotes werk und wort, auch der natur entgegen, zu unerschetzlichem schaden der Christenhait reychent, offenbarlich erscheint.« Ain Sermon Jn || der deütlich angezeygt / vnd geleert ist || die pfaffen Ee / in Euangelischer leer || nit zů der freyhayt des flayschs … || gefun=||diert/ aber das Gotes werck vñ wort || allein angesehen … || werd.|| … D. Jac. Strauß zů Eyssenach eccle.|| Augsburg 1523 (VD16 S 9499), Bl. A1 v.
24 Ebd.
25 Uon dem ynner=||lichen vnnd ausserlichem Tauff || eyn Christlych begr[ue]ndt ||leer / geprediget durch || D.Ja.Straus || zu Eyssnnach || Ecclesiasten || … || Erfurt 1523 (VD16 S 9511).
26 Widder den Si=||monieschen Tauff || vnnd erkaufften ertichten || Chrissum vnd [oe]l / auch || worynn die recht || Cristlich tauf ||<allein võ Chri=||sto aufgesetzt || begriffen sei || ein genotti=||ge ser=||mon / geprediget zu Eissnach.|| … D. Jacobus Straus.|| Ecclesiastes. Erfurt 1523 (VD16 S 9513), Bl. A1 r.
27 Ein ernstliche handlũg wider || eyn freuenlichen widersprecher des lebendi=||gen wort Gottes beschehenn Jn sant || Jorgen kirchen zu Eyssennach.|| … || D.Jacobus Strausz.|| Ecclesiastes. [Erfurt 1523] (VD16 S 9480).
28 BARGE, Strauß (s. Anm. 11), 58.
29 HANS-JÖRG GILOMEN, Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, München 2014; DERS., Wucher und Wirtschaft im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 250 (1990), 265–301; DERS., Artikel Wucher, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 9, München 1998, Sp. 341–345; DERS., Artikel Rente, -nkauf, -nmarkt, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7, München-Zürich 1995, Sp. 735–738.
30 WA 6, 33–60.
31 »vmb kain gebot noch gewalt den wucher bezalen.« (These 29); »Ir sölt aynander leyhen vnd nichts dargegen verhoffen« (These 51). Haubtstuck || vñ artickel Christenlicher leer || wider den vnchristlichen || wuecher / darũb etlich pfaff zů Eysnach || so gar vnruewig || vnd bemueet || seind.|| Gepredigt zů Eysenach durch || D. Jakob Straussen.|| (VD16 S 9481), (Augsburg) 1523, Bl 19 r.-19 v.
32 Das wucher zu nemen vnd geb.|| vnserm Christlichem glauben. vnd || br[ue]derlicher lieb … || entgegen yst / vnuberwintlich leer / vnnd ge=||schrifft. Jn dem auch die gemolet Euange=||listen erkennet werden.|| … D. Ja. Strausz Ecclesiastes || zu Jsennach. Erfurt 1524 (VD16 S 9478), Bl. D 1v.-D 2r.
33 »Wir versehend vnß fil gutz zu Jakobo Struß vnd anderen etlichen, die wenig geacht werdend by den hinlessigen gschriftgelerten vnd doctoren zu Wittemberg.« in: HELMAR JUNGHANS / ARMIN KOHNLE (Hrsg.), Thomas-Müntzer-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 2, Briefwechsel, bearb. v. Siegfried Bräuer und Manfred Kobuch. (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 25,2) Leipzig 2010, Nr. 103,1 (355).
34 Haubtstuck || vñ artickel Christenlicher leer || wider den vnchristlichen || wuecher / darũb etlich pfaff zů Eysnach || so gar vnruewig || vnd bemueet || seind.|| Gepredigt zů Eysenach durch || D. Jakob Straussen.|| (VD16 S 9481), (Augsburg) 1523.
35 ANDREA STRÜBIND, Eifriger als Zwingli. Die frühe Täuferbewegung in der Schweiz, Berlin 2003, 232–234.
36 ThMA 2 (s. Anm. 33), Nr. 103,2 (365).
37 Vgl. s. Anm. 18.
38 ThMA 3 (s. Anm. 17), Nr. 175 (267).
39 ThMA 3 (s. Anm. 17), Nr. 112 (173–174).
40 ThMA 3 (s. Anm. 17), Nr. 116 (180–181).
41 Hierzu GÜNTER VOGLER, Ein Aufstand in Mühlhausen im September 1524. Versuch einer Revision und Rekonstruktion, in: GÜNTER VOGLER, Thomas Müntzer und die Gesellschaft seiner Zeit (Veröffentlichungen der Thomas-Müntzer-Gesellschaft 4), Mühlhausen 2003, 89–104.
42 Von Strauß als evangelischer Prediger in Wenigenlupnitz eingesetzt, hatte Witzel Eisenachs Frühreformation nicht nur miterlebt, sondern war selbst daran beteiligt. Anfang der 1530er Jahre sagte er sich jedoch von der evangelischen Lehre wieder los und wirkte ab Sommer 1533 als katholischer Pfarrer an der Andreaskirche in Eisleben. Zu Witzel vgl. BARBARA HENZE, Aus Liebe zur Kirche – Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501–1573) um die Kircheneinheit (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 133), Münster 1995; GÜNTER VOGLER, »Quamquam satis admonitus es«. Georg Witzels Verhältnis zu Thomas Müntzer, in: HARTMUT KÜHNE / HANS-JÜRGEN GOERTZ / THOMAS T. MÜLLER / GÜNTER VOGLER (Hrsg.), Thomas Müntzer – Zeitgenossen – Nachwelt. Siegfried Bräuer zum 80. Geburtstag (Veröffentlichungen der Thomas-Müntzer-Gesellschaft 14), Mühlhausen 2010, 209–226.
43 ThMA 2 (s. Anm. 33), Nr. 110 (391–397), vgl. hierzu auch ThMA 2 (s. Anm. 33), Nr. 136 (449–450).
44 Zu ihm vgl. zuletzt: EIKE WOLGAST, Die Unterdrückung der reformatorischen Bewegung in der Kurmainzischen Amtsstadt Miltenberg 1523, in: IRENE DINGEL (Hrsg.), Zwischen Konflikt und Kooperation. Religiöse Gemeinschaften in Stadt und Erzstift Mainz in Spätmittelalter und Neuzeit (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Abt. für abendländische Religionsgeschichte, Beih. 70), Mainz 2006, 123–140; HEINZ SCHEIBLE, Johannes Draconites, Ein Gelehrter der Reformationszeit als Pfarrer von Miltenberg und sein unsteter Lebensweg, in: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 71 (2002), 29–47.
45 BARGE, Strauß (s. Anm. 11), 93–94. Zum Verhältnis von Strauß zu den Täufern vgl. JOHN S.OYER, The Influence of Jacob Strauss on the Anabaptists. A Problem in Historical Methodology, in: MARC LIENHARD (Hrsg.), The Origins and Characteristics of Anabaptism, Den Haag 1977, 62–82; HANS-JÜRGEN GOERTZ, Brüderlichkeit - Provokation, Maxime, Utopie. Ansätze einer fraternitären Gesellschaft in der Reformationszeit, in: HEINRICH R. SCHMIDT/ANDRÉ HOLENSTEIN /ANDREAS WÜRGLER (Hrsg.), Gemeinde, Reformation und Widerstand. Festschrift für Peter Blickle zum 60. Geburtstag, Tübingen 1998, 161–178; STRÜBIND, Eifriger als Zwingli (s. Anm. 35).
46 DAGMAR BLAHA, Die Entwicklung der Visitationen als Mittel zur Durchsetzung der Kirchenreformation in Kursachsen, in: WERNER GREILING/GERHARD MÜLLER/UWE SCHIRMER/HELMUT G.WALTHER (Hrsg.), Die Ernestiner. Politik, Kultur und gesellschaftlicher Wandel (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 50), Köln/Weimar/Wien 2016, 123–144, hier bes. 133–134.
47 RUDOLF HERRMANN, Die Kirchenvisitationen im Ernestinischen Thüringen vor 1528, in: Beiträge zur Thüringischen Kirchengeschichte 1 (1930), Heft 2, 167–179. Vgl. auch CHRISTOPH VOLKMAR, Frühe Visitationen als Reformation vor Ort. Quellen, Akteure, Interessenlagen, in: DAGMAR BLAHA/CHRISTOPHER SPEHR (Hrsg.), Reformation vor Ort. Zum Quellenwert von Visitationsprotokollen, Leipzig 2016, 31–56.
48 WA Br 3, 470.
49 Auffr[ue]r / Zwytracht vñ vn=||ainigkait / zwischen waren Euan=||gelischen Christen für zůkomen/ kurtz auch || vnüberwintlich leer / Ainem yeden erkenner || Gottes / besunder / Allen frommen Chri=||stenlichen Fürsten … || notturfftig / vor ergangner auffr#[ue]r || Etlichen … Herren || gepredigt / vnd … || in truck || bracht.|| Augsburg 1526. (VD16 S 9474) Bl. A2 r.
50 Wider den vnmilten Jrrt|| Maister Vlrichs zwinglins / So || er verneünet / die warhafftig gegenwirtigkait || dess allerhailligsten leybs vnd bluets Chri=||sti im Sacrament. Doct. Jacobi Strauß || … ablenung / vnd er=||claerung … || Jm jar. M.D.XXVj. Mense Junij.|| Margraffen Baden. [Augsburg 1526] (VD16 S 9515).
51 IRENE DINGEL (Hrsg.), Justus Jonas (1493–1555) und seine Bedeutung für die Wittenberger Reformation (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 11), Leipzig 2009.
52 CONFVTATIO || CALVMNIOSISSIMAE RE=||SPONSIONIS IVSTI IONAE, ID EST,|| IODOCI KOCH, VNA CVM ASSER||tione bonorum operum, per || Georgium Vuicelium.|| Leipzig 1533 (VD16 W 3901), Bl. B4 r.