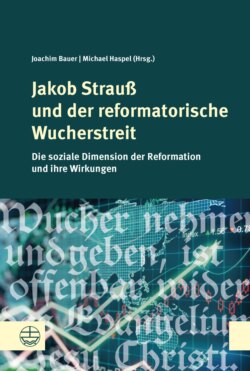Читать книгу Jakob Strauß und der reformatorische Wucherstreit - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE BEZIEHUNGEN EISENACHS
ZUM WEIMARER HOF UNTER JOHANN DEM BESTÄNDIGEN
ОглавлениеDagmar Blaha
Eisenach mit der hoch über der Stadt gelegenen Wartburg war nach dem Aussterben der ludowingischen Landgrafen in Thüringen im Mannesstamm zusammen mit einem Großteil ihres Territoriums an die Wettiner gekommen. Für dieses Adelsgeschlecht bedeutete das einen beachtlichen Gebietszuwachs und die Festigung ihrer politischen Stellung unter den Fürsten des Reiches. Nach langwierigen Erbauseinandersetzungen mit Sophie von Brabant (1224–1275), die als Tochter der Heiligen Elisabeth (1207–1231) und des Landgrafen Ludwig IV. (1200–1227) das Erbe für ihren Sohn Heinrich das Kind (1244–1308) beanspruchte, konnten die Markgrafen von Meißen 1264 schließlich das ehemals landgräfliche Territorium in Thüringen mit der Stadt Eisenach in Besitz nehmen. Für Heinrich das Kind blieben die ehemaligen ludowingischen Besitzungen in Hessen.1 Seitdem Markgraf Friedrich der Freidige (1257–1323) im Jahr 1310 durch den Kaiser Heinrich VII. (1278/79–1313) mit der Landgrafschaft Thüringen belehnt worden war, waren die Wettiner die nunmehr auch reichsrechtlich anerkannten Stadtherren von Eise nach. Die Stadt und die Wartburg hatten sich bereits unter den ludowingischen Landgrafen zu einem beliebten Wohn- und Repräsentationsort entwickelt und waren ein bedeutendes kulturelles Zentrum des Mittelalters im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Hans Patze sah in Eisenach die Hauptstadt der ludowingischen Landgrafschaft Thüringen.2
1. EISENACH ALS ZENTRALORT DER WETTINER
Unter der Herrschaft der Wettiner setzte sich die seit dem 12. Jahrhundert unter ihren Vorgängern begonnene Entwicklung zu einem hochmittelalterlichen reichsfürstlichen Verwaltungszentrum fort. Die von den Ludowingern zur Sicherung ihres und ihrer Untertanen Seelenheils gestifteten Klöster der Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen und Dominikaner wurden durch die Wettiner weiter gefördert, durch die von ihnen begünstigten Niederlassungen von Franziskanern, Karthäusern, Augustiner-Chorherren und Zisterziensern ergänzt und unter fürstlichen Schutz gestellt.3 Vor allem daraus erklärt sich wohl die sehr dichte sakrale Topographie Eisenachs, welche die Stadt und ihre Umgebung zu Beginn des 16. Jahrhunderts kennzeichnete. Der Kupferstecher, Chronist und Verleger Matthäus Merian (1593–1650) stellte in seiner »Topographia Superioris Saxoniae …« fest, »daß fast an keinem Ort so viele Mönche Nonnen Pfaffen Meßpriester Kirchen Clöster Capellen und Clausen gewesen als eben allhiero.«4
Ein reichhaltiges geistliches Leben sollte die Stadt attraktiv machen für ihre Bewohner und Zuzügler. Die geistlichen Einrichtungen der Stadt, allen voran die 1294 durch Landgraf Albrecht den Entarteten (1240–1314) in ein Kollegiatstift umgewandelte Marienkirche, hatten zudem Bedeutung für die landesherrliche Repräsentation und Verwaltung. Etliche Angehörige der wettinischen Landesverwaltung besaßen im Eisenacher Marienstift, aber auch in anderen geistlichen Einrichtungen in der Stadt Pfründen.5 Darüber hinaus stellten die Kirchen, Klöster und Hospitäler einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Von den Landgrafen in Thüringen, aber auch von Adligen der Umgebung wurden sie so reich ausgestattet, dass der umfangreichste Grundbesitz in der Eisenacher Gegend in der Hand von Kirchen und Klöstern war. Die ihnen zugeeigneten Einkünfte deckten mehr als ihren Bedarf. Das ermöglichte es den geistlichen Einrichtungen, zum einen als Grundherr, zum anderen als Geldverleiher in Eisenach und Umgebung zu wirken. Zudem trugen die Klöster als Orte des Dienstes an Gott und den Menschen, der Heiligenverehrung und der Bildung auch zum gesellschaftlichen Ansehen des ludowingischen und späteren wettinischen Zentralortes bei. Die jedes Jahr in Eisenach stattfindenden Generalkapitel der Dominikaner, an denen auch weltliche Herrscher teilnahmen, stellten ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis dar. Im Jahr 1349 war das Dominikanerkloster sogar Veranstaltungsort eines Hoftages König Karls IV. (1316–1378). 6
Die Stadt bildete einen eigenen Rechtsbezirk, der durch einen landgräflichen Schultheiß verwaltet wurde. Ihm zur Seite standen zwölf Schöffen. Seit etwa 1250 ist ein städtischer Rat nachweisbar. 1286 hatte Landgraf Albrecht den Eisenacher Bürgern das Recht verliehen, zwei Bürgermeister zu wählen, die die Interessen der Bürger gegenüber dem landesherrlichen Verwalter vertraten. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts war die Stadt pro forma in Selbstverwaltung, die Angehörigen des städtischen Rates mussten allerdings durch den Landesherrn bestätigt werden. Eine eigene Gerichtsbarkeit erwarb die Stadt nicht, lediglich Fragen von sogenannter freiwilliger Gerichtsbarkeit, also Kauf, Tausch und Verpfändung von Grundstücken und Gütern sowie Verfahren wegen Vergehen gegen den städtischen Rat konnte von diesem selbst entscheiden werden.7
Auch nach dem Anfall an die Wettiner behielten die Wartburg und Eisenach einen herausragenden Platz innerhalb ihres Machtbereiches. Dazu dürfte neben den von den Ludowingern herrührenden Herrschaftsstrukturen und -einrichtungen auch die Tatsache beigetragen haben, dass Eisenach Wirkungsort der im Jahr 1235 heiliggesprochenen Elisabeth von Thüringen war. Mit ihr fühlten sich die Wettiner besonders verbunden. Deutlich wird dies beispielsweise durch die Einrichtung eines der Heiligen geweihten Franziskanerkonvents in Eisenach durch Landgraf Friedrich den Ernsthaften (1310–1349), in dem von ihr einst unterhalb der Wartburg eingerichteten Hospital. Dort wurden auch bedeutende Elisabethreliquien aufbewahrt. Der Löffel der Heiligen Elisabeth ist spätestens seit 1513 in der berühmten Reliquiensammlung Friedrichs des Weisen an hervorragender Stelle als erstes bzw. zweites Stück im ersten Gang nachgewiesen.8
2. DER AUSBAU WEIMARS ALS RESIDENZ DER WETTINER
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts setzte allerdings eine zunehmende Ostverlagerung der wettinischen Zentralorte in Thüringen ein, die sich noch verstärkte, nachdem Weimar im Jahr 1372 in den Besitz der Wettiner gelangt war. Für Albrecht den Entarteten und Friedrich den Freidigen war die Wartburg noch bevorzugte Residenz, unter Friedrich dem Ernsthaften erlangte der in der Stadt gelegene Steinhof, der später die Bezeichnung Zollhof führte, als Aufenthaltsort zunehmend an Bedeutung. Balthasar, Landgraf in Thüringen und Markgraf zu Meißen (1336–1406), war der letzte Wettiner, der die Wartburg häufiger als Aufenthaltsort nutzte. Allerdings trat unter seiner Herrschaft neben Eisenach auch Gotha, bis 1359 der Witwensitz seiner Großmutter Elisabeth von Arnshaugk (1286–1359), als Residenz in Erscheinung. Seit den 1430er Jahren dominierte Weimar neben Eisenach als Hauptstandort des wettinischen Hofes in Thüringen. Ausschlaggebend für die zunehmende Bevorzugung Weimars, das zu dieser Zeit Eisenach sowohl an Größe als auch in geistlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht um einiges nachstand, war mit großer Sicherheit die Lage Eisenachs an der Peripherie des kursächsischen Herrschaftsgebietes.9 Mit der Entwicklung von der Reise- zur Residenzherrschaft bot Weimar nun einfach die besseren Voraussetzungen als Verwaltungszentrum. In dem Zuge, in dem Herrschaft immer weniger durch das Bereisen des Territoriums seitens des Herrschers und seines Hofes ausgeübt wurde, erlangte ein möglichst zentral gelegener Herrschafts- und Verwaltungssitz an Bedeutung. Durch seine zentrale Lage in Thüringen war Weimar hier gegenüber Eisenach deutlich im Vorteil. Die im Gegensatz zu Eisenach nur gering entwickelten Strukturen zur Versorgung eines reichsfürstlichen Hofes in Weimar wurden durch die Nähe zu Erfurt kompensiert. Die Stadt, die man auch das »thüringische Kleinod« nannte, konnte mit den dort ansässigen Händlern, Handwerkern und Künstlern, als Universitätsstadt und Umschlagplatz für exotische Handels- und begehrte Luxusgüter, aber auch für Informationen, die Bedürfnisse eines größeren Hofes durchaus befriedigen. Zudem war die Weimarer Burg einfacher zu erreichen als die Höhenburg über Eisenach. Das waren die entscheidenden Vorteile der Stadt an der Ilm gegenüber dem alten ludowingischen Landgrafensitz.
Bereits Wilhelm III., der Tapfere (1425–1482), bevorzugte Weimar als Herrschaftssitz, nachdem ihm in der sogenannten Altenburger Teilung 1445 die thüringische Landgrafschaft und die fränkischen Besitzungen der Wettiner zugefallen waren. Ihm waren Stadt und Burg bereits seit 1437 vertraut, als er für zwei Jahre am Hof seines Onkels Friedrichs des Friedfertigen lebte, für den bereits ein Drittel seiner nachweisbaren Aufenthalte in Weimar festgestellt werden konnten. Unter Wilhelm III. begann der Ausbau Weimars zur reichsfürstlichen Residenz.10 Er war es vermutlich auch, der die Reliquien der Heiligen Elisabeth, mit Ausnahme des Mantels, in seine Residenz nach Weimar holte und diese an die weiblichen Familienmitglieder verlieh, wenn diese ein Kind erwarteten.11
Der Ausbau zur Residenzstadt fand seine Fortsetzung und Intensivierung, nachdem Herzog Johann von Sachsen (1468–1532) ab 1514 seinen Hauptaufenthaltsort von Torgau nach Weimar verlegt und einen großen Hof in Weimar etabliert hatte. Im November 1513 war auf Wunsch seines Bruders, des Kurfürsten Friedrichs des Weisen (1463–1525), eine Verwaltungsteilung des kurfürstlich-sächsischen Territoriums vereinbart worden. Der gemeinsame Territorialbesitz wurde so aufgeteilt, dass Friedrich den nördlichen, Johann den südlichen Teil verwaltete, der im Wesentlichen das ernestinische Thüringen, Teile des Vogtlandes und die Pflege Coburg umfasste.12 In Weimar war damit neben Torgau/Wittenberg ein zweiter Verwaltungsmittelpunkt des Kurfürstentums Sachsen entstanden.13
Bei seiner Herrschaftsausübung ließ sich Herzog Johann von Sachsen wie andere Herrscher seines Standes von Vasallen beraten, die ihm nach Lehensvertrag zur Hilfe durch »consilium et auxilium«, durch »Rat und Tat« verpflichtet waren. Das waren in der Regel Vertreter des Landadels, die das Vertrauen des Herzogs besaßen und über notwendige juristische Kenntnisse verfügten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts öffneten allerdings auch zunehmend ein abgeschlossenes Jura-Studium und der Doktortitel juris utrisque Bürgerlichen die Schlosstore und den Zugang zum fürstlichen Hof. Die 1499 im Kurfürstentum Sachsen eingeführte Hofratsordnung bestimmte, dass sich mindestens vier Räte ständig am Hof aufzuhalten, täglich zu festgelegten Zeiten die aufgetretenen Probleme untereinander zu diskutieren und dem Fürsten einen Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten hatten.14 Bekannte Weimarer Räte des Herzogs Johann waren beispielsweise sein Kammerschreiber Johann Rietesel († 1543), der Kanzler Gregor Brück (nach 1485–1557), sein Hofmarschall Nickel vom Ende zum Stein († 1540), der Erfurter Jurist Johann von der Sachsen (nachgew. 1514–1527) und Anarg von Wildenfels (nachgew. 1498–1543). Sie wurden bei Beratungen der zahlreichen Einzelfälle unterstützt und ergänzt durch hinzugeforderte Adlige mit besonderer Ortskenntnis oder anderen Spezialkenntnissen, zum Beispiel auf dem Gebiet des Finanzwesens oder der Bergbauverwaltung oder durch kurfürstliche Lokalbeamte.
Seine Verwaltungstätigkeit stützte Herzog Johann vor allem auf die Lokalverwaltung seines Territoriums durch Amtleute. Deshalb reichten am Hof wenige Räte aus, die sich ständig dort aufhielten. Ohne die Verbindungen der Amtleute und Schosser in den Ämtern untereinander und zu den übrigen Landadligen, ohne deren Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten wäre eine Verwaltung in dieser Zeit undenkbar gewesen, von einer Regierung ganz zu schweigen. Diese Amtleute genossen das besondere Vertrauen der Fürsten. Sie sorgten nicht nur für die Einnahme der Erträge und Abgaben der Ämter sowie für die Erhaltung des fürstlichen Besitzes, sie waren auch für Informationsbeschaffung und Nachrichtenübermittlung und für die Einhaltung von Recht und Gesetz in ihrem Bereich verantwortlich. Sie waren mit weitgehenden landesherrlichen Befugnissen ausgestattet und so eine unersetzliche Stütze des Fürsten bei der Regierung seines Landes.15
3. AMT UND STADT EISENACH IM 16. JAHRHUNDERT
Eisenach war im 16. Jahrhundert Sitz eines solchen Amtes. Die Amtsbezeichnung wechselt zwischen »Amt Wartburg« und »Amt Eisenach«.16 Der Amtmann residierte auf der Wartburg. Die Belange der Wettiner als Stadtherren von Eisenach nahm wie zu landgräflichen Zeiten ein Schultheiß in deren Auftrag wahr. Dieser führte aber auch die Amtsrechnungen und war für die Einnahme der Steuern verantwortlich, hatte also im Wesentlichen in seinem Zuständigkeitsbereich die gleichen Aufgaben zu erfüllen wie ein Amtmann. Die Stadt war Bestandteil des Amtes, zu dem außer Eisenach noch sechs, ab 1523 sieben Dörfer, der sogenannte Steig, der 1850 unter der Bezeichnung Ehrensteig in die Stadt Eisenach eingemeindet wurde, sowie kleinere Besitzungen in den umliegenden Ortschaften, gehörten.17 Wenn also nach den Beziehungen Eisenachs zum Weimarer Hof gefragt wird, so betrifft diese Frage neben der Stadt immer auch das Amt Eisenach. Die Integration von Städten in Amtsgebiete war gängige Praxis in allen Gebieten des sächsischen Kurfürstentums. Neben den wettinischen Landesherren hatten auch Adlige in der Eisenacher Gegend Rechte und Besitz. Diese Adligen waren alle kanzleisässig, das heißt, sie unterstanden nicht dem Amt, sondern erhielten Nachrichten, Anweisungen und Befehle direkt aus der Kanzlei Herzog Johanns.
Der ranghöchste und bestbezahlte landesherrliche Beamte eines Amtes war der Amtmann. Der Fürst musste ihm absolut vertrauen können, denn er war in dem ihm zugewiesenen Sprengel nicht nur höchster Dienstmann, sondern auch Vertreter des Landesherrn in allen Angelegenheiten. Deshalb wurde das Auswahlverfahren auch mit großer Sorgfalt betrieben. Als im Frühjahr 1517 der Eisenacher Amtmann Caspar von Boyneburg aus dem Amt schied, war es sowohl Kurfürst Friedrich als auch Herzog Johann klar, dass die Stelle so schnell wie möglich neu besetzt werden musste. Aber es war wohl nicht ganz einfach, einen Mann zu finden, der »zu einem solchen amt zu gebrauchen tuglich und nutzlich« war. Zur Auswahl standen der herzogliche Rat Anarg von Wildenfels, der Amtmann des benachbarten Amtes Hausbreitenbach, Hans Metzsch (um 1490–1549), und Hans von Berlepsch (um 1480–1533). Letzteren hatte zwar Friedrich der Weise bereits als Amtmann für Schlieben vorgesehen, verzichtete dann aber auf seine Bestallung, weil er Herzog Johanns Favorit für die Stelle im Amt Eisenach war. Er begründete dies damit, dass der Kandidat »des orts umb Eysenach wol bekannt« war und außerdem dort Besitzungen hatte. Hans von Berlepsch selbst war ebenfalls bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, nachdem Herzog Johann seine Besoldung gegenüber seinem Vorgänger noch einmal kräftig aufgestockt hatte. Nach Friedrich von Thun (um 1450–1535), dem Amtmann von Weimar, war Hans von Berlepsch mit 114 Gulden und 19 Groschen sowie etlichen Naturalien der zweithöchstdotierte Amtmann Herzog Johanns.18
Hans von Berlepsch gehörte einem uradligen Geschlecht an und war Sohn des hessischen Erbkämmerers Sittich von Berlepsch. Er wurde etwa 1480 auf der Burg Berlepsch, heute in einem Ortsteil von Witzenhausen, geboren. Mit Herzog Johann von Sachsen verband ihn ein besonderes Vertrauensverhältnis. Seit mindestens 1514 stand er in den Diensten des kurfürstlichen Bruders.19 Hans von Berlepsch ist vor allem im Zusammenhang mit Luthers Wartburgaufenthalt bekannt geworden. Er war Amtmann und zugleich Burghauptmann der Wartburg zu jener Zeit, als sich Luther dort verborgen hielt. Zusammen mit dem Coburger Amtmann Hans von Sternberg inszenierte er den Überfall auf Luther und dessen Entführung, den die Amtleute von Weimar und Weida, Friedrich von Thun und Philipp von Feilitzsch (vor 1473 bis nach 1532) gemeinsam mit dem kurfürstlichen Sekretär Georg Spalatin (1484–1545) vorbereitet hatten.
Man kann sicher davon ausgehen, dass bei der Auswahl der Wartburg als Aufenthaltsort für den gebannten und geächteten Reformator das besondere Vertrauensverhältnis der fürstlichen Brüder zu Berlepsch eine Rolle spielte. Dieser soll sich spätestens seit 1521/22 zu Luthers Lehre bekannt haben, was vermutlich das Resultat der persönlichen Bekanntschaft des herzoglichen Amtsträgers mit Martin Luther auf der Wartburg war. Er stellte praktisch die Verbindung Luthers mit der Außenwelt, auch zu Herzog Johann von Sachsen her, während dieser sich zwangsweise auf der Wartburg aufhalten musste. Auf Berlepschs Vermittlung hin legte Luther dem Herzog die Perikope von den zehn Aussätzigen20 aus. Auch mit dem Wartburghauptmann selbst hat Luther offensichtlich theologische Probleme erörtert. Wie er Spalatin mitteilte,21 hätte er seinem Wirt (»hospiti meo«) gern die Schrift »Von Menschenlehre zu meiden«22 gewidmet, die im Ergebnis der Diskussionen über menschliche Satzungen und Traditionen entstanden war. Aus Sicherheitsgründen unterblieb dies aber. Hans von Berlepsch kaufte 1523 die Wasserburg Seebach bei Mühlhausen, die am 30. April 1525 durch aufständische Bauern ausgeraubt wurde. Berlepsch, der noch am 24. April 1525 von der Wartburg aus über den Einzug der Bauern in Salzungen berichtet hatte, eilte auf sein Gut, wo ihn die Aufständischen gefangen nahmen. Mit dem Vorwurf, er hätte seinen Amtssitz, die Wartburg, unerlaubt verlassen, wurde er von Herzog Johann 1525 seines Amtes enthoben. Das Vertrauensverhältnis war offensichtlich erschüttert. Möglicherweise haben den Herzog zudem die Anschuldigungen des mit der Visitation im Amt Eisenach beauftragten Jakob Strauß (um 1480 bis vor 1530) nicht unbeeindruckt gelassen, der die Teilnahme Berlepschs an dieser Visitation ablehnte mit der Begründung, der Amtmann auf der Wartburg sei mit dem Abt von Reinhardsbrunn, der Äbtissin und dem Vorsteher des Nikolaiklosters »ein seel, ein hertz und gemut« und verhindere, dass die Kinder Zugang zum reinen Wort Gottes erhielten.23 1533 befindet sich Berlepsch in mansfeldischen Diensten.24
Über den fürstlichen Vertreter in der Stadt Eisenach, der wie in ludowingischen Zeiten die Bezeichnung »Schultheiß« führte, ist weit weniger bekannt. In dem von uns betrachteten Zeitraum ist es Johann Oswald(t) (gen. 1505–1531) gewesen, der spätestens seit Mai 1506 in dieser Funktion in Eisenach tätig war, nachweisbar bis Michaelis 1525.25 Sein Nachfolger Hans Bahner wurde zu diesem Zeitpunkt in die Amtsgeschäfte eingeführt. Der Eisenacher Schultheiß war auch für die Führung der Amtsrechnungen und die Einnahme und Ablieferung der Steuern zuständig. Er nahm also auch die Funktion eines Schossers war. Rangmäßig stand er hinter dem Amtmann, fungierte aber des Öfteren als dessen Vertreter, wenn dieser abwesend war. Seine Besoldung war allerdings mit 67 Gulden und drei Groschen26 um Etliches geringer als die des Amtmannes. Auch wurde er nicht aus der herzoglichen Kammerkasse, sondern aus Mitteln des Amtes bezahlt, gehörte also zum Amtspersonal. Auch zu Oswald hatte der Herzog nach den Bauernunruhen wohl kein Vertrauen mehr. Der ehemalige Schultheiß tritt 1528 als Bürgermeister in Gotha in Erscheinung und war 1531 als solcher Mitglied der Sequestrationskommission für Thüringen.27
Die Aufgaben, die Hans Berlepsch und Johann Oswald im Auftrag ihres Landesherrn zu erfüllen hatten, waren vielfältiger Natur. Oberstes Gebot war natürlich die Wahrung von Ruhe und Ordnung in Amt und Stadt. In dieser Funktion waren die beiden Beamten erste Anlaufstelle zur Beilegung von Streitigkeiten. Erst wenn die Schlichtungsversuche erfolgslos waren, durften die Parteien an den herzoglichen Hof verwiesen werden. Allerdings muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass die Gerichtshoheit lediglich auf den Grundbesitz des Amtes beschränkt war, andere Gebiete unterstanden anderen Gerichtsherren, was auch regelmäßig zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen Amtspersonal und Geistlichkeit führte. Darüber hinaus war es wohl vorrangig Aufgabe des Schultheißen, flüchtige Tatverdächtige einzufangen.28 Außerdem waren Amt und Stadt vor dem Einfall Fremder zu schützen, für die termingerechte und vereinbarungsgemäße Stellung des Amtsaufgebotes zu sorgen, die Einnahmen des Amtes zu verwalten und darüber gegenüber dem Fürsten Rechenschaft zu legen, Straßen instand zu halten, durchziehende Händler und Abgesandte anderer Territorien zu beschützen.29 Das konnten durchaus hochgestellte Persönlichkeiten sein wie im Juni 1524 die Königin von Dänemark oder die Botschafter des Kaisers. Wenn erforderlich, sorgte der Schultheiß auch für Nachtquartier. Fürstliche Personen, manchmal auch der Herzog oder sein Bruder Friedrich,30 fanden im Amts- und Wohnsitz des Schultheißen, dem Zollhof, Unterkunft. Dieser verfügte zu diesem Zweck über eine Hof- und eine Saalstube sowie Fürstengemächer.31 Ab 1520 hatte Herzog Johann das Gebäude durch den Bau eines Küchentraktes und einer Badstube, die Pflasterung des Hofes und die Einrichtung eines »springenden rorbronnen in einem eichenkasten« modernisieren lassen.32 Anfang September 1520 informierte sich Friedrich der Weise persönlich über den Stand der Bauarbeiten vor Ort und berichtete seinem Bruder aus Eisenach.33 Andere Durchreisende wurden in den Herbergen der Stadt untergebracht. Die Botschafter des Kaisers, die in Richtung Hessen unterwegs waren, nächtigten beispielsweise beim »Wirthe zum Christoff« in Eisenach.34 Wenn in Frankfurt am Main eine Messe bevorstand, wurden die Adligen der Umgebung dazu aufgefordert, die Straßen mit einem Militäraufgebot zu sichern.35 Amtmann und Schultheiß hatten das zu kontrollieren.
Jedes Jahr im November gab es eifrige Geschäftigkeit in der Stadt und auf der Burg. Das Amtspersonal reinigte die Gemächer, Nahrungsmittel wurden aus den benachbarten Ämtern herangeschafft, die Wildwagen instand gesetzt und geschmiert für die herzogliche Jagd, die in der Regel Ende des Monats anstand.36 Dass diese reibungslos vonstatten ging und sich der Herzog und seine hochgestellten Gäste wohlfühlten – auch dafür hatten Amtmann und Schultheiß zu sorgen. Am Weimarer Hof waren zudem Produkte aus der Region im Thüringer Wald beliebt. Neben Wildbret brachten Amtmann und Schultheiß auch Forellen aus Großenlupnitz und Käse aus dem Eisenacher Nikolaikloster auf den Weg nach Weimar.37
Das Hauptgeschäft beider landesherrlicher Beamter bestand jedoch darin, Streitigkeiten der Amtsuntertanen untereinander oder mit den Adligen und Geistlichen der Gegend zu schlichten und für die Informationsbeschaffung und Nachrichtenübermittlung zu sorgen. Ihrem Landesherrn hatten sie auf Anforderung und bei besonderen Vorkommnissen Bericht zu erstatten. Regelmäßig wurden Gerichtstage gehalten, an denen meistens Johann Oswald als Schultheiß teilnahm. Oft wurden Unstimmigkeiten aber auch auf eigens durch den Amtmann angesetzten Tagen verhandelt wie etwa im August 1523, als er gemeinsam mit dem Gothaer Amtmann Burkhardt Hundt zwischen denen von Wangenheim und deren Leuten in Waltershausen verhandelte.38 Im Mai 1524 schlichteten Berlepsch und Oswald in Creuzburg Unstimmigkeiten zwischen den dortigen Bürgern und dem Jungfrauenkloster.39 Konnten die Differenzen nicht ausgeräumt werden oder gab es Unklarheiten in der Verfahrensweise, wurde am Weimarer Hof nachgefragt wie im Juli 1522 wegen eines gefangenen Priesters.40 Oder einer der beiden Eisenacher Beamten reiste nach Weimar, um sich dort mit den Weimarer Räten zu beraten wie im Mai 1522 in Angelegenheiten des Abtes von Pforta und des Katharinenklosters in Eisenach41 und natürlich auch im Januar 1524, als es um die Auseinandersetzung zwischen den Geistlichen und den Bürgern Eisenachs wegen der Zinszahlungen ging.42
4. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM AMT EISENACH UND DEM WEIMARER HOF BIS 1525
Eine besonders wichtige Funktion der landesherrlichen Beamten in den Ämtern war die Informationsbeschaffung und Nachrichtenübermittlung. Häufig kam vom Weimarer Hof die Aufforderung, über bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen Erkundigungen einzuziehen und zu berichten. Hier stellte Eisenach eine Art Sammelpunkt für Nachrichten aus den umliegenden Ämtern Hausbreitenbach, Creuzburg, Gotha, Tenneberg, Gerstungen, Reinhardtsbrunn und Salzungen dar, die dann von der Wartburg aus nach Weimar gesandt wurden. Aber auch umgekehrt war das der Fall. Sehr häufig wurden Schreiben des Weimarer Hofes an Amtleute umliegender Ämter, kanzleisässige Adlige oder Geistliche nach Eisenach geschickt mit der Aufforderung, sie an die Empfänger weiterzuleiten. Die Eisenacher Beamten erfüllten also für die Landesherrschaft auch eine Art Vermittlerfunktion und die Stadt war immer noch eine Art Zentralort, wenn auch nur für das südthüringische Territorium. Eine ähnliche Mittelpunktfunktion lässt sich auch für Gotha, Altenburg und Weida, alles ebenfalls alte Herrschaftszentren, nachvollziehen.
Gegenüber dem Landesherrn hatten Amtmann und Schultheiß besonders dann Bericht zu erstatten, wenn es zu außergewöhnlichen Ereignissen kam, wie beispielsweise im Frühjahr 1525, als sie die aufgebrachte Bürgerschaft nur besänftigen konnten, indem sie die Pfaffen, Mönche und Nonnen aus der Stadt wiesen. Trotzdem war eine große Zahl von Eisenacher Einwohnern dem in der Nähe liegenden Werra-Haufen zugelaufen.43 Zu diesem Haufen aufständischer Bauern hatte der Schultheiß am 23. April den Prediger an der Eisenacher Georgenkirche, Jakob Strauß, gesandt, mit dem Auftrag, die Leute zu beruhigen und möglicherweise zur Aufgabe ihres Vorhabens zu bewegen.44 Der Geistliche musste jedoch unverrichteter Dinge wieder umkehren, ja er konnte wohl froh sein, dass ihn die Bauern nicht in die Werra geworfen hatten.45
Jakob Strauß kam im Januar 1523 nach Eisenach. Die Umstände der Aufnahme seiner Predigertätigkeit an der Georgenkirche konnten bisher nicht eindeutig geklärt werden. In der Literatur besteht aber fast völlige Übereinstimmung darüber, dass er entweder durch Herzog Johann, was wahrscheinlich ist, oder durch Kurfürst Friedrich, was vermutlich nicht zutrifft, in das Eisenacher Amt entsandt wurde.46 Anforderungen aus der Georgenkirche nach einem neuen Prediger oder etwa eine Empfehlung Luthers sind nicht überliefert oder bisher nicht entdeckt worden. Bekannt ist, dass Jakob Strauß an der Disputation zwischen dem Erfurter Prediger Johannes Lang (um 1487–1548) und den Weimarer Franziskanermönchen Ende 1522 in Weimar teilnahm. Es wäre durchaus möglich, dass der Hofprediger Herzog Johanns, Wolfgang Stein, seinen Herrn auf ihn aufmerksam machte.47 Mitte Januar 1523 war Hans von Berlepsch in Weimar, das geht aus der Eisenacher Amtsrechnung hervor.48 Am 14. Januar 1523 sind die Herbergskosten für einen vierzehntägigen Aufenthalt von Strauß aus der herzoglichen Kammerkasse beglichen worden.49 Möglicherweise hat Berlepsch Strauß ja in Weimar abgeholt und nach Eisenach gebracht.
Besonders im Jahr 1523, also dem ersten Jahr der Predigttätigkeit von Strauß in Eisenach, bestand intensiver Kontakt zu Herzog Johann, zum Weimarer Hofprediger Stein und zum Weimarer Hof. Die Tatsache, dass die Reisekosten und die Auslagen für die Boten, die mit der Korrespondenz zwischen Strauß und Herzog Johann hin- und hereilten, von der herzoglichen Kammerkasse getragen wurden, weist darauf hin, dass der Kontakt vor allem von Weimar aus gepflegt wurde.50 Ein weiterer Aufenthalt in Weimar wurde aus der Amtskasse bezahlt, ging aber auch auf eine Forderung von Herzog Johann an seinen Eisenacher Prediger zurück.51 Im April 1523 hielt sich der Weimarer Hofprediger Wolfgang Stein längere Zeit in Eisenach auf – ebenfalls auf Kosten der herzoglichen Kammerkasse.52 Er stellte vermutlich das Bindeglied zwischen Herzog Johann und Jakob Strauß dar. Das alles, wie auch die Tatsache, dass Herzog Johann Anfang 1525 Jakob Strauß mit einer Untersuchung der Tätigkeit und des Lebenswandels der Prediger, ob sie in einer Art seien, »so sich der gotlichen schrifft nach gezymet unnd gebure«53, beauftragte, zeugt davon, wie sehr der Herzog den Eisenacher Prediger als Berater geschätzt und wie sehr er ihm vertraut hat.
Und es liegt noch eine weitere Vermutung nahe: Kurfürst Friedrich wie auch Herzog Johann betonten beide immer wieder, dass sie sich in Fragen des Glaubens und der Religion nicht für kompetent genug hielten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Beide sahen allerdings die Deutungshoheit über kirchenpolitische Angelegenheiten seit Anfang der 1520er Jahre nicht mehr ausschließlich bei der Kurie. Kurfürst Friedrich ließ in Wittenberg solche Probleme von den Theologen und Juristen der Universität, allen voran Martin Luther, sowie den Stiftsgeistlichen diskutieren und befand dann über deren Entscheidungsvorschlag. Johann hatte diese Möglichkeit in Thüringen nur bedingt. Natürlich konnte er bei bestimmten Problemen in Wittenberg rückfragen, das hat er ja beispielsweise auch bei der Auseinandersetzung mit der Wucherproblematik getan. Im Auftrag des Herzogs übersandte Kanzler Gregor Brück die Strauß’sche Schrift über den Wucher an Martin Luther in Wittenberg, der ihm mit der Bitte antwortete, das von ihm angefertigte und mitgeschickte Gutachten dazu an den Herzog weiterzuleiten.54 Aber den Wittenberger Protagonisten fehlte die thüringische Ortskenntnis. Es sieht so aus, als hätte sich Johann gezielt für bestimmte Brennpunkte seines Herrschaftsbereiches geeignete Prediger gesucht, die ihn und seine Räte von dort aus mit Informationen versorgten, den Herzog und den Hof in kirchenpolitischen Fragen berieten und vor Ort als Geistliche praktisch tätig waren. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang z. B. an Nikolaus Hausmann, seit 1521 Pfarrer an der Marienkirche in Zwickau, der für Herzog Johann mindestens zwei theologische Gutachten anfertigte.55 1523 begann Jakob Strauß in Eisenach seine Tätigkeit und ab 1524 wirkten Friedrich Mykonius in Gotha und Johannes Grau an der Stadtkirche in Weimar. Sie alle wurden zu theologischen Fragen vom Herzog immer wieder konsultiert. Sie waren es auch, die seine Entscheidungen in geistlichen Angelegenheiten vor Ort durchsetzten. Im Zusammenhang mit der Integration der Kirchenorganisation in den landesherrlichen Territorialstaat und den Aufbau einer Landeskirche spielten sie eine entscheidende Rolle.
5. DER GESCHÄFTSGANG AM WEIMARER HOF UNTER HERZOG JOHANN
Wie gestalteten sich nun die Beziehungen zwischen Eisenach und dem Hof Herzog Johanns auf der Geschäftsebene? Das soll abschließend auf der Grundlage der Überlieferung zum sogenannten Eisenacher Wucherstreit56 ausgeführt werden.
Im Jahr 1523, nachdem Strauß’ erste Wucherschrift57 erschienen war, müssen sich Geistliche aus Eisenach bei Herzog Johann beschwert haben, dass ihnen keine Zinsen mehr bezahlt würden. Strauß sowie der Schultheiß sprachen in dieser Angelegenheit im Herbst 1523 bei Herzog Johann sogar persönlich vor.58 Dieser gab wohl daraufhin Instruktion, was dem »haubtman, schulteys, radt, gemeyne und geistlicheyt« im Namen des Landesherrn auszurichten wäre.59 An erster Stelle stand, dass alle Prediger das Volk im »heiligen evangelio und worth gottis« zu unterweisen hätten. Unter den Predigern sei aber selbst Irrtum und Uneinigkeit »also das eyner den andern lesterer, schmeher und ketzer schilt«, was das Volk verunsichert habe und es »in irtumb und unfrieden gewießen und verfurt« habe. Deshalb werden die Prediger aufgefordert, »cristliche bruderliche einigkait zu pflantzen«60 und die Lästerung des göttlichen Wortes wie auch der Prediger zu unterlassen. An die Bewohner Eisenachs gerichtet, führte er mahnend aus, dass ihm sehr wohl bekannt sei, dass einige von ihnen die Predigten »in einen mißvorstandt gezogen und alßo eingenommen, das sie sich unterstehen, iren eigen nutz und nit die ere gottis oder die liebe des negsten zu suchen und sunderlich, ßo sie der gaistlicheit und auch andern mit erblichen oder widderuflichen zinsen vorhaft […] diese nit schuldig zu sein«. Deshalb befahl er »mit ernstem beger, wie das dieselbigen befelche mit sich bringen«, den Geistlichen und Weltlichen rechtmäßig zustehende Zinse künftig zu reichen, weil es niemandem gebühre »in seiner eigen sachen selbst richter zu sein.« Bei Uneinigkeit in dieser Frage sollten sie sich künftig an Amtmann, Schultheiß oder Rat wenden. Diese sollten sich der Sache annehmen und vor allem dafür sorgen, dass es künftig nicht zu weiteren Widersetzlichkeiten käme, aus denen Aufruhr und Empörung entstehen könnte. Sollten Anzeichen dafür erkannt werden, sollte der Herzog benachrichtigt werden, der für die Aufrührer empfindliche Strafen androhte.
Aber die Geistlichen beschwerten sich wieder, weil etliche Bewohner ihnen noch immer die Zinszahlung verweigerten. Jetzt wusste sich der Schultheiß nicht mehr zu helfen. Weil er selbst keine Möglichkeit mehr sah, diesen Konflikt beizulegen, begab er sich gemeinsam mit einem Vertreter des Eisenacher Stadtrates, Heinrich Weißensee, nach Weimar und berichtete am 14. Januar 1524 seine Sicht der Dinge sowohl schriftlich als auch mündlich am herzoglichen Hof.61 Angesichts der angespannten Lage bat er darum, den »ambtmann zu Wartburg« oder einen anderen als Kommissar nach Eisenach zu schicken, damit sie die ganze Angelegenheit untersuchen, die Beschwerden der Zinsschuldner anhören und »nach Billigkeit« helfen.62 Zwei Monate später, am 23. März 1524, reisten zwei Eisenacher Bürger – wie sie angaben, im Auftrag des Rates – nach Weimar und wurden am Hof vorstellig. Dort stellten sie sich schützend vor die Geistlichen und beschuldigten Jakob Strauß, die Menschen nicht nur zur Zinsverweigerung anzustacheln, sondern auch Empörung und Aufruhr zu predigen. Die herzoglichen Beamten in Eisenach seien dagegen machtlos. Gregor Brück, der herzogliche Kanzler, protokollierte ihre Aussage.63 Ihre Darstellung der Situation und die Anschuldigungen gegen Jakob Strauß lösten bei Herzog Johann Zweifel an deren Richtigkeit und unter den Hofräten eine intensive Beratung aus.
Man war sich einig darüber, dass eine Kommission vom Weimarer Hof nach Eisenach geschickt werden musste, um sich selbst ein Bild zu machen und klärend in die Auseinandersetzungen einzugreifen. Diese Mission wurde in einer Beratung des Hofrates intensiv vorbereitet. Angestrebt wurde eine gemeinsame Anhörung des städtischen Rates und des Predigers. Es wurden alle möglichen Konstellationen während der Verhandlungen bedacht und entsprechende Verhaltensvorschriften für die mit der Reise nach Eisenach beauftragten Räte festgelegt.64 So rechnete man damit, dass der städtische Rat nicht einig sein könnte und die Teilnahme des Predigers ablehnen würde. Das sollte dem Fürsten dann so berichtet werden und er würde sich selbst den Eisenachern gegenüber äußern. Sollte die Anhörung aber stattfinden und sich herausstellen, dass die Angaben der beiden Bürger nicht den Tatsachen entsprachen, so erwartete der Herzog eine Richtigstellung. Sollten sich die Anzeigen gegen Strauß hingegen als wahr herausstellen, sollten die Räte ihm das Missfallen des Herzogs ausdrücken und ihm bedeuten, er solle sich darauf beschränken, das Wort Gottes und die Nächstenliebe zu predigen. Die Bürger wären an ihre Pflichten zu erinnern und ihnen wäre zu bedeuten, dass der Fürst die Zinsverweigerung nicht länger zu dulden gedächte. Wenn aber Strauß die Vorwürfe bestritte, so solle er dies schriftlich tun, die Räte sollten das Schreiben an den Fürsten schicken, der sich dann dazu äußern würde.65 Auch die Geistlichen sollten angehört werden. Hier sollte vor allem der Bericht des Schultheißen Oswald als Grundlage dienen, »in dem aller mangel den geistlichen aufgeladen und das an den burgern kein fehl ist gewest.«66 Den Stiftsherren sollte aufgetragen werden, ein Verzeichnis der ihnen zustehenden Zinse an den Weimarer Hof zu schicken. Bei Klagen über zu hohe Zinsen sollten die Räte die Parteien auf einen Zinssatz von 5 Prozent vergleichen und nach Möglichkeit den Erlass der hinterstelligen Zinsen erreichen.67 Sollte sich aber herausstellen, dass Oswalds Bericht zu tendenziös war, so war ihm das Missfallen des Fürsten und eine Warnung vor dem Wiederholungsfall auszudrücken.
Damit war die Angelegenheit für den Weimarer Hof erledigt, so war der allgemein übliche Geschäftsgang am Weimarer Hof zur Klärung von sogenannten Gebrechen in Städten und Ämtern. Dass nicht immer eine Kommission an den Ort des Geschehens reiste, sondern die Beteiligten auch zur Anhörung an den Hof befohlen werden konnten, wissen wir aus den Auseinandersetzungen mit den Allstedtern und Thomas Müntzer, die ein halbes Jahr später stattfanden.
6. ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Regierungstätigkeit Herzog Johanns von Sachsen auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Hof- und Lokalbeamten stützte, wobei die erste Instanz immer die herzoglichen Beamten vor Ort waren. Konnten sie Angelegenheiten selbst nicht klären oder handelte es sich um außergewöhnliche Ereignisse mit großer Tragweite, berichteten sie darüber am Hof. Dort wurde dann, häufig mit der Kompetenz von Juristen, eine Entscheidungsvorlage für den Fürsten vorbereitet. Seit Anfang der 1520er Jahre setzte Johann von Sachsen an bestimmten Zentren seines Territoriums, zumeist in Städten, die ehemalige Herrschaftssitze waren, Theologen ein, die sich ausdrücklich zur lutherischen Lehre bekannten. Sie wirkten als Pfarrer oder Prediger vor Ort und berieten den Fürsten in geistlichen Angelegenheiten. Entscheidungen des Fürsten wurden dann durch die Kanzlei den Beteiligten abschließend zur Kenntnis gebracht. Für die Verteilung und Zustellung solcher »Bescheide« bediente man sich des Amtspersonals in Orten mit Mittelpunktfunktion, die sie an den Empfänger in der Region weiterleiteten. Obwohl die Verwaltung im Territorium Herzog Johanns von Sachsen noch überwiegend dezentral organisiert war, lässt sich spätestens seit Anfang der 1520er Jahre eine zunehmende Tendenz zur Zentralisierung seiner Regierungstätigkeit erkennen.
1 Vgl. KARL-HEINZ BLASCHKE, Geschichte Sachsens im Mittelalter, Berlin 1990, 274–281.
2 HANS PATZE, Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, I. Teil (mehr nicht erschienen) (= Mitteldeutsche Forschungen 22), Köln/Graz 1962, 496.
3 Vgl. FRANZISKA LUTHER, Die Klöster und Kirchen Eisenachs (1500–1530). Prologe zur Reformation und wie die Geistlichkeit vermeynen die Zinse aus etzlichenn armenn zu kelterenn, in: JOACHIM EMIG /VOLKER LEPPIN /UWE SCHIRMER (Hrsg.), Vor- und Frühreformation in thüringischen Städten (1470–1525/30) (= Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 1), Köln/Weimar/Wien 2013, 403–435, bes. 410–420.
4 MATTHÄUS MERIAN, Topographia Superioris Saxoniae, Thuringiae, Misniae, Lusatiae etc, Frankfurt am Main 1650, 66.
5 Vgl. BRIGITTE STREICH, Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung: Der wettinische Hof im späten Mittelalter (= Mitteldeutsche Forschungen 101), Köln/Wien 1989, 89–90.
6 Vgl. STREICH, Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung (s. Anm. 5), 82.
7 BRUNO KÜHN, Eisenach, Stadtkreis, in: ERICH KEYSER (Hrsg.), Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte, Stuttgart/Berlin 1941, 286–288; GERD BERGMANN, Ältere Geschichte Eisenachs. Von den Anfängen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Eisenacher Geschichtsverein, Eisenach 1994.
8 Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Ms. Bos. q 26a, Bl. 7r.
9 Vgl. DAGMAR BLAHA, »… in civitate nostra Wimare …«. Die Entwicklung Weimars zum Residenzort, in: ROSWITHA JACOBSEN (Hrsg.), Residenzkultur in Thüringen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (= Reihe PALMBAUM. Texte. Kulturgeschichte 8), Bucha bei Jena 1999, 43–58.
10 Vgl. BLAHA, in civitate nostra (s. Anm. 9), 52–54.
11 Vgl. JOSEPH KREMER, Beiträge zur Geschichte der klösterlichen Niederlassungen Eisenachs im Mittealter (= Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda II), Fulda 1905, 89–91; STREICH, Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung (s. Anm. 5), 84.
12 Vgl. zur Verwaltungsteilung zwischen Friedrich und Johann von Sachsen: ERNST MÜLLER, Die Mutschierung von 1513 im ernestinischen Sachsen, in: Jahrbuch für Regionalgeschichte Bd. 14 (1987), 173–182; JÖRG ROGGE, Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung und Familienorganisation im fürstlichen Hochadel. Das Beispiel der Wettiner von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Stuttgart 2002, 325–326.
13 Vgl. zum Weimarer Hof Herzog Johanns von Sachsen: DAGMAR BLAHA, Die Struktur des Weimarer Hofes unter Herzog Johann von Sachsen, in: CHRISTOPHER SPEHR / MICHAEL HASPEL /WOLFGANG HOLLER (Hrsg.), Weimar und die Reformation. Luthers Obrigkeitslehre und ihre Wirkungen, Leipzig 2016, 44–58.
14 Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar (künftig LATh – HStA Weimar), Ernestinisches Gesamtarchiv (künftig EGA), Urkunden Nr. 5621, hier: Bl. 2r–v. Diese Ordnung ist ediert von Gustav Emminghaus, Die Hofraths=Ordnung des Kurfürsten Friedrich des Weisen und Herzogs Johann von Sachsen, von 1499, in: ZVThürGA 2 (1857), 97–106.
15 Vgl. BLAHA, Weimarer Hof unter Herzog Johann (s. Anm. 13), 55–56.
16 Vgl. dazu: HILMAR SCHWARZ, Die Vorsteher der Wartburg, in: Wartburg-Jahrbuch 1994, Eisenach 1995, 58–84, hier: 68–70; HANS PATZE /WALTER SCHLESINGER (Hrsg.), Geschichte Thüringens, Bd. 3. Das Zeitalter des Humanismus und der Reformation, (= Mitteldeutsche Forschungen 48/III), Köln/Graz 1967, 152–157; ERICH DEBES, Das Amt Wartburg im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts, Eisenach 1926, 2.
17 Mosbach, Kittelsthal, Weißenborn, Eckartshausen, Förtha, Ruhla (eisenachischer Anteil), seit 1523 Etterwinden; vgl. DEBES, Das Amt Wartburg (s. Anm. 16), 6–9.
18 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Rr pag. 1–316 Nr. 112; vgl. auch LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Rr pag 1–316, Nr. 4, Bl 2r–v.
19 Berlepsch verhandelte im Auftrag Herzog Johanns im September 1514 mit Kaiser Maximilian I. über die Vormundschaftsverwaltung Hessens durch die Ernestiner (LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 4242, Bl. 55r).
20 »Das Evangelium von den zehn Aussätzigen«, WA 8, 336–397.
21 Luther an Spalatin, 24. März 1522, WA Br 2, Nr. 463, S. 480–481; WA 10 II, 61–62.
22 WA 10 II, 72–86.
23 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 133, Bl. 1r.
24 Die biographischen Angaben beruhen auf OTTO BÖCHER, Martin Luther und Hans von Berlepsch (= Schriftenreihe der hessischen Genossenschaft des Johanniter-Ordens 18), Speyer 1992.
25 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3194, Bl. 56v.
26 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Rr pag. 1–316, Nr. 4, Bl. 3r.
27 Vgl. C[arl] A[ugust] H[ugo]Burkhardt, Ernestinische Landtagsakten, Band I: Die Landtage von 1487–1532 (mehr nicht erschienen), Jena 1902, Nr. 361, S. 90/91; Nr. 425, 233–235.
28 DEBES, Das Amt Wartburg (s. Anm. 16), 47.
29 A. a. O., 1–19.
30 Eine Abrechnung der Aufwendungen über die Vorbereitung eines Aufenthaltes Herzog Johanns im Eisenacher Zollhof befindet sich für das Jahr 1522 in LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 1242, Bl. 36v–37r.
31 Eine Inventarisierung der Ausstattung des Zollhofes durch Johann Oswald von 1520 befindet sich a. a. O., Bl. 41r–44r.
32 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. S fol. 91b Nr. II.1 und 2, Bl. 15r+v.
33 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. S fol. 91b Nr. II.1 und 2, Bl. 21r-22v (09. 09. 1520); Bl. 23r (10. 09. 1520).
34 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3193, Bl. 95r.
35 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3193, Bl. 101v.
36 Vgl. beispielsweise LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3191, Bl. 51v; Nr. 3192, Bl. 103v.
37 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3191, Bl. 51r; 52r.
38 Vgl. LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3194, Bl. 3r; ediert in OTTO MERX, Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland, Erste Abteilung, Berlin 1923 (künftig AGBM I), Nr. 535, 384–385.
39 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3193, Bl. 96r.
40 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 1242, Bl. 30r.
41 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 1242, Bl. 31v.
42 Vgl. den Bericht des Schultheißen Johann Oswald und des Abgesandten des Eisenacher Rates am Weimarer Hof am 14. Januar 1524: LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 126, Bl. 1r–4r.
43 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. N 834, Bl. 2r; ediert in: Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland, Band II, unter Mitarbeit von Günther Franz u. Walther Peter, Jena 1942 (künftig AGBM II), Nr. 1198, 99.
44 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3194, Bl. 3r; ediert in AGBM I, Nr. 535, 384.
45 GERD BERGMANN, Eisenach in der frühbürgerlichen Revolution (= Eisenacher Schriften zur Heimatkunde 41), Eisenach 1989, 30–36.
46 Vgl. JOACHIM ROGGE, Der Beitrag des Predigers Jakob Strauss zur frühen Reformationsgeschichte, Berlin 1957, 37.
47 Vgl. ROGGE, Jakob Strauss (s. Anm. 46), 34–36; JOACHIM BAUER, Beitrag in diesem Band.
48 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3191, Bl. 52r.
49 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 5213, Bl. 44v.
50 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 5213, Bl. 54v; Bl. 145v; Bl. 192r; Bl. 208.
51 LATh-HStA Weimar, Rechnungen 3192, Bl. 103v.
52 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Bb 5213, Bl. 241v.
53 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 132, Bl. 1v.
54 Luther an Brück, Wittenberg 18. Oktober 1523 in: WA Br 3, 176–178.
55 FRANZ LAu/NIKOLAUS HAUSMANN, in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), 126.
56 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 126. Zum Wucherstreit vgl. REINHOLD JAUERNIG, D. Jakob Strauß, Eisenachs erster evangelischer Geistlicher, und der Zinswucherstreit in Eisenach, in: Mitteilungen des Eisenacher Geschichtsvereins, 4. Heft 1928, 30–47; ROGGE, Jakob Strauss (s. Anm. 46), 71–82; BERGMANN, Frühbürgerliche Revolution (s. Anm. 45), 20–26; BERGMANN, Ältere Geschichte (s. Anm. 7), 210–217; von JOACHIM BAUER, Beitrag in diesem Band.
57 Haüptstück. vnd || artickel christenlicher leer wider || den / vnchrystenlych wuech=||er / darumb etlych pfaf=||fen tzue Eyssenach so || gar vnrywig vnd || bemyet sint.||… Erfurt 1523 (VD16 S 9483).
58 Vgl. ROGGE, Jakob Strauss (s. Anm. 46), 75. Nach der Weimarer Kammerrechnung kommt hier nur ein Aufenthalt von Strauß Anfang September 1523 infrage, vgl. LAThHStA Weimar, Reg. Bb 5215, Bl. 208.
59 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 126, Bl. 13r–16v.
60 A. a. O., 13v–14v.
61 Vgl. a. a. O., Bl. 1r–4r.
62 A. a. O., 3v–4r.
63 LATh-HstA Weimar, EGA, Reg. Ll 195.
64 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 126, Bl. 5r–12v.
65 A. a. O., Bl 10r.; Strauß äußerte sich daraufhin in seiner 1524 in Erfurt gedruckten Schrift Das wucher zu nemen vnd geb.|| vnserm Christlichem glauben. vnd || br[ue]derlicher lieb … || entgegen yst / vnuberwintlich leer / vnnd ge=||schrifft. Jn dem auch die gemolet Euange=||listen erkennet werden.|| … D. Ja. Strausz Ecclesiastes || zu Jsennach.||, eine Reaktion des Herzogs darauf ist unbekannt. Der Prediger blieb allerdings im Amt und wird von Johann Anfang 1525 mit einer Visitation in der Eisenacher Gegend beauftragt, was darauf schließen lässt, dass Strauß durch seine Schrift nicht in Ungnade gefallen war.
66 LATh-HStA Weimar, EGA, Reg. Ii 126, Bl. 11v–12r.
67 Vgl. a. a. O., Bl. 10v- 11r.