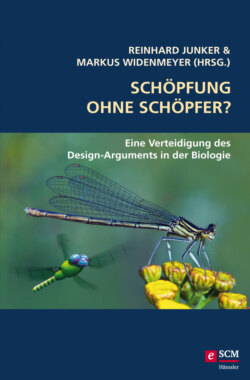Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Methodischer Rahmen und inhaltliche Fragestellungen der Naturwissenschaft Biologie Naturwissenschaft: Objektive Methoden in einem subjektiven Umfeld
ОглавлениеNaturwissenschaft stellt in ihrer idealen Form eine methodisch definierte und rational begründete Herangehensweise an die für den Menschen wahrnehmbare Natur dar. Naturwissenschaftler verfolgen damit das Ziel, über die Natur einschließlich den Menschen transsubjektiv gültige Aussagen bzw. Erkenntnisse zu formulieren. Diese Methode erscheint zudem auch unabhängig von der Weltanschauung oder subjektiven Vorlieben der Wissenschaftler weltweit reproduzierbar und damit überprüfbar.
Diese Charakterisierung ist jedoch nur eingeschränkt gültig und damit eine Idealisierung, denn Naturwissenschaftler arbeiten erstens in der Regel stillschweigend mit metaphysischen Voraussetzungen (siehe Kastentext). Zweitens wird in der Praxis des heutigen naturwissenschaftlichen Betriebes (reale institutionalisierte Form von Wissenschaft) darüber hinaus der naturwissenschaftliche Ansatz häufig verabsolutiert bzw. weltanschaulich aufgeladen, indem die Natur (als Gegenstand der Forschung) und auch ihre Geschichte als abgeschlossene Systeme betrachtet werden, welche ausschließlich auf Basis von Naturgesetzen und Randbedingungen (die beide als zu diesem System gehörend betrachtet werden) zu erklären sind. Dies wird häufig auch als der (angeblich nur methodische) Grundsatz formuliert „als ob es Gott nicht gäbe“ (bzw. als ob Gott nie am Anfang oder in die Natur hineingewirkt hätte und auch keine sonstigen nicht-physikalisch bedingten Wirkungen stattfinden könnten). In den darauf aufbauenden Gesamterklärungen wird also nur Gesetzes- und Beschreibungswissen akzeptiert, das auf regelmäßige Beobachtungen und kausale Zusammenhänge für die Ursachen-Wirkungs-Beziehungen zurückgreift und von daher – wenigstens theoretisch – eine (möglichst transsubjektive) empirische Überprüfbarkeit erlaubt.
Der naturwissenschaftliche Ansatz wird häufig verabsolutiert oder weltanschaulich aufgeladen, indem die Natur und ihre Geschichte als abgeschlossene Systeme betrachtet werden.
Dadurch sind alle nicht-natürlichen Erklärungsszenarien von vornherein vom Tisch. Denn im rein naturwissenschaftlichen Sprachspiel finden bestimmte Ausdrücke wie etwa „Schöpfer“, „Gott“, „Designer“ keine Anwendung und sind somit ohne Relevanz für eine naturwissenschaftliche Erklärung als solche. D. h., alles, was einer naturwissenschaftlichen Beschreibung aufgrund seines ontologischen* Status nicht zugänglich ist („beschreibungsunabhängige Existenz“, z. B.Gott, Ewigkeit, Engel, Teufel), soll weder als Erklärung noch als zu Erklärendes im rein naturwissenschaftlichen Sprachspiel genutzt werden (GUTMANN 2005). Es ist jedoch ein fataler Kurzschluss, diese Konvention und methodische Vorgabe als argumentative Grundlage ins Feld zu führen, um die Existenz oder eine Schöpfertätigkeit Gottes als wissenschaftlich widerlegt zu betrachten (siehe das o. g. Zitat von WUKETITS). Denn dies würde einen (unbegründeten und nicht begründbaren) radikalen Reduktionismus voraussetzen, nämlich dass alle Erklärungen naturwissenschaftliche Erklärungen sein müssen, bzw. dass alle Dinge letztlich physikalischer Art sind.
In der wechselseitigen Abhängigkeit von Wissenschaft und Weltbild liegt eine Gefahr des Missbrauchs des Wissenschaftsbegriffs oder der ungerechtfertigten Inanspruchnahme sogenannter „Wissenschaftlichkeit“. Wird z. B. unvermittelt im Namen der Wissenschaft davon gesprochen, dass nur das auf diesem Weg erlangte Wissen die alleinige Wirklichkeit repräsentieren kann, verwechselt man Weltanschauung mit wissenschaftlicher Rede (z. B. im Historischen und Dialektischen Marxismus von Karl Marx oder im neuen Atheismus bei Richard Dawkins und anderen). Jede spezielle (angebliche) Erkenntnismethode, die sich ihrer eigenen erkenntnistheoretischen Vorgaben, methodischen Grundlagen und Grenzen nicht mehr bewusst ist, hört auf, Erkenntnismethode zu sein. Sie wird zu einem weltanschaulichen Glaubenssystem und, wo sie mit einem ggf. aggressiv vertretenen Wahrheits- oder Geltungsanspruch auftritt, zu einer ideologischen Normative.
Die öffentliche Diskussion zu den Fragen von Schöpfung und Evolution wird häufig von zwei Fronten dominiert, polemisierenden Formen des neuen Atheismus und des politisierenden Kreationismus. Letzterer ist hierzulande jedoch nicht existent. In zahlreichen Publikationen von Vertretern beider Fronten lassen sich Erscheinungsformen und Endpunkte der o. g. Fehlentwicklungen gut belegen. Auf der Basis einer absolut gesetzten und allein richtigen „Wissenschaftlichkeit“ wird die eigene Position mit wissenschaftlichem Anspruch als ausschließliche und alles erklärende Sicht der Welt und des Menschen propagiert.
In der wechselseitigen Abhängigkeit von Wissenschaft und Weltbild liegt eine Gefahr des Missbrauchs des Wissenschaftsbegriffs.