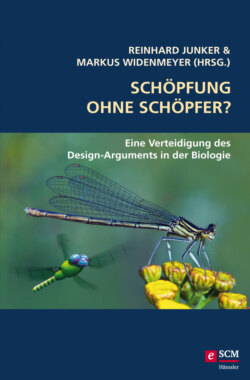Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Funktionalaussagen als teleologische Beschreibungen
ОглавлениеAufgrund der Zweckmäßigkeit, die wir bei Lebewesen und ihren Bestandteilen als Forschungsgegenstand der Biologie antreffen, besitzen auch biologische Beschreibungen eine besondere Qualität: Sie sind, anders als z. B. die Darstellung der Bewegungen von Elektronen, Funktionalaussagen mit teleologischem Charakter (wofür etwas gut oder nützlich ist). Dazu einige Beispiele: Die Reizauslösung und -übertragung funktioniert im Auge unter Einbeziehung biochemischer Reaktionskaskaden. Die Regulierung der Herzfrequenz erfolgt bei Belastung u. a. durch die körpereigene Analyse der Blutgase. Die Ausschüttung von Hormonen wird über periphere Rezeptoren gesteuert. In Mechanismen, welche Gene aktivieren oder inaktivieren, sind z. B. Masterkontrollgene eingebunden.
Die funktional-analytisch arbeitende Biologie erfolgt primär unabhängig und unbeeinflusst vom Wissen oder von Theorien über die Herkunft und Entstehung des Lebens.
Die Behandlung der Themenstellungen im Rahmen der funktional-analytisch arbeitenden Biologie erfolgt primär unabhängig und unbeeinflusst vom Wissen oder von Theorien über die Herkunft und Entstehung des Lebens. Dies gilt auch dann, wenn angeregt durch Ursprungshypothesen nach speziellen molekularbiologischen, physiologischen oder morphologischen Merkmalen der Organismen gesucht wird. Im Gegensatz zu den hier betrachteten funktional-analytisch ausgerichteten Beschreibungen, die zu 100% die gesamte moderne Medizin bestimmen, zeigen Ursprungstheorien wie die Evolutionstheorien eine grundsätzlich andere Begründungsstruktur und einen anders zu definierenden Forschungsgegenstand. Die Evolutionsbiologie ist wie jede Ursprungsforschung nur unter Rückgriff auf bereits „nicht-evolutionär“ erworbenes Wissen möglich und verfolgt auf dieser Basis dann den Anspruch, das heutige Erscheinungsbild der Organismen und den Charakter der Ökosysteme als Ergebnis einer natürlichen Entwicklung (Evolution) zu erklären (Abb. 2). Im Ergebnis entwirft sie Rekonstruktionen eines hypothetischen Entwicklungsverlaufes in erzählender Berichtsform (z. B.: „Aus A ist B entstanden, D und C leiten sich von Vorfahren ab, die B nahe standen“).
Abb. 2: Das Verständnis für die Funktion und den Aufbau des Auges (v. l.: Komplexauge, Linsenauge, Spiegelteleskopauge der Muschel Pecten) leistet die funktional analytische Biologie. Ihre Ergebnisse sind unabhängig davon, welche Entstehungstheorie man zugrunde legt. Erst das Wissen um Funktion und Aufbau der Augen bei verschiedenen Tieren ermöglicht es der Evolutionsbiologie, mögliche Entstehungsabfolgen zu rekonstruieren (Pfeile). Deshalb sind evolutionsbiologische Modellierungen letztendlich als ein nachgeordneter Typ wissen-schaftlicher Begründung zu bestimmen. Sie „… sind für die (in der Regel funktional orientierte) laborwissenschaftliche Praxis letztlich irrelevant“ (GUTMANN 2005). (Aus JUNKER & SCHERER 2013)
„Methodologisch von Bedeutung ist nun, dass die Evaluierung unserer Erzählung im Lichte genau jenes funktionalen und nomothetischen* Wissens stattfindet, das wir grundsätzlich auch ohne diesen Bericht in Geltung setzen können. Dies scheint die Evolutionstheorie als einen zwar methodologisch möglichen, aber letztendlich nachgeordneten Typ wissenschaftlicher Begründung zu bestimmen. Insofern wäre sie für die (in der Regel funktional orientierte) laborwissenschaftliche Praxis letztlich irrelevant“ (GUTMANN 2005, 263).