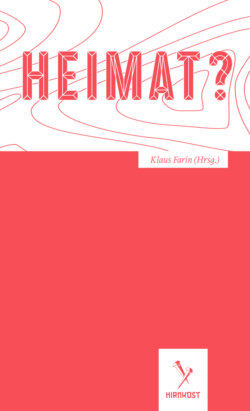Читать книгу Heimat? - Группа авторов - Страница 14
ОглавлениеHeimat ist ein Tomatenbrotschnittchen
von Isobel Markus
Ich sitze an meinem Schreibtisch und mein Blick fällt auf eine Postkarte an der Wand.
Heimat ist da, wo dein Laptop steht.
Ich blicke unentschieden auf meinen Laptop und denke an meine alten Heimaten. Mir fällt auf, dass der Plural in diesem Zusammenhang wohl eher unüblich ist. Heimat verlangt nach einem Singular. Heimat will monogam geliebt werden, mit Sehnsucht und exklusiv. Heimat, oh du mein einziger BFF.
Heimat ist ein schwieriger Begriff. Ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl, ein Geruch oder Geschmack oder eben alles zusammengenommen, ein sehr individueller Sehnsuchtsort? Ein Begriff zumindest, der bereits historisch missbraucht und derzeit wieder ideologisch aufgeladen ist.
Ich denke an die Spielplätze meiner Heimaten. Mir fallen eine Kiesgrube, ein Parkplatz und die Bahntrasse im Wald ein. Das war im Dorf meiner Kindheit, in dem mein liebster Freund ein paar Jahre später an der Bahntrasse starb. Ansonsten war das Dorf pittoresk mit roten Ziegeldächern und Jägerzäunen, die Vorgärten eher einrahmten als abschirmten. Ich erinnere mich an den Wind in den mannshohen Maisfeldern, an Straßen mit Kopfsteinpflaster oder wiederum an Bürgersteige, die so neu wirkten, als wäre noch nie jemand auf ihnen gelaufen. Einmal wurde in großen grünen Buchstaben PLO auf eine Straßenkreuzung gesprüht und die Gerüchteküche brodelte. Ich erinnere mich an die Straße, auf der ich mit nackten Füßen nach Hause lief, weil ich einmal meine Schuhe im Wald verloren hatte. Ich erinnere mich an das Gesicht meiner Mutter, als sie meine absonderliche Erklärung dazu hörte. Die Schuhe fanden wir nie wieder.
Heimat ist wahrscheinlich eine sehr fürsorgliche Geschichte.
Etwa, wenn man jetzt bei der Oma ins Haus kommt, wo es wie früher nach Holz, Honig und Klosterfrau Melissengeist riecht, man sofort wieder acht Jahre alt ist und auf die besten Bratkartoffeln der Welt wartet. Nur dass jetzt die Möbel geschrumpft wirken.
Heimat ist auch sehr intensiv, wenn sich jemand freut, dich wiederzusehen, und man spürt, dass man zu Hause ist. Oder wenn jemand sagt: „Fahr vorsichtig.“
Oder: „Bist du gut angekommen?“
Heimat ist, selbst im Dunkeln zu wissen, wo die Lichtschalter sind.
Ich denke an die Zeitabschnitte, an die mein heimatliches Gefühl gebunden war, an die Menschen und an mein Vertrauen. Mein unbedingtes Vertrauen.
Wir zogen aus dem Dorf weg und fortan häufig um, meine Eltern, meine Geschwister und ich. Nach meinem Auszug bei den Eltern machte ich das Umziehen dann zu meiner eigenen Gewohnheit. Es war mir wohl selbst ein Stück Heimat geworden, spätestens alle zwei bis drei Jahre die Bleibe zu wechseln. Und es gab immer einen guten Grund, weiterzuziehen, wobei das Wort weiter ja womöglich ein Ziel implizieren könnte, und das hatte ich nicht. Kein endgültiges zumindest. Ich wollte neu anfangen. Egal wie. Allein oder zu zweit mit meinem Freund. Zu zweit wollten er und ich nach Neuseeland auswandern, da waren wir etwa Anfang 20. Es war alles vorbereitet. Das Visum, die Arbeitserlaubnis, wir waren bereit. Aber dann wog bei ihm die alte Heimat doch plötzlich schwerer als meine Sehnsucht nach einem Neubeginn. Und damals war er meine Heimat.
Ich überlege, ob mein Umherziehen all die Jahre auch an den vielen Fluchterlebnissen in der Geschichte meiner Familie liegen könnte. Viel wurde davon erzählt. Flucht war ein großes Thema in unserer Familie. Man hatte alles zurücklassen müssen, nicht weil man sich wie ich freiwillig dazu entschied, sich voller Enthusiasmus auf zu neuen Ufern zu machen, sondern weil man vor Angst dazu gezwungen worden war, sein Leben und das seiner Lieben zu retten. Der Krieg machte meine Familie heimatlos. So lässt sich Heimat von vielen Seiten betrachten. Von der schmerzhaften Seite, die den Verlust beinhaltet oder der anderen, die geborgen heimatliche Gefühle hervorbringt.
Allerdings war mir Heimattümelndes stets unangenehm. Und damit meine ich weniger Bierzelte voller Lederhosen und Dirndl, Schlagerabende mit Betten in Kornfeldern oder schunkelnde Volksmusiksendungen. Mit diesen hatte ich keine Berührungspunkte.
Mir fielen eher Erlebnisse unangenehm auf, die, wie ich verwundert feststellte, andere in meinem Alter offenbar als angenehm empfanden.
Dazu gehörte der Postbote, der nach ein paar Tagen meinen Nachnamen kannte und daher genau wusste, dass ich vor allem Mahnungen erhielt. Ebenso wie die Frau auf ihrem Mickymaus-Kopfkissen am Fenster ganz unten, die kein Kommen oder Gehen unkommentiert ließ. Unangenehm, wenn mein Kommen unverhohlen erst morgens um sechs stattfand. An anderen Morgen traf man immer dieselben Gesichter in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die mir nach ein paar Monaten grüßend zunickten oder, fast noch schlimmer, der Chef der Pizzeria, der neben seinen Stammgästen bald auch uns mit Handschlag begrüßen wollte. Der Grad zwischen Fürsorglichkeit auf der einen und Neugier und Kontrolle auf der anderen Seite erschien mir schmal. Heimattümelndes raubte mir das Gefühl, mich unbeobachtet zu wähnen. Wir gingen also woanders essen, ich nahm eine Bahn früher oder später oder wir zogen bald wieder um.
Merkwürdigerweise fühlten sich andere in diesem nachbarschaftlichen Verhältnis wohl. Sie genossen den Plausch beim Milchholen und empfanden den Kiez als heimelig. Ich dagegen wählte andere Wege, sobald sich heimatlich klebrige Gefühle einzustellen drohten.
Es war kein Zwang, bloß eine heimatliche Unverträglichkeit vielleicht. Eine Unverträglichkeit, die bei Nichtbeachtung in mir ein Gefühl auslöste, vor dem ich mich lieber in Acht nahm. Das Gefühl, als ich Freunde in ihrem neuen Reihenhaus in einer Vorstadtsiedlung besuchte. Sie waren glücklich, man sah es ihnen an. Sie strahlten und ich wusste, dass sie genau das, was sie immer suchten, endlich gefunden hatten: einen heimatlichen Ort in der zu großen Stadt. Ich freute mich für sie mit. Ich konnte gar nicht anders. Aber ich verabschiedete mich nach ein paar Stunden unter einem Vorwand und bekämpfte das beklemmende Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, mit schnellem Schritt zurück in die Stadt.
Heimat war für mich etwas anderes. Kein Ort, vielmehr ein Wir – mein Freund, meine Freunde, meine Familie und ich. Wir waren ein Zelt, das ich überall aufschlagen konnte. Es bot mir ortsunabhängig Schutz und verschaffte mir ein warmes Gefühl. Ich blickte selten mit einem wehmütigen Auge auf die alte Heimat. Ich freute mich auf das, was mich erwartete. Immer wieder.
Als dann die Kinder kamen, wusste ich erstaunlicherweise mit unserem allerersten Blick aufeinander, dass sich etwas ändern würde. Nach einer Weile bemerkte ich überrascht, dass ich sesshafter wurde und mich verortete. An den Ort, an dem die Kinder und mein Freund lebten, gehörte jetzt merkwürdigerweise auch ich. Plötzlich war es schön, wenn die neue Erzieherin sofort die Namen meiner Kinder kannte, und ich mochte es sogar, wenn uns der Mann am Gemüsestand „Schönen Tag“ hinterherrief, nachdem er jedem Kind einen Pfirsich in die Hand gedrückt hatte.
Und ich? Ich fand es nett. Irgendwie freundlich. Kaum mehr peinlich. Sogar rührend fürsorglich.
Vielleicht entsprach es einem sicheren Gefühl, das ich den Kindern bieten wollte. Wir schufen uns ein sicheres, heimatliches Gefühl, das an unseren Wohnort geknüpft war. Die Kita und später die Schule verstärkten das Phänomen und ließen mich meine üblichen Reflexe von Flucht vergessen. Der Ort mit den Kindern bot beiderseitige Geborgenheit, die ich warm spürte, wenn sie Mama riefen, mit verschmierten Gesichtern auf mich zuliefen und ihre klebrigen Finger an meinem Hosenbein abwischten. Ein Gefühl, das ein Vertrauen voraussetzte, und das im Kollektiv.
Inzwischen sind meine Kinder groß. Sie gehen mehr und mehr ihre eigenen Wege. Ich begrüße das und doch bemerke ich, wie wehmütig ich manchmal auf uns und unser kuscheliges Heimatgefühl zurückblicke.
Trotzdem musste ich neulich feststellen, dass sich bei mir erneut etwas verändert. Als die Verkäuferin beim Bäcker fragte, ob ich Laugenstangen wie immer wolle, sah ich mich kurz darauf verstohlen um, ob von dieser Stammkundschaftsszene jemand Zeuge geworden war.
Meine heimatliche Unverträglichkeit beginnt also wieder.
Vielleicht ist Heimat also kein Ort, sondern an Zeiten, Personen und Geschichten geknüpft. Es sind Menschen, die einem das Gefühl geben, man wäre zu Hause in der Heimat.
Meine Familie, meine Freunde und die gemeinsam erlebten Geschichten bieten mir ein heimatliches Gefühl, das nicht notwendigerweise an einen Ort gebunden ist, außer dem des vertrauten gemeinsamen Beisammenseins. Wir stellen wenig grundsätzliche Fragen oder uns in Frage, denn wir setzen uns heimatlich, nicht selten kritiklos, voraus.
Ich schaue auf die Postkarte.
Heimat ist da, wo dein Laptop steht.
Ein Freund ruft an. Ich frage recht unvermittelt:
„Was bedeutet Heimat eigentlich für dich?“
„Deine Tomatenbrotschnittchen. Die rühren mich zu Tränen“, sagt er.