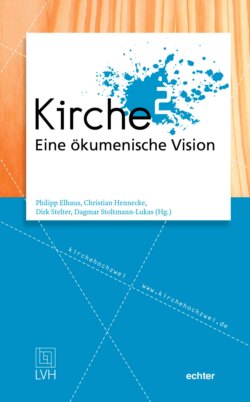Читать книгу Kirche - Группа авторов - Страница 68
Glauben, oder: Vom Unterschied zwischen Teebeuteln und Piranhas1 I) Glauben – und die Schwierigkeiten seiner Thematisierung in der Verkirchlichungsfalle
ОглавлениеAls Autor oder als Redner kann man sich nur freuen, wenn man um Gedanken zum Grundvollzug des Glaubens gebeten wird. Vielleicht ist die Auskunft darüber, was der andere glaubt, sogar die wichtigste und für mich weiterführendste Information, die er (oder sie) mir geben kann. Und das aus drei Gründen.
1. Glauben ist das, ohne das es gar keine Freude gibt.
2. Glauben ist das ökumenischste Thema, das es geben kann.
3. Eine bestimmte Rede vom ‚Glauben‘ ist innerkirchlich ziemlich verdorben.
1) Glauben ist das, ohne das es gar keine Freude gibt. Wer über das Substantiv ‚Glauben‘ oder über das Verb ‚glauben‘ spricht, spricht aus theologischer, aber auch aus soziologischer Perspektive über die erstaunliche Kraft, sich zu Leuten, Dingen und Situationen in unserem Leben gestaltend zu verhalten. Glaube ist der kreative Möglichkeitssinn, der tatsächlich in uns möglich ist. Ich sehe eine Person – und plötzlich halte ich es für möglich, dass zwischen ihr und mir etwas entstehen kann: eine Debatte, ein Streit, ein Tausch, ein Flirt, ein Tanz, ein Diebstahl. Ich sehe eine Situation – und plötzlich halte ich es für möglich, dass ich ihr nicht ausgeliefert bin, sondern dass ich sie auf mich und mich auf sie beziehen kann. Ja: Ich sehe einen Teebeutel – und plötzlich halte ich es für möglich, dass dieser Teebeutel mehr sein kann und mehr sein will als ein paar Krümel in Vliespapier. Ich sehe mein Spiegelbild – und plötzlich halte ich es für möglich, dass dieses Spiegelbild mir zuzwinkert und mich auffordert: Alter, sei dein eigener Piranha: Greif dir diesen Tag und lass ihn nicht mehr los!
Das ist Glauben: Ich stelle mich der Tatsache, dass über mich das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, solange ich selber mitsprechen kann. Glauben ist die DNA dessen, was wir ‚Seele‘ nennen;2 Glaube ist das seltsame Phänomen, mehr sein zu wollen als Krümel in Vliespapier. Karl Rahner sagt: Glaube ist „die Ausdrücklichkeit des Sichstellens gegenüber dem Geheimnis.“3 Glaube ist also der Ernstfall des Lebens, ohne den es nur noch Ernstfälle gäbe.
2) Glauben ist damit das ökumenischste Thema, das es geben kann. Man merkt schon: Ich will hier über den Akt des Glaubens an sich nachdenken, und erst sehr viel später über die religiöse Artikulation des Glaubens, und noch viel später über die konfessionelle, die katholische, evangelische, anglikanische oder orthodoxe Artikulation. Über Glauben kann ich mit jeder und jedem sprechen. Die wirklich aufregende Frage lautet: Wie schaffst du das eigentlich, dich jeden Morgen dieser Welt zu stellen? Wie schaffst genau du es, „ausdrücklich gegenüber dem Geheimnis zu sein“, wie Rahner das nennt? Welche Wege hast du gefunden, mit dir selber klar- und durchzukommen? Man kann die Frage in Erinnerung an den kölnischen Karneval auch anders stellen: Jeder Jeck is anders – aber was für ein Jeck bist du? Und wieso? Kurz: Welcher Glaube bestimmt dein Leben?
3) Eine so formatierte Rede vom ‚Glauben‘ ist innerkirchlich ziemlich verdorben. Und weil wir in unserem Kongresszusammenhang ja über Kirchenformen der Zukunft nachdenken, muss das zur Sprache kommen. Ich meine: Wir sind als Kirchenleute in der Gefahr, diesen Existenzakt des Glaubens zu kleinformatig anzusetzen. Wir haben den Glauben verkirchlicht. Wir haben aus ihm zunächst eine religiöse, dann eine religiös-moralische und dann sogar eine religiös-moralisch-konfessionelle Veranstaltung gemacht. Der Begriff der ‚Verkirchlichung‘ stammt von dem bekannten Soziologen Franz-Xaver Kaufmann. Er analysiert schon in den späten 1970er Jahren, dass der Katholizismus der bürgerlichen Gesellschaften Europas im Zuge der funktionalen Differenzierung eine Zentralisierung und Bürokratisierung des Glaubens vollzieht, deren Umfang kirchengeschichtlich als erst- und einmalig gelten kann. Die damals geäußerte These lautet: „Wir können abkürzend sagen, dass das Christentum (…) sich in dem Sinne verkirchlicht, dass das Christliche zunehmend nur noch mit dem explizit Religiösen und das Religiöse mit den etablierten Kirchen und religiösen Gemeinschaften identifiziert wird, diese selbst jedoch zunehmend den Charakter religiöser Organisationen annehmen, deren Eigendynamik mit den Möglichkeiten individuellen Glaubens nur noch sporadisch zur Deckung zu bringen ist.“4 Das operative Instrumentarium dieser Verkirchlichung ist von Franz-Xaver Kaufmann und Karl Gabriel oft benannt und tiefgehend analysiert worden: Ultramontanismus als ideologische Matrix; Sakralisierung der Kirchenstrukturen, v. a. des Priestertums; Gleichschaltung von Hoch- und Volksreligion; papstzentrierte Frömmigkeit; romzentrierte weltkirchliche Bürokratisierung; Spezialisierung des kirchlichen Personals auf liturgische und seelsorgliche Funktionen; verfestigter Ständedualismus aus Klerikern und Laien; katechetisch verengte Bildungsoffensiven; Zuspitzung des konfessionellen Konflikts usw. Die kirchenhistorische Analyse kann zwar zeigen, dass diese Strategie der konfessionellen Milieubildung für den deutschen Katholizismus im bismarckschen Kulturkampf und in der Minoritätsposition des Deutschen Kaiserreiches überlebensrettend war. Trotzdem wurden hier Pfadabhängigkeiten und Sozialisationsroutinen verfestigt, die unzureichend sind für eine wirksame kulturelle Präsenz in offenen, pluralen und weltanschaulich neutralen Gesellschaften.
Was bedeutet ‚Verkirchlichung des Christseins‘? Kürzer und in populärer Anschaulichkeit gefasst: Wir denken doch tatsächlich, wir könnten die Intensität von Glauben gleichsetzen mit der Intensität von sonntäglichen Gottesdienstbesuchen. Wir denken, in der Bibel zu lesen und davon eindrücklich zu reden, wäre bereits ein Glaubenszeugnis. Wir denken, dass man jemanden zum Glauben bringen müsse, wenn er offensichtlich einem bestimmten Wertekodex nicht folgt. Die sogenannte Glaubenskrise der Deutschen lesen wir an der Tatsache ab, dass die Zeitungen schlecht über uns schreiben. Ja, es geht sogar so weit, dass wir scheinbar persönlich beleidigt sind und neurotisch werden, wenn man um uns herum nicht glaubt. Karl Rahner schreibt schon 1962: Die Kirche spielt zu oft „die Rolle einer kleinbürgerlich nörgelnden Gouvernante (…), [die, MS] mit engem Herzen (…) das Leben mit dem Beichtspiegel zu reglementieren versucht, der recht ist für das berühmte Lieschen Müller in der wohltemperierten Kleinstadt des 19. Jahrhunderts.“5 Wenn man erst über Kirche und erst dann über das Christsein spricht; wenn nicht Christsein zur Kirche, sondern Kirchlichkeit zum Christsein führen soll; wenn Christsein auf einen bestimmten rituellen, ethischen und kulturellen Habitus verengt wird, dann ist man in der Verkirchlichungsfalle.
Und hier liegt meiner Meinung nach einer der wesentlichen Gründe dafür, dass unsere Zeitgenossen uns Kirchenleute gerade nicht als Tänzer im Regen erleben, sondern als Verkäufer von Regenschirmen. Wir stehen unter dem sicheren Schirm und nennen das ‚Gemeinde‘. Gemeinde wird damit der Ort, an dem man nicht nass wird; man ist ‚drinnen‘ und schaut nach ‚draußen‘, und man wundert sich, warum die Regenläufer da draußen nicht unter den sicheren Schirm kommen: Es ist doch so viel trockener hier!6
Ja, es ist trocken bei uns. Mitunter staubtrocken. So sagen es jedenfalls die Milieustudien zu Kirche und Religiosität, die uns in vorher nicht möglicher Weise die Außenblicke auf uns aufbereiten und plausibel machen.7 Nur ein Zitat aus dem Forschungsprozess, das ich herausgreifen möchte. In einem Interview sagte uns jemand: „Ich erlebe euch als einen Hafen, dem die Ankerkette am Pier lieber ist als die Segel meines Bootes.“ Ich erlebe euch als Kerzenschein, nicht so als Taschenlampe.