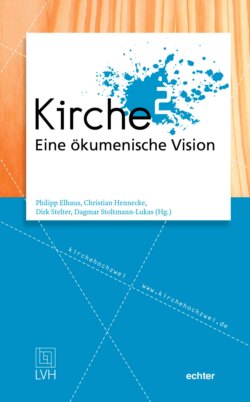Читать книгу Kirche - Группа авторов - Страница 69
II) Glauben und Evangelium
ОглавлениеErlauben wir uns, uns dem ‚Glauben‘ fundamentaler zu nähern. Hierzu zwei Gedankengänge, die plausibel machen können, warum der Ferrari unserer Glaubenszeugnisse nicht auf vollen 16 Zylindern läuft, sondern vielleicht auf dreien.
1. Das Evangelium ist kein Besitz der Kirchen, sondern die große These Gottes an die Welt.
2. Jesus hat primär keinen Glauben gebracht, sondern den schon vorhandenen genutzt.
Der Gedankengang will betonen: Der Glaube, von dem Jesus gesprochen hat, schafft keine Heimat. Mindestens begründet er keinen Anspruch darauf. Wer sich beheimaten will, soll eine Familie gründen, sich ein Haus bauen, einem Sportverein beitreten oder segeln lernen. All das ist wichtig, unverzichtbar und oft sehr großherzig. Aber all das hat eher wenig mit Kirche zu tun.
1) Das Evangelium ist kein Besitz der Kirchen: Der französische Jesuit Christoph Theobald hat jüngst darstellen können, dass man das griechische Wort euaggelion nicht nur übersetzen kann mit: ‚die gute Botschaft‘. Sondern auch mit: die Botschaft vom Guten.8 Man kann sich ja mit Recht fragen: Was ist denn überhaupt das, was mich da froh machen soll, wenn ich das Evangelium höre? Was sollen denn diese uralten Geschichten mit mir heute zu tun haben? Die Antwort lautet: Mit dem Evangelium steht eine Person im historischen Raum, die eine eigentlich spektakuläre These vertreten hat: Es gibt das Gute. Gemeint ist Jesus von Nazareth, und der meint mit ‚das Gute‘ ‚den Guten‘, nämlich seinen himmlischen Vater. Aber dies ist in einem ganz bestimmten Sinn zweitrangig. Fundamental behaupten Christen: Man kann in dieser Welt Gutes erleben. Ja: Man kann selber Ursprung und Grund von Gutem werden. Man kann sich ausdrücklich seinem Geheimnis stellen, weil es eine Kraft des Guten gibt, die wirkt.
Wie spektakulär so eine Behauptung ist, muss nicht lange illustriert werden. Für den, der nicht ausweicht, bringt jeder Tag bedrückend viele Gegenargumente zur Behauptung des Guten. Das ist vielleicht die neue Qualität der medialen Möglichkeiten, die wir heute haben. Auch früher gab es viel Schlechtes, Mieses und Erschreckendes – aber heute könnte man es sich pausenlos ansehen. Wir erleben uns viel öfter als Leute, die wegsehen und die sich dabei zusehen, wie sie wegsehen. Wir könnten sonst unser bisschen Psychohygiene gar nicht aufrechterhalten. Viele wissen von sich, wie dünn die Maske des Netten und Ruhigen wird, wenn es um diese psychohygienische Selbsterhaltung geht.
Wichtig ist nun: Das Evangelium behauptet nicht, dass die Welt irgendwie gut ist. Auch nicht, dass man in dieser Welt irgendwie zu Gott kommen muss, wenn man nur genug an sich arbeitet oder ausreichend nachdenkt. Unsere moderne Theologie hat diesen Kelch tief ausgetrunken und sagt uns: In dieser Welt spricht nichts dafür, dass es Gott geben muss. Wenn man so will, ist diese Welt ein Haufen Krümel ohne Vliespapier. Ein Stern im All, dessen Bewohner maßlos überschätzt werden. Asche von gestern, Asche von morgen. Christliche Theologien, so schreibt es der Kölner Theologe Hans-Joachim Höhn, sind keine Weltentstehungs- oder Welterklärungstheorien. Es gibt hier nichts zu erklären. Es sind Weltakzeptanztheorien. Sie bieten Argumente, das Mögliche für mindestens genauso wirksam zu halten wie das Faktische. Das scheint nicht viel zu sein. Aber es ändert alles. Es ist der Unterschied zwischen Zynismus, Skeptizismus, Fatalismus, Resignation – die alle als Lebenshaltungen hochverständlich sind – und dem Glauben, dass es Gutes geben kann.9
2) Jesus hat primär keinen Glauben gebracht, sondern den schon vorhandenen genutzt.
Jesus war selbst so ein Glaubender. Theobald arbeitet heraus, wie faszinierend vor allem die Zufallsbekanntschaften Jesu sind10 – also die Menschen, die er einfach so auf seinen Wegen trifft: die blutflüssige Frau, den Bettler Batimäus, den Hauptmann von Kafarnaum, den Jungen mit den fünf Broten und zwei Fischen, die syrophönizische Frau. All diese Zufallsbekanntschaften zeigen eine uns innerkirchlich unbekannt gewordene Gestalt: den staunenden Jesus. Jesus staunt über den robusten Lebensglauben dieser Leute: die blutflüssige Frau, die ihn einfach berührt; Batimäus, der seinen Mantel wegwirft – bevor er geheilt wurde!; den Hauptmann, der ihn nicht mal drängt, seinen kranken Sohn zuhause zu besuchen; den Jungen, der wenig hat, aber alles gibt; die Syrerin in ihrer entwaffnenden Schlagfertigkeit. Jesus ruft aus: Solch einen Glauben habe ich in Israel nirgends gesehen! Und, spektakulär: Frau, Mann, Junge: Dein Glaube hat dir geholfen!
Das ist Evangelium: Nicht ich, Jesus, habe dir geholfen. Sondern du hast dir selber geholfen, weil du geglaubt hast. Natürlich war Jesus in diesen Episoden unersetzlich. Aber dem Textzeugnis nach nicht als kausal Heilender, sondern als der, der als Erster und als Mutigster gegen jeden Aberglauben geglaubt hat, dass jener Glaube helfen wird, der schon da ist.
Was für ein Bild für Kirche! Kirche nicht als die, die alles in der Hand haben. Die wissen, ob einer richtig glaubt oder falsch. Die sich anmaßt, den richtigen Glauben zu kennen und vorzuschreiben. Sondern als Kirche, die wie Jesus staunt über das, was an Glauben und an Lebensleistung schon da ist. Die gegen jeden Aberglauben glaubt, dass der Glaube der Leute die heilende Kraft selber ist. Ja, Kirche als staunende Versammlung derer, die sich selber heilen lässt durch den Lebensglauben der Leute.
Darum sind solche Orte so wichtig wie e/motion aus Essen.11 Und darum sind solche Studien so wichtig wie die Milieustudien. Weil wir hier Lernmaterial bekommen. Weil hier gestaunt werden kann.
Lassen wir uns doch diese lernende, staunende, diese fundamental existenzielle Kirche nicht vermiesen. Kirche ist kein Idyll, sondern ein Biwak. Und Biwaks haben keine Fußbodenheizungen. Eine Umfrage hat 2006 ergeben, dass jeder zweite deutsche Katholik fünf und mehr beste Freunde in der Kirchengemeinde hat.12 Ich finde das irritierend, wenn Ferraris in der Garage stehen. Mich irritiert das, wenn Leute von ihrer ‚schönen Gemeinde‘ erzählen, in der sie sich jetzt schon 25 Jahre so sehr beheimatet fühlen. Welchen Sinn haben Streichhölzer, die in ihrer Schachtel in Frieden zusammen alt werden?
Unruhig schlägt unser Herz, bis es Ruhe findet in dir? Oh nein: Unruhig ist unser Herz, seit es Dir, der spektakulären Möglichkeit des Guten, begegnet ist – und seitdem rennen wir hier herum und fürchten den Regen und die Nacht, aber wir rennen weiter. Kirche ist das, was dort erst entsteht, wo der je individuelle und sehr variantenreiche Glaube an das Gute einen Ort bekommt, an dem er geteilt, beglaubigt und gefeiert wird. Natürlich ist Kirche auch der Ort, an dem man Jesus dafür dankt, dass er uns diesen Glauben vorgemacht hat, so dass wir alle an ihm kondensieren wie Wassertropfen an der Fensterscheibe. Natürlich ist Kirche auch der Ort, an dem der Glaube an das Gute an Gott adressiert wird. Natürlich ist Kirche auch der Ort, den es schon gibt, weil dieser Grundglaube an das Gute vom Hören kommt.
Aber damit er vom Hören kommen kann, muss es Leute geben, die vom Glauben erzählen. Und die das nicht sofort religiös und kirchlich machen, sondern die in der Lage sind, in ihrem alltäglichen Leben den Punkt zu identifizieren, an dem sie sich für das Gute und gegen das Müde, Lahme und Zynische entscheiden.
Werden wir solche Leute! Bilden wir solche Orte von Kirche! Versprechen wir uns, dass unsere Regenschirme nach längstens 30 Minuten porös werden! Gönnen wir den Deutschen Orte, an denen es wahrscheinlicher wird, an das Gute zu glauben. Seien wir Christen, über die Jesus staunt. Und über die er ausruft: Wahrlich, wahrlich – die sehen zwar aus wie Teebeutel – aber es sind echte Piranhas!
1 Kurzvortrag auf dem Kongress Kirche2, Hannover 2013. Der Vortragsstil wurde einer Publikation angepasst, im Duktus aber beibehalten.
2 Ähnlich Sellmann, Matthias: Art. Seelsorge/Pastoral, in: Georg Gänswein / Martin Lohmann (Hg.), Katholisch. Wissen aus erster Hand, Freiburg i. B. 2010, 98–100.
3 Rahner, Karl: Über die Möglichkeit des Glaubens heute, in: Gert Otto (Hg.), Glauben heute (II). Ein Lesebuch zur katholischen Theologie der Gegenwart, Hamburg 1968, 11–36, 18.
4 Kaufmann, Franz-Xaver: Kirche begreifen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, Freiburg i. B. u. a. 1979, 102 f.
5 Rahner, Über die Möglichkeiten des Glaubens heute, 30.
6 Eine ausführliche theologische Kritik der ‚Gemeindetheologie‘ und praxeologische Zukunftsausblicke liefert jetzt Sellmann, Matthias (Hg.), Gemeinde ohne Zukunft? Theologische Debatte und praktische Modelle, Freiburg i. B. u. a. 2013. Nur eine Zahl aus einer deutsch-US-amerikanischen Gemeindeumfrage von 2006: 67 % der deutschen Katholiken haben „5 und mehr engste Freunde“ in der Ortsgemeinde (Vergleich USA: 25 %)!
7 Vgl. auch den Beitrag von Heinzpeter Hempelmann in diesem Band.
8 Vgl. zum Folgenden Theobald, Christoph: Heute ist der günstige Augenblick. Eine theologische Diagnose der Gegenwart, und: Evangelium und Kirche, in: Hadwig Müller / Reinhard Feiter (Hg.), Frei geben. Pastoraltheologische Impulse aus Frankreich, Ostfildern 2012, 81–109. 110–138. Soziologisch ist unter Bezug auf die Rede vom ‚Guten‘ zu erinnern an Peter L. Bergers bahnbrechende Studie: Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz, Freiburg i. B. u. a. 21991, v. a. 84–89.
9 Vgl. Höhn, Hans-Joachim: Zustimmen. Der zwiespältige Grund des Daseins, Würzburg 2001; ders.: Der fremde Gott. Glaube in postsäkularer Kultur, Würzburg 2008.
10 Vgl. a. a. O., 104–106.
11 Vgl. den Beitrag von Christina Brudereck in diesem Band.
12 Vgl. Anm. 6. Zum auffällig deutlich koinonial geprägten Zuschnitt deutscher Gemeinden die Umfragedaten und kritischen Analysen in Reinhold, Kai / Sellmann, Matthias (Hg.): Katholische Kirche und Gemeindeleben in den USA und in Deutschland. Überraschende Ergebnisse einer ländervergleichenden Umfrage, Münster 2011; v. a. 79–84, 189–212. Tabelle A 110.