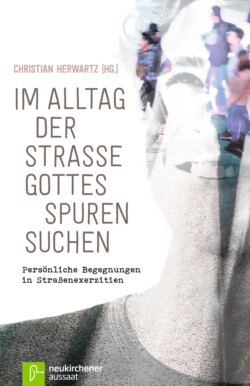Читать книгу Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alles hat einen Anfang:
Die Entstehung der Straßenexerzitien
ОглавлениеIn Hamburg wurden Anfang Mai 2000 die Teilnehmer_innen eines Treffens von Exerzitienbegleiter_innen mit der 3500 Jahre alten Erzählung vom brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch für einige Stunden auf die Straße geschickt. Diese Geschichte sollte ihnen eine Hilfe sein, in überraschenden Situationen ähnlich wie Mose (Exodus 3,2f) neugierig zu werden und sich ihrem Dornbusch respektvoll zu nähern. Am Abend erzählten sie in kleinen Runden, wie sie sich auf diese Begegnung an sehr unterschiedlichen Orten einlassen konnten. Sie führten uns Zuhörende vor ein Gefängnis, ein Flüchtlingsschiff und auf eine Bahnhofstreppe, wo jemand zusammen mit obdachlosen Menschen ein Bier trank. Der Teilnehmer Hans S. erzählte Jahre später von diesen Stunden:
„(…) In Hamburg hatte ich einen Tag mit wirklich überraschenden Erlebnissen und Begegnungen. Ich will hier und jetzt nur von der letzten und beeindruckenden Begegnung berichten: Gegen Ende des Tages verspürte ich einen großen Hunger und Sehnsucht nach der ersten Maisonne vor dem Bahnhof. Mit einem Döner und einer Dose Bier gewappnet, suchte ich draußen einen Sitzplatz an der Sonne. (...) Ich aß meinen Döner und trank genüsslich mein Bier. Da löste sich plötzlich aus der Gruppe der ‚Penner und Säufer‘ gegenüber ein noch junger Mann, kam zu mir und fragte: ‚Darf ich mich dazusetzen?‘ – ‚Ja natürlich, bitte!‘ Und dann erzählte mir Dieter, wie er sich mir vorstellte, unvermittelt und ohne weitere Umstände sein Leben: Wie er vor Jahren aus der sogenannten bürgerlichen Welt ausgestiegen sei, fast die ganze Welt bereist habe – über Afrika und Indien bis ins Hochgebirge in Tibet! Irgendwann sei er dann ans Rauschgift gekommen und süchtig und abhängig geworden und habe sich mit Aids infiziert. Seit fast zehn Jahren habe er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, die ihn sozusagen für tot erklärt habe.
Vor einigen Tagen habe er von den Ärzten die Nachricht erhalten, dass er höchstens noch drei Monate zu leben habe. Und dann kam er zum Kern seines Anliegens: ‚Schau‘, sagte er und wies auf die Gruppe, aus der er herausgetreten war, ‚das sind meine einzigen Freunde, die ich noch auf der Welt habe. Und das ist gut so, dass ich wenigstens sie habe. Aber: Wenn ich in einigen Wochen tot bin, dann wissen auch diese Kumpels nach drei, vier Tagen nicht mehr, dass es mich je gegeben hat. Kein Mensch auf der Welt denkt dann noch an mich! Ich habe doch auch hier auf dieser Erde gelebt. Es muss doch wenigstens einen geben, der um mich weiß, mit meinen Lebensträumen und Hoffnungen. Ich bin doch ein Mensch!‘
Schwer atmend zeigt er mir dann seinen spindeldürren Arm mit vielen silbernen Armreifen und fuhr fort: ‚Wenn ich dir einen dieser Reifen gebe, versprichst du mir, ihn in Erinnerung an mich zu tragen? Ihn eben nicht nur mit in deine andere Welt mitzunehmen, in die Nachttischlade zu legen und vielleicht zufällig einmal im Jahr eine Erinnerung an diesen Tag und einen der Penner in Hamburg zu haben?‘
Nun war ich derjenige, der mit großem Herzklopfen und schwer atmend neben diesem Menschen mit seiner riesigen Bedrängnis saß! In solch einer mir bisher nie begegneten Not konnte ich doch um Himmels willen nicht Nein sagen! Aber, so ging es mir rasend schnell durch den Kopf: Was werden meine Gemeindemitglieder denken, wenn ich als Priester auf einmal mit einem solchen Armreif auftauche, der ja nicht zu übersehen ist, den man auch am Altar und bei Spendung anderer Sakramente sieht? In diese Denkpause hinein fragte der Mann: ‚Was überlegst du so lange?‘ Willst du nicht? Ich erzählte ihm, wer ich sei und welche Fragen mir durch den Kopf gingen, und bat ihn, mir noch einen Augenblick Zeit zu lassen. ‚Denn‘, so sagte ‚ich, ich möchte dich nicht belügen. Wenn ich Ja sage, dann soll es auch ein wirkliches Ja sein, auf das du dich verlassen kannst‘. Und dann nach einer längeren Denkpause sagte ich: ‚Ja!‘
Geradezu andächtig löste Dieter einen seiner Armreife und befestigte ihn an meinem rechten Arm – und hier ist er immer noch. Spontan nahm mich dann der mir eben noch völlig unbekannte Mensch aus einer mir fremden und völlig anderen Welt in seine Arme, drückte mich, so fest er todkrank konnte, und sagte: ‚Jetzt habe ich wieder einen Bruder!‘
Beide tief bewegt hielten wir uns eine gute Zeit so umarmt. Wieder nebeneinander sitzend fragte ich dann diesen Bruder Dieter: ‚Wie bist du eigentlich darauf gekommen, gerade mich anzusprechen?‘
Seine Antwort: ‚Du bist seit Langem der Erste aus der anderen Welt, der uns Penner mit guten Augen angesehen hat.‘
Der Schreck fuhr mir in die Glieder: Welch ein Glück für mich und diesen Menschen, dass wir so gut geistlich vorbereitet in diesen Tag gegangen waren! Nicht auszudenken, wenn ich an diesem Tag ‚schlechte‘ Augen gehabt hätte – wie an so vielen anderen Tagen des Jahres.“
Wir haben Hans gefragt, wie seine ersten Straßenexerzitien im Jahr 2000 heute, fünfzehn Jahre später, nachwirken. Er schreibt:
„Zu Ostern 2000 war ich in einem Gottesdienst, in dem der Prediger fragte: Können wir heute noch dem Auferstandenen mitten im Leben begegnen? Kurze Zeit danach war ich in Hamburg beim oben genannten Treffen der Exerzitienbegleiter_innen. Unser Thema war: Wie können wir Tage der Besinnung so gestalten, dass die Teilnehmenden nicht nach kurzer Zeit erleben müssen: Es waren erholsame Tage, aber was mache ich im Alltag meines Lebens damit, ohne gleich wieder ‚abzustürzen‘? Und dann kam das Angebot für mich: Wir suchen einmal einen Tag lang den Auferstandenen am Hamburger Hauptbahnhof. Und ich habe dabei wahrhaftig den Auferstandenen in ‚Galiläa‘ erlebt; denn die Engel hatten den Frauen am leeren Grab verheißen: Geht nach Galiläa, eurer Heimat, eurem Zuhause, dort werdet ihr ihn finden!
Seit diesem Tag in Hamburg habe ich kein einziges Mal den Armreif, den mir Dieter damals angelegt hat, abgenommen. Im Gegenteil: Straßenexerzitien in Berlin kurz darauf haben mich intensiv darin bestärkt, diese Brüder und Schwestern der Straße nie mehr aus den Augen zu verlieren. Wieder in Münster, bin ich ins Ostviertel von Münster umgezogen und habe intensiveren Kontakt aufgenommen mit einer Stiftung, die sich dort vor Ort intensiv und qualifiziert für diese Menschen einsetzt. Nicht nur, dass ich jährlich einen Weihnachtsgottesdienst mit Menschen, die auf der Straße leben, gestaltet und gehalten habe. Mein Hamburger Dieter hat mir seit dem Erlebnis in Hamburg auch alle Berührungsängste vor wohnungslosen Menschen auf der Ostseite des Bahnhofs in Münster genommen. Inzwischen habe ich eine Reihe von Freunden unter ihnen gewonnen. Mehrfach habe ich von Einzelnen gehört, was mir Dieter in Hamburg schon gesagt hat: Gut, dass es dich gibt! Du hast freundliche Augen.
Inzwischen bin ich in Rente. Mein pastoraler Einsatz beschränkt sich hauptsächlich auf die Kontaktaufnahme zu Menschen auf der Straße. Diese Entscheidung ist auch dadurch verstärkt worden, dass im Osten der Stadt große Gemeindefusionen durchgeführt wurden. Jetzt zählen zu dieser ‚Zentralgemeinde‘ rund zweiundzwanzigtausend Menschen. Ich habe den mitverantwortlichen pastoralen Mitarbeitern_innen angeboten, mich (eben im Kontext der Gemeindepastoral) persönlich, ‚face to face‘, um Menschen zu kümmern, die in unserer Gemeinde am Rande der Gesellschaft leben. Denn wer von ihnen hat bei dieser Größenordnung überhaupt noch Zeit (und den Mut), ihnen sein Gesicht zu zeigen? Nach einigen (nicht unerheblichen) Krankheitsschüben mit Operationen bin ich froh, im Rahmen meiner Kräfte und mit krankheitsbedingt eingeschränktem Zeitbudget diesen Dienst zu tun.“
Erst acht Jahre später, beim Katholikentag in Osnabrück im Jahr 2008, luden Claudia K. und Christian H. wieder eine Gruppe ein, etwa eine Stunde auf die Straße zu gehen. Die Teilnehmer_innen blieben im Blickkontakt und wir versammelten uns zwischendurch unter einem Regenschutz. Wir sahen auf ein Floß. Darauf stand ein Mann und las einen Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu (Matthäus 5–7). Als der Satz kam „Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen“, hörte der Regen auf und wir gingen weiter bis zu dem kleinen Stadtgefängnis. Auf dem Vorplatz sangen wir zwei Lieder und zogen uns dann in eine kleine Seitenstraße zurück, um uns die Erlebnisse der letzten Stunde zu erzählen. Danach kehrten wir vor das Gefängnis zurück und sangen ein Lied zum Abschied. Erstaunt hörten wir anschließend von den Gefangenen aus ihren Zellen Beifall.
Die Erfahrungen mit diesem Tag waren so ermutigend, dass wir solche Angebote nun regelmäßig in geschützten Zeiten wie Kirchentagen oder während Tagungen wiederholten. Manchmal ist ein Tag Exerzitien auf der Straße ein erstes Modul für einen längeren Suchprozess. Sie werden dann zu Sehübungen. Wäre ein Ergebnis geplant, dann würde das offene Suchen dieser Übungen missbraucht. Sie werden belebt vom Hören auf die innere Sehnsucht oder vom schöpferischen Gegenüber, das unterschiedliche Namen hat.
Auch Menschen in kleinen Gruppen oder Einzelne machen mitten in ihrem Alltag gute Erfahrungen damit, sich innerlich führen zu lassen. Doch sollten jeweils genügend Begleiter_innen für den abschließenden Austausch bereit sein. Für die Übenden ist es notwendig, die mitgebrachten Gewohnheiten, Sichtweisen oder Vorurteile wahrzunehmen. Deshalb sind das Zuhören und die Resonanz der Begleitenden ein wichtiger und für beide Seiten bereichernder Dienst.
Oft genügen als Einstieg in eine kürzere Übungseinheit die Anweisungen Jesu, wie Lukas sie bei der Aussendung der 72 Jünger_innen berichtet (Lukas 10,3-4). Das Weglegen von Sicherheiten und fesselnden Gewohnheiten erhöht die Aufmerksamkeit auf dem Weg. Ja, dann können die Übenden auch an gut bekannten Orten Neues entdecken und sich mit diesen Hinweisen auseinandersetzen. Wenn sie sich darauf einlassen, finden sie Spuren zu den Orten und Themen, die für sie wichtig sind. In christlicher Sprache gesprochen: Sie finden Wegweiser, wo der auferstandene Christus ihnen begegnen will. In den Begegnungen mit ihm, die interessanterweise oft erst beim Erzählen als solche erkannt werden, klären sich entscheidende Lebensfragen.
Neben dem Exerzitientag in Hamburg war im Jahr 2000 ein zweites Ereignis ausschlaggebend für die Entstehung der Straßenexerzitien. Im selben Jahr fand in Berlin-Kreuzberg auch ein zehntägiger Exerzitienkurs statt. Acht Personen meldeten sich dazu an. Aus der Gruppe „Ordensleute gegen Ausgrenzung“, die seit vielen Jahren regelmäßig Mahnwachen auf der Straße vor dem Abschiebegefängnis durchführen, fanden sich vier Begleiter_innen, die – jeweils eine Frau und ein Mann – die beiden Exerzitiengruppen abends begleiteten. Die St.-Michaels-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg stellte die Kellerräume zur Verfügung, die im Winter als Notschlafstelle genutzt wurden. Teresa J. erzählt von diesem Exerzitienkurs:
„Wer in einem arabischen Land zum Tee eingeladen wird, steht von diesem Moment an unter dem Schutz des Gastrechts und darf sich zu Hause fühlen. So war das türkische Teeglas, das wir im Schlussgottesdienst unserer Exerzitien geschenkt bekamen, ein sprechendes Symbol für die Erfahrung der vorangegangenen acht Tage. Offen sein und warten, wohin ich eingeladen werde, dann der Einladung folgen und mich beschenken und herausfordern lassen und wieder weitergehen – so lässt sich der Weg dieser Tage beschreiben.
In den Gemeinderäumen der katholischen St.-Michaels-Gemeinde direkt am ehemaligen Mauerstreifen empfingen uns die Kleine Schwester Ulrike, Annette Westermann von der Gemeinschaft Charles de Foucauld und die Jesuiten Christian Herwartz und Stefan Taeubner. Sie gehören zu den ‚Ordensleuten gegen Ausgrenzung‘, einer Gruppe von Menschen aus verschiedenen religiösen Frauen- und Männergemeinschaften, die sich austauschen über die Praxis ihres Glaubens im Kontakt mit Menschen, die in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Alle drei Monate beten und meditieren sie vor den Mauern des Abschiebegefängnisses in Berlin-Köpenick. Sie hatten sich bereit erklärt, uns durch die Exerzitien zu begleiten, und sich gemeinsam darauf vorbereitet. In der Obdachlosenunterkunft der Gemeinde war ein Matratzenlager liebevoll für uns hergerichtet worden und auch sonst fühlten wir uns in den Gemeinderäumen mit Küche, Gruppenraum und sanitären Anlagen schnell wohl.
Nach dem ersten Tag, der dem Ankommen in der Gruppe, im Haus, im Stadtteil diente, spielte sich schnell ein Tagesrhythmus ein: Wir begannen mit gemeinsamem Morgenlob und Frühstück, danach gingen alle ihre eigenen Wege. Um 17 Uhr trafen wir uns dann zur Eucharistiefeier wieder, in die unsere Erfahrungen, Begegnungen und Gedanken des Tages einmündeten und die in ihrer sehr persönlichen und zugleich einfachen Gestaltung jedes Mal ein besonderes Geschenk für uns wurden. Das anschließende Abendessen bereiteten wir abwechselnd vor und fanden uns danach in zwei festen Kleingruppen zusammen, um die Erfahrungen des Tages auszutauschen, uns gegenseitig darin die Einladungen Gottes verstehen zu helfen und zum Weitergehen zu ermutigen. Eine solche Begleitung in Gruppen war für die meisten von uns neu, stellte sich aber als eine große Bereicherung und Hilfe heraus.
Was war nun – abgesehen von dem etwas ungewöhnlichen Ort – das Besondere dieser Exerzitien? Das Besondere liegt nicht neben oder hinter, sondern gerade in dem Ort, an dem sie stattfanden. Jede/r von uns entdeckte hier heilige Orte, Orte des Gebetes und der Meditation. Für die eine war das ein Platz, an dem sich Drogenabhängige trafen und die Matratze unter der Brücke daneben, die einem Obdachlosen als Schlafplatz diente. Für eine andere war es die Suppenküche, vor der sie sich in die Reihe der Wartenden stellte, um mit ihnen zu essen. Für den einen war es die Bauwagenkolonie, in der jugendliche Punker leben, für die andere die Abschiebehaftanstalt, in der Ausländer die Zeit bis zu ihrer Ausweisung aus unserem Land verbringen müssen, ohne zu verstehen warum. Für die eine waren es die mahnenden Orte deutscher Nazi-Vergangenheit, für wieder eine andere die Mauer, die Menschen und Welten trennte und vielfach noch trennt.
Die Meditation dieser Orte und Begegnungen verwandelte vor allem unsere Augen: Hässliche, abstoßende oder Angst einflößende Gestalten wurden unter diesem Blick zu Menschen mit Würde, die uns etwas zu sagen hatten von Gott. Immer wieder staunten wir, wie sich da Verbindungen zum Evangelium zeigten. Als beispielsweise ein angetrunkener Obdachloser zwei von uns einer dritten Person als seine Mutter und seine Schwester vorstellte, bekam das Tagesevangelium, in dem Jesus fragte, wer ihm Mutter, Schwester und Bruder sei, eine ungeahnte Aktualität. Die Betrachtung der Worte Jesu nach einer solchen Begegnung kann nicht aus abgehobenen Gedanken bestehen, sondern lässt mitten im konkreten Leben Ausschau halten nach den Menschen, in denen er mich als seine Schwester anschaut und anspricht. Ein zweites, ganz anderes Beispiel mag diese Einladung Gottes an solch einem heiligen Ort noch verdeutlichen. Betend vor den Mauern und Gittern eines Gefängnisses zu sitzen, wurde für mich zu einer schmerzhaften Herausforderung Gottes, meine eigene Ohnmacht und Begrenztheit anzuschauen. Zugleich schenkte er mir mitten darin die überraschende Begegnung mit einem Kind, die mir eine neue Sicht meiner Ohnmacht ermöglichte. So kann jede/r von uns Geschichten erzählen, wie wir in dieser Woche durch scheinbar äußere Erlebnisse auf einem inneren Weg mit Gott geführt wurden.
Ignatius erkannte verschiedene Exerzitienphasen auf dem Weg: das Fundament, die schmerzende Selbsterkenntnis, die Betrachtung des Lebensweges Jesu bis hin zu seinem Leiden und seiner Auferstehung und schließlich einer Betrachtung zur Erlangung der Liebe. In den begleitenden Gesprächen stellten wir immer wieder überrascht fest, wie sich diese Phasen auch ohne Planung und gezielte Impulse und mitten in einer doch recht unruhigen Umgebung wie von selbst einstellten. Als Ergänzung dazu, hinauszugehen und sich von den Menschen und Orten einladen zu lassen, war dabei die Vertiefung in einer stillen ‚Wiederholungsmeditation‘ wichtig, um das Erfahrene ‚innerlich zu verkosten‘. Die in ihrer Schlichtheit sehr ansprechende St.-Michaels-Kirche und die Kapelle der Sießener Franziskanerinnen, zu denen wir jederzeit Zugang hatten, boten uns dazu willkommene Räume der Stille, für die wir sehr dankbar waren.
Einen weniger auffälligen, aber entscheidenden Anteil am Gelingen unserer Exerzitien hatten schließlich unsere Begleiter_innen, die sich – neben ihrer Alltagsarbeit – sehr intensiv auf die Prozesse der Einzelnen und der Gruppe einließen und uns an ihrer Spiritualität vom menschlichen Gott teilnehmen ließen. Als wir am Ende der gemeinsamen Zeit die ‚Schätze‘, die jede/r gefunden hatte, symbolisch in einer Schale sammelten, war diese bis zum Rand gefüllt und allen war klar, dass diese Form der Exerzitien Gott eine besondere Möglichkeit gibt, Menschen auf seinem Weg zu führen, und dass sie deshalb unbedingt wiederholt und auch anderen ermöglicht werden sollte.“
Nach diesem Exerzitienkurs ermutigten die vier Begleiter_innen Christian Herwartz, im nächsten Jahr wieder Exerzitien an sozialen Brennpunkten auszuschreiben. Sie fanden 2001 in Berlin und Münster statt. In den nächsten Jahren riss die Kette der Einladungen zu solch besonderen Zeiten nicht ab und fanden in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Österreich, Ungarn und Frankreich statt. Auch spezifische Gruppen kamen: Ehepaare, Männer, Frauen und Frauen liebende Frauen, Studierende, junge Erwachsene, ehemalige Strafgefangene, Obdachlose.
Mit besonderer Freude blickten wir im Sommer 2005 im Vorfeld des Weltjugendtages in Köln auf die Begleitung einer Gruppe junger Menschen aus Frankreich, Taiwan und Texas in Fulda entgegen. Wie konnten wir ihnen von dem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch erzählen, vor dem Mose stand, ohne dass wir ihre Sprachen verstanden? Wie konnten sie von ihren Erfahrungen berichten? Die Geschichte spielten wir vor einem besonders großen Dornbusch: dem Gefängnis vor Ort. Nach einer Zeit der Stille begann ein Fürbittegebet. Aus den Wortfetzen, die wir verstanden, wurde deutlich, dass sie die biblische Erzählung verstanden hatten. Im abendlichen Austausch bemerkten wir: Einige von ihnen empfanden es, als würden wir in Deutschland unsere Toten im Paradies begraben. Denn eine solche Blumenpracht wie auf den Friedhöfen konnte in ihren Augen nur paradiesisch sein. So feierten wir den ins Leben führenden Abschlussgottesdienst mit der Emmausgeschichte aus dem Lukasevangelium auf einem Friedhof. Die Gruppe mit einundzwanzig Teilnehmer_innen zog nach dieser Woche zum Weltjugendtag.