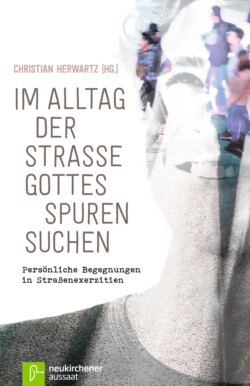Читать книгу Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Am Anfang eine Bitte und am Ende Dankbarkeit über die empfangenen Geschenke
ОглавлениеIn Berlin-Kreuzberg lebe ich in einer offenen Wohngemeinschaft zusammen mit Menschen aus vielen Teilen der Welt. Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen, religiösen und politischen Zusammenhängen. Hier können im persönlichen Kontakt auch unkonventionelle Anliegen ausgesprochen und es kann nach der dahinterliegenden Sehnsucht gesucht werden.
Ein Theologiestudent aus Frankfurt, Ludger V., fragte sich am Ende seines Studiums, ob er für ein Jahr in einem Aids-Hospiz arbeiten solle. Diese Entscheidung wollte er im Sommer 1996 während einer Exerzitienzeit in unserer eng belegten Wohngemeinschaft fällen. Mir war dieses Ansinnen damals unverständlich, da nur in meinem Schlafzimmer mit sieben Betten Platz für ihn war, wir keinen stillen Raum für die Meditationen haben und außerdem hatte ich noch nie Exerzitien begleitet. Doch er kam trotzdem. Abends, wenn ich von meiner Arbeit in der Fabrik zurück war, hörte ich seinen Erzählungen zu. Ludger meditierte seine innere Zerrissenheit auf dem schmalen Pflasterstreifen, der an den Verlauf der Berliner Mauer erinnert. Er ging mit einem Fuß rechts und mit dem anderen links davon. Oder er meditierte auf der Straße die Wunden der Stadt. Eines Tages erzählte er von Menschen ohne Schatten auf dem gut ausgeleuchteten Potsdamer Platz – für ihn eine Höllenerfahrung. Später nahm ihn ein Obdachloser mit und zeigte ihm sein Kreuzberg. Nach diesem Spaziergang war die Entscheidung für eine Zeit im Hospiz gefallen.
Im Hören auf seine Erfahrungen wurde mir mein anfängliches Nein aus der Hand gerissen: „Ja, solche Entscheidungsprozesse sind auch bei uns möglich.“ Ich wurde noch zweimal Zeuge solch spannender Entwicklungsgänge bei einzelnen Besuchern und dann im Jahr 1998 während eines kleinen Exerzitienkurses. Die Teilnehmer_innen konnten in der Sommerpause die Räume einer Wärmestube nutzen. Danach blieb das große Geschenk der Kreuzberger Exerzitien, wie sie damals noch hießen, weitgehend unbeachtet. Doch als ich Anfang des Jahres 2000 arbeitslos wurde, begann ein neues Kapitel der Straßenexerzitien und ich wurde von den anderen Begleiter_innen zum Auspacken dieses Geschenkes angehalten.
In den vielen Jahren als Arbeiter an der Drehbank, im Lager oder bei Umzügen betete ich täglich darum, in meinen Kolleg_innen dem auferstandenen Christus zu begegnen. Ich wurde beschenkt. Für meine eigenen Exerzitien auf der Straße fand ich im Winter 2003 eine Unterkunft in der Notschlafstelle Berlin-Friedrichshain und eine gute Begleiterin. Nach einigen Tagen drängte es mich innerlich, einen Hindutempel aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin verharrte ich erschrocken an der Stadtteilgrenze, als stünde ich an der Frontlinie und wolle fahnenflüchtig zum Feind überlaufen. Den Tempel führten Menschen aus Sri Lanka. Dort wurden im aktuellen Bürgerkrieg viele Christen umgebracht. Freunde lebten in Solidarität mit den von dort Geflohenen. Nach einer längeren Pause ging ich schließlich im Gebet weiter. Ich stieg nach einigem Zögern von der Straße aus die steile Treppe zum Tempelraum im Keller eines Wohnhauses hinab, wo ich mir meine Schuhe auszog. Dort sah ich mich um und fand einen Platz gegenüber den religiösen Statuen. Ich setzte mich auf den Boden. Zwischen den Figuren stand ein Priester mit Weihrauch und Speisen. Obwohl er den einen Gott auf eine für mich fremdartige Weise verehrte, solidarisierte ich mich mit ihm als meinem Bruder. Auch er weist mit all den Zeremonien auf unser Geschaffensein hin.
Als er mich jedoch sah, ärgerte er sich über meine Sitzhaltung und beschimpfte mich in einer mir unverständlichen Sprache. Ich setzte mich – überraschenderweise ohne inneren Ärger – respektvoller hin. Im Nachbarraum knüpften Frauen Blumengirlanden. Bald kam eine von ihnen mit einem warmen Mittagessen zu mir. Verblüfft aß ich es mit meinen Händen. Anschließend wurde mir gezeigt, wo ich sie wieder waschen konnte. Gestärkt nahm ich an den weiteren Zeremonien teil. Als der Tempelraum mittags geschlossen wurde, kam ich voll Freude mit einem roten Punkt zwischen den Augenbraunen wieder ans Tageslicht. Ich konnte das Glück der Einheit kaum fassen. Auch den Priester im Buddhatempel und den Vorbeter in der Moschee erlebte ich trotz aller Unterschiedlichkeit als Brüder im Dienst vor dem – uns allen – Heiligen. Bald danach begann in Berlin das monatliche interreligiöse Friedensgebet, an dem ich intensiv beteiligt bin. Voll Dankbarkeit schreibe ich all die Erfahrungen auf.
Maria Jans-Wenstrup