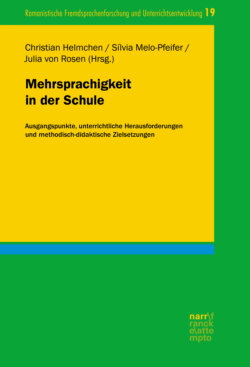Читать книгу Mehrsprachigkeit in der Schule - Группа авторов - Страница 29
a. Das Konzept der mehrsprachigen Kompetenz in Evaluationsverfahren
ОглавлениеDie traditionellen Testverfahren zur Evaluation einsprachiger Kompetenzen stehen seit längerem in der Kritik, was das zu Grunde liegende Sprachkompetenzmodell betrifft. In einzelsprachlichen Tests werde Sprache nach wie vor als ein homogenes, monolinguales Konstrukt betrachtet und das Ideal eines monolingualen Sprechers/einer monolingualen Sprecherin mit muttersprachlichen Kompetenzen verfolgt. Dieses Konzept sei ein idealisiertes, das beispielsweise auch das Konzept der Variation in der Erstsprache weitgehend außer Acht lasse (vgl. dazu z. B. Cook 2007).
Zu kurz würden gängige Testverfahren jedenfalls greifen, wenn es um die Abbildung der Sprachkompetenz mehrsprachiger Sprecher/innen gehe: Studien zeigen, dass mehrsprachige Sprecher/innen sich quantitativ und qualitativ von monolingualen Sprecher/innen unterscheiden. So konnten Kroll & Dussias (2012) zeigen, dass in bilingualen Sprecher/innen beide Sprachsysteme aktiv sind, auch wenn nur eine Sprache aktiv verwendet wird – ein Phänomen, das Cook (1991) als multicompetence („knowledge of two languages in one mind“) bezeichnet. Aktuelle Ansätze der Mehrsprachigkeitsdidaktik wie der Translanguaging-Ansatz oder die Interkomprehensionsdidaktik beruhen auf einem komplexen und dynamischen Kompetenzbegriff, der das gesamte sprachliche und nichtsprachliche Repertoire der Sprecher/innen umfasst und in dem die Sprachsysteme nicht voneinander getrennt sind, sondern zusammenwirken. In der Interaktion schöpfen Sprecher/innen das gesamte ihnen zur Verfügung stehende (sprachliche) Repertoire aus.
Während die Unterschiede in der Sprachkompetenz in der L2 von mehrsprachigen Sprecher/inne/n gegenüber einsprachigen Sprecher/inne/n bereits recht gut untersucht sind (cf. Cenoz, Hufeisen & Jessner 2001; Gass & Selinker 1994), rückten erst in den letzten Jahren die Einflüsse der L2 bzw. der L3 auf die Erstsprachen mehrsprachiger Sprecher/innen ins Blickfeld. Auch hier zeigen sich Unterschiede auf den verschiedenen Ebenen des Sprachsystems: bei der Geschwindigkeit der Worterkennung, der Phonologie, der Semantik und der Syntax (für einen Überblick vgl. Brown 2013). Unterschiede sind auch im Interaktionsverhalten mehrsprachiger Sprecher/innen festzustellen: Bilinguale bzw. mehrsprachige Sprecher/innen passen das Gesprächsverhalten, insbesondere die eingesetzten Interaktionsstrategien, an die jeweiligen Gesprächspartner/innen an (vgl. z. B. Gumperz 1982; Giles 1984; Grosjean 2008, 2010; Valdés 2005). Hier ignoriert die Testpraxis das Konzept einer mehrsprachigen Kompetenz, wie sie von Cook (1991) oder von Coste et al. (1997; 2009) beschrieben wurde: Diese in mehrsprachigen Interaktionen unter Umständen erfolgreicheren Strategien mehrsprachiger Sprecher/innen werden in monolingualen Testverfahren als fehlerhaft bewertet. Testverfahren haben aber traditionellerweise eine enge Beziehung zum Kompetenzbegriff und sollten auch auf aktuellen Sprachtheorien beruhen. Verfahren, die diese Sprachtheorien und Kompetenzmodelle nicht widerspiegeln, seien daher nach Shohamy (2011, 420) auch hinsichtlich ihrer Validität problematisch. Jedenfalls bilden sie die Realität einer plurilingualen Gesellschaft nicht entsprechend ab. Insbesondere was die Interaktion betrifft, müssen gängige Testverfahren überdacht bzw. eigene Testformate konstruiert werden, die dem dynamischen Charakter der mehrsprachigen Interaktion gerecht werden (cf. Canagarajah 2010, 238sq.; Shohamy & Menken 2015, 264sq.).
Wie kann nun aber eine mehrsprachige Kompetenz und im Speziellen die Interkomprehensionskompetenz angemessen evaluiert werden? Im Folgenden sollen einige Ansätze bzw. Empfehlungen dargestellt werden.