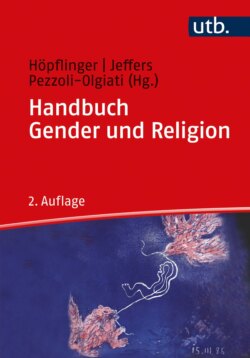Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 31
2 Eine Disziplin im Elfenbeinturm?
ОглавлениеDie Religionswissenschaft verpflichtet sich, wie jede andere Wissenschaft, einer distanzierten, möglichst präzisen und diskursiven Beschreibung und Analyse bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge, die im Laufe ihrer gut 150-jährigen akademischen Präsenz unter dem Etikett »religiös« subsumiert wurden.2 Noch bis in die Neunzigerjahre galt innerhalb der Hauptströmungen, die unsere Fachgeschichte stark geprägt haben, das Ideal einer »möglichst objektiven« Annäherungsweise an religiöse Symbolsysteme »von außen« unbestritten als Richtlinie für eine qualitativ gute wissenschaftliche Arbeit. Vor allem in den letzten Jahren haben viele Faktoren zu einer Krise dieses Ideals geführt. Ich nenne hier nur wenige Entwicklungen, die mir als wesentlich erscheinen.
Unter dem Einfluss der hermeneutischen und der postmodernen Reflexion ließ sich aus philosophischer Sicht die Idee einer Distanz im Sinne eines unbeteiligten, wertfreien und unparteiischen Blickes auf religiöse Phänomene nicht mehr halten. Auch im Austausch mit den traditionellen Nachbardisziplinen der Religionswissenschaft, insbesondere mit vielen Fachbereichen innerhalb von christlichen Theologien, aber auch mit Bereichen wie der Ethnologie, Soziologie, Geschichte usw., erschien die Haltung einer Analyse ganz »von außen« als Hauptmerkmal religionswissenschaftlicher Arbeit schlichtweg naiv zu sein.
Darüber hinaus nimmt der gesellschaftliche und politische Druck auf die Religionswissenschaft stets zu: Sowohl auf der lokalen als auch auf der globalen Ebene sind Religionen zu zentralen Themen zeitgenössischer gesellschaftlicher Diskurse avanciert.3 Angesichts der komplexen Konstellationen, die die heutige Gesellschaft herausfordern, wird nach einem religionswissenschaftlichen, lösungsorientierten Wissen gefragt, das auch angesichts politischer und gesellschaftlicher Fragen relevant sein kann. Von der Bedeutung religiöser Kleiderordnung bis zum Gewaltpotenzial von Religionen, von Bildern des Todes im Hinblick auf die Euthanasieproblematik bis zum Verlust historischer Kenntnisse über die Traditionen im Lande: Der Religionswissenschaftler, die Religionswissenschaftlerin wird bei verfahrenen Situationen als Fachperson angefragt, um Verhandlungsräume in Konflikten zu schaffen, um Konzepte zur Erhaltung des religiösen Friedens zu erarbeiten oder um Projekte zur Förderung der friedlichen Koexistenz von unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften zu entwickeln und zu propagieren. Dadurch werden Fachleute der Religionsforschung immer wieder an ihre Verankerung im jeweiligen historischgesellschaftlichen Kontext erinnert.4
Die Zugehörigkeit der Religionswissenschaft zum akademischen Elfenbeinturm kann in zwei verschiedene Richtungen gedeutet werden. Eine erste, positive: In der Welt der Wissenschaft kann religionswissenschaftliche Forschung und Lehre in einem von direkten politischen Ansprüchen geschützten Raum betrieben werden, Untersuchungsfelder können erschlossen werden, ohne unmittelbar von den Bedürfnissen der Zeit motiviert oder direkt abhängig zu sein. Diese privilegierte Situation wäre jedoch unhaltbar, wenn man die politische und gesellschaftliche Relevanz akademischer Auseinandersetzung mit Religionen ausblenden würde. Damit wären wir bei der zweiten, negativen Konnotation: Der Elfenbeinturm würde somit zum abgeschotteten Ort, in dem die wissenschaftliche Distanz mit einem naiven Konzept von Objektivität gleichgesetzt wird.
Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft einerseits und Forschung und Lehre andererseits darf nicht mehr vernachlässigt werden; die zunehmende Sensibilität gegenüber dem historisch-gesellschaftlichen Hintergrund, in dem Religionswissenschaft betrieben wird, hat auch zur Rezeption von wissenschaftlichen und politischen Diskursen um das Thema Gender geführt. Dies geschieht in zweifacher Perspektive: Das Gender-Thema wird nicht nur im Hinblick auf die Erforschung von religiösen Symbolsystemen als relevant angesehen, sondern auch im Hinblick auf die Stellung von Forschern und Forscherinnen in der Interaktion zwischen Gesellschaft und Wissenschaft.5 Lisbeth Mikaelsson bringt dies in einem Beitrag pointiert zum Ausdruck, der 2004 in New Approaches to the Study of Religion erschienen ist:
Religion is a main factor when it comes to how gender differences are produced and realized in people’s lives. Religious mediation of gender happens through the interpretation of myths and symbols, as well as in their ritual, ethical and organizational enactment. Religious teachings legitimize gender hierarchies in society and influence personal gender identity. Gender research in the history of religions is important in society at large because it contributes to our understanding of how divisions between men and women are sanctioned and at the same time demonstrates how religion may structure people’s lives in fundamental respects.6
Der Einfluss von religiösen Geschlechts- und Gender-Konzepten auf gesellschaftliche Organisationen hat auch die Universität und ihre Hierarchien im Laufe der Jahrhunderte beeinflusst.