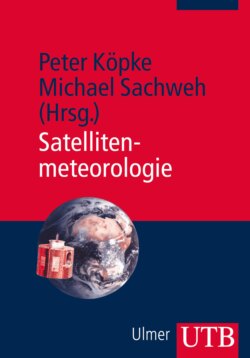Читать книгу Satellitenmeteorologie - Группа авторов - Страница 19
2.1.2 Emission, Absorption und Streuung
ОглавлениеDie Moleküle und Atome, aus denen Materie aufgebaut ist, sind in ständiger Bewegung, und zwar nicht nur als Ganzes, sondern auch innerhalb des Moleküls in Form von Schwingungen oder Rotation. Durch Zusammenstöße wird Energie übertragen, wodurch sich die Bewegungsformen des Moleküls ändern können, aber auch Elektronen in den beteiligten Atomen auf höhere Bahnen gelangen können. Derartige angeregte Zustände im Atom oder die verstärkten Schwingungen oder Rotationen im Molekül sind nur selten von längerer Dauer. In den meisten Fällen wird schon nach rund einer milliardstel Sekunde der Ausgangszustand wieder hergestellt, wobei die überschüssige Energie in Form eines Photons abgestrahlt wird. Durch diesen Prozess, die „Emission“, wird praktisch permanent thermische Energie in Strahlung überführt. Die Energiedifferenz des Übergangs im Atom oder Molekül von dem einen zum anderen Zustand bestimmt nach Gleichung 2.3 die Wellenlänge der Strahlung, die damit wiederum den individuellen Übergang charakterisiert.
Wenn ein Photon auf ein Teilchen trifft, überträgt es umgekehrt seine Energie auf das Teilchen, sei es nun Atom oder Molekül, und bringt es so in einen angeregten Zustand. In den meisten Fällen ist dieser Zustand auch nur von extrem kurzer Dauer. Es wird gleich wieder ein Photon abgestrahlt. Da die Energiestufe bei beiden Prozessen die gleiche ist, ist auch die Energie des wieder abgestrahlten Photons die gleiche, nur seine Richtung wird meistens eine andere sein. Im Strahlungsbild ergibt sich eine Änderung der Richtung der Strahlung, aber ohne Änderung der Wellenlänge. Dieser Prozess heißt „Streuung“.
Wenn die Streuprozesse an einer festen Oberfläche erfolgen wird nur die in den rückwärtigen Halbraum gestreute Strahlung wieder dem Strahlungsfeld zugeführt. Der mikrophysikalische Prozess ist derselbe, der Vorgang wird aber als „Reflexion“ bezeichnet. Dabei kann die reflektierte Strahlung in jede mögliche „Zurück“-Richtung gehen, die „spiegelnde“ Reflexion ist bei natürlichen Oberflächen die Ausnahme (Kap. 2.1.3).
Bei der Wechselwirkung von Strahlung mit Wolken kommen beide Begriffe zur Anwendung. Wird die Wolke als Anhäufung von Tropfen aufgefasst, handelt es sich um Streuung an Wolkentropfen, wobei allerdings jedes Photon schnell viele Streuprozesse erleben kann, da die streuenden Teilchen dicht beieinander liegen. Wird die Wolke hingegen als kompaktes Gebilde aufgefasst und nur die an der Oberfläche austretende Strahlung betrachtet, so wird auch von Reflexion an der Wolke gesprochen. Die Aussagen „von einer Wolke rückgestreute“ oder „an einer Wolke reflektierte“ Strahlung können deshalb als synonym aufgefasst werden.
Es kann passieren, dass ein Photon auf ein Teilchen trifft, das die übertragene Energie gerade gut einbauen kann. Dann wird die Energie nicht wieder abgestrahlt, sondern verbleibt in der Materie. Die Photonenenergie führt damit bei dem Teilchen zu einem höheren, aber stabilen Energieniveau. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass durch die Energie des Photons ein Elektron auf eine andere, aber stabile Bahn gelangt, dass Schwingungszustände geändert werden, die Materie erwärmt wird oder dass die Energie des Photons für Photosynthese genutzt wird. Dieser Prozess, bei dem die Strahlungsenergie in der Materie verbleibt, heißt „Absorption“ – unabhängig davon, was mit der absorbierten Photonenenergie geschieht.
In der Praxis existieren auch Mischformen, bei denen die aufgenommene Strahlungsenergie zwar wieder abgestrahlt wird, jedoch nicht vollständig oder in zwei Stufen, jeweils mit anderen Wellenlängen als die der einfallenden Strahlung. Es kann aber auch der umgekehrte Fall eintreten, dass dem wieder emittierten Photon zusätzliche Energie mitgegeben wird, weil gerade ein angeregtes Niveau getroffen wurde. Im ersten Fall ist die Wellenlänge der abgestrahlten Strahlung größer als die der eingefallenen, im zweiten Fall kleiner. Handelt es sich um Streuung, aber nicht bei der ursprünglichen sondern bei benachbarten Wellenlängen, wird der Prozess nach dem Entdecker des Phänomens „Raman-Streuung“ genannt.