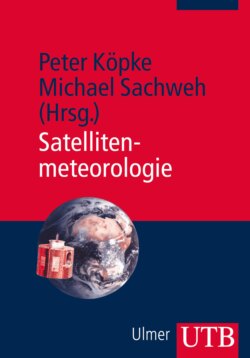Читать книгу Satellitenmeteorologie - Группа авторов - Страница 21
2.2 Die Gesetze von Planck und Kollegen 2.2.1 Plancksches Strahlungsgesetz
ОглавлениеJede Materie mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts, d. h. jeder natürliche Körper gleich welchen Aggregatzustands, strahlt elektromagnetische Strahlung ab – es wird Strahlung emittiert. Darüber hinaus gilt, dass diese Strahlung sich mit der Temperatur in ihrer Intensität absolut und als Funktion der Wellenlänge ändert. Sichtbar wird der Wellenlängeneffekt z. B. beim Erhitzen von Eisen. Wenn eine elektrische Herdplatte langsam heiß wird, sendet sie zuerst Strahlung aus, die vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann, in der Folge dann solche, die nicht vom Auge gesehen aber durchaus von der Haut als Wärme gefühlt werden kann. Mit weiterer Erhöhung der Temperatur verschiebt sich das Maximum der Strahlung zu kürzeren Wellenlängen und damit in den sichtbaren Bereich. Mit zunehmender Temperatur ändert sich die Farbe des Eisens von rot über orange bis zu weiß glühend, mit der Konsequenz, dass ein geübter Schmied aus der Farbe die Temperatur eines Werkstücks und damit seine Möglichkeiten zur Bearbeitung ableiten kann.
Diese Zusammenhänge, d. h. die spektrale Verteilung und Stärke von elektromagnetischer Strahlung in Abhängigkeit von der Temperatur, hat der Physiker Max Planck in seinem Strahlungsgesetz beschrieben. Dieses Gesetz ist generell gültig, unabhängig von einem gegebenen Spektralbereich.
Die große Leistung von Planck war die Erkenntnis, dass Strahlung von der emittierenden Materie in Form von Strahlungsquanten, den Photonen, abgegeben wird. Dies ermöglichte die Zusammenführung verschiedener bereits vorher bekannter Strahlungsgesetze. Wie besprochen, enthält ein solches Strahlungsquant genau die Energie, die beim Übergang von einem angeregten zu einem niedrigeren Energiezustand in einem Atom oder Molekül freigesetzt wird. Dass die Strahlung mit der Temperatur steigt, erklärt sich aus der dann höheren kinetischen Energie der Bausteine der strahlenden Substanzen.
In festen Körpern kommen durch die unendlich vielen beteiligten Atome und Moleküle alle Energiezustände vor, sodass das abgestrahlte Spektrum alle Wellenlängen enthält. Dieser Zustand wird durch das Plancksche Gesetz und seine Vorläufer beschrieben. Damit gibt das Plancksche Strahlungsgesetz die Zusammenhänge für die praktische Anwendung bei festen Körpern richtig wieder, auch wenn, abhängig von der Art der strahlenden Materie, gewisse Anpassungen gemacht werden müssen.
Das Plancksche Strahlungsgesetz (die „Planck-Funktion”) beschreibt die spektrale Strahlung, die von einem „Schwarzkörper“ ausgeht. Dabei handelt es sich um eine physikalische Idealisierung, die in der Natur nur annähernd vorkommt. Ein gutes Beispiel ist ein Hohlraum mit einer sehr kleinen Öffnung. In der täglichen Praxis ist das z. B. annähernd gegeben durch die Löcher in einer Steckdose. Ein solcher Hohlraum hinter einem Loch absorbiert praktisch alle hineinfallende Strahlung, da diese an seinen Innenwänden zwar in alle Richtungen reflektiert, aber bei jeder Reflexion zumindest teilweise absorbiert wird. Damit ist nach einigen Reflexionen die Strahlung sehr stark reduziert, und es kommt praktisch kein Photon wieder aus dem Loch heraus. Bei einem Reflexionsvermögen von 20 %, wie es für graue Farbe im solaren Spektralbereich angenommen werden kann, ergibt sich nach fünf Reflexionen eine Reduzierung auf 0,25 = 0,03 % und nach zehn Reflexionen auf 0,210 = 0,00001 %. Dadurch erscheint das Loch, durch das die Strahlung in den Hohlraum hineingelangt ist, für einen Beobachter als schwarz, woraus sich der Name Schwarzkörper ergibt. Natürlich ist der Schwarzkörper umso perfekter, je kleiner das Loch ist.
M. Planck erhielt 1918 den Nobelpreis für Physik für seine Quantentheorie.
Da nach dem Kirchhoffschen Gesetz (Kap. 2.2.4) das Absorptionsvermögen eines Körpers gleich seinem Emissionsvermögen ist – gleiche Wellenlänge vorausgesetzt – emittiert ein Schwarzkörper umgekehrt alle bei seiner Temperatur mögliche Strahlung, d.h. er emittiert bei jeder Wellenlänge die bei der gegebenen Temperatur maximale Strahlungsenergie. Dass natürliche Körper meist etwas weniger Strahlung als ein Schwarzkörper emittieren, wird in Kapitel 2.2.3 diskutiert.
Der Zusammenhang zwischen der Schwarzkörperstrahlung bei gegebener Wellenlänge und der Temperatur, das Plancksche Gesetz, kann für verschiedene Strahlungsgrößen formuliert werden. Für unpolarisierte Strahlungsflussdichten in den Halbraum gilt:
Die Größen in der Planck-Funktion sind:
Wellenlänge λ in m
Plancksches Wirkungsquantum h = 6,6256 10–34 W s2
Lichtgeschwindigkeit c = 2,9979 108 m s–1
Die Boltzmann-Konstante k = 1,3804 10–23 W s K–1 ist eine weitere Naturkonstante, die die Energie eines Teilchens mit seiner Temperatur verknüpft. Die Temperatur T im Planck-Gesetz ist die absolute Temperatur, die sich durch T = t + 273,15 aus der Temperatur t in °C ergibt. Häufig wird das Plancksche Gesetz auch in einer Form mit zwei Konstanten c1 und c2 angegeben, in denen die festen Größen bereits zusammengefasst sind.
Da λ in Gleichung 2.7 mit der Einheit m verwendet werden muss, ergibt sich die Strahlungsflussdichte in W m–2 m–1. Es ist formal natürlich möglich, W m–3 zu schreiben, aber das ist unsinnig, da es sich nicht um die Strahlungsleistung in einem Volumen handelt, sondern um die von einer Fläche ausgehende Strahlung in einem Spektralintervall. In der Praxis wird die spektrale Strahlungsflussdichte in einer Dimension angegeben, in der die Wellenlänge mit einer Dimension berücksichtigt wird, wie sie dem betrachteten Spektralbereich entspricht, z. B. in W m–2 μm–1.
Die von einem Schwarzkörper emittierte Strahlung ist isotrop verteilt. Damit ergeben sich Werte für die nach dem Planckschen Gesetz abgestrahlte Strahldichten Lλ (T), indem Mλ durch π dividiert wird. Diese Division durch ein π ergibt sich wegen der Kosinus-Wichtung (Gl. 2.6), obwohl die Strahlungsflussdichte in einen Halbraum emittiert wird, also in den Raumwinkel 2 π.
Abbildung 2.10 zeigt spektrale Strahldichten, wie sie nach dem Planckschen Gesetz von einem Schwarzkörper bei verschiedenen Temperaturen ausgesendet werden. An der y-Achse lässt sich ablesen, wie viel Energie jede an der x-Achse angegebene Wellenlänge zu der gesamten Strahlung beisteuert. Zu beachten ist, dass beide Achsen logarithmisch geteilt sind, um den großen Variationsbereich abzudecken. Die Strahlung, die von einem Schwarzkörper mit 6000 K ausgesendet wird, beschreibt die Größenordnung der Strahlung von der Sonne, und die von einem Körper mit 273 K steht für von der Erde emittierte Strahlung. Die Kurven für die dazwischen liegenden Temperaturen dienen zur Veranschaulichung, sie sind aber für die Satellitenmeteorologie praktisch nicht von Bedeutung. Die rote Linie verbindet die Wellenlängen mit maximaler Strahlung, ein Aspekt der im nächsten Abschnitt näher behandelt wird.
Abb. 2.10
Spektrale Strahldichten von Schwarzkörpern mit 6000, 2000, 600 und 273 K. Die rote Linie gibt das jeweilige Strahlungsmaximum an.
Die Strahlungsverläufe sind asymmetrisch mit einem steilen Anstieg bei kürzeren Wellenlängen und einem flacheren Abfall im längerwelligen Bereich. Mit zunehmender Temperatur steigt die Strahlung bei allen Wellenlängen, die Kurven schneiden sich nicht. Weiter ist zu erkennen, dass der strahlende Schwarzkörper bei allen Wellenlängen Strahlung abgibt, wobei dieser Eindruck aber durch die logarithmische Darstellung stark betont wird. Bei Beachtung der Überlegung, dass die Werte bei zwei Zehnerpotenzen unterhalb vom Maximum nur noch 1 % der Werte im Maximum haben, zeigt sich, dass die relevante Strahlung bei einer gegebenen Temperatur jeweils nur aus einem sehr kleinen Spektralbereich kommt. Bei Darstellung der Strahlung mit linearer Skala wird diese Konzentration auf einen begrenzten Spektralbereich schnell deutlich.
Als Beispiel zeigt Abbildung 2.11 Strahlung nach Planck für 5800 K – wieder stellvertretend für die Strahlung der Sonne – mit Werten, die im Maximum auf 1 normiert sind. Markiert sind die Wellenlängen, bei denen die Strahlung auf 2 % des Maximums gefallen ist, bei rund 0,2 und knapp 3 μm, wodurch der Wellenlängenbereich dokumentiert wird, in dem die solare Strahlung wirklich wesentlich ist. Zusätzlich zeigt die Abbildung das hoch aufgelöste Spektrum der Sonne, so wie es gemessen wird. Damit wird deutlich, dass die Modellierung als Schwarzkörper mit 5800 K die Strahlung der Sonne zwar im Mittel richtig wiedergibt, aber bei spektralen Messungen das tatsächliche Sonnenspektrum berücksichtigt werden muss.
Zum allgemeinen Verständnis soll noch ergänzt werden, dass bei einer Darstellung der Planck-Funktion mit zwei linearen Skalen – wie in Abbildung 2.11, aber nicht normiert, sondern mit absoluten Zahlen – die Fläche unter der Kurve dem Integral über die Wellenlängen entspricht, also den Werten nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz (Gl. 2.10). Die übliche Darstellung mit logarithmischen Skalen ist hierfür nicht hilfreich, aber eben nötig, um die großen Unterschiede bei verschiedenen Temperaturen in einer Abbildung zu zeigen.
Abb. 2.11
Spektrale extraterrestrische Strahlung der Sonne und Strahlung eines Schwarzkörpers mit der Temperatur der Sonnenoberfläche, normiert auf 1. Angegeben sind die Wellenlängen, bei denen die Strahlung 2 % vom Maximum beträgt (nach einer Idee von Häckel, 2008).