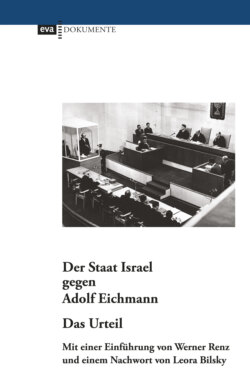Читать книгу Der Staat Israel gegen Adolf Eichmann. Das Urteil - Группа авторов - Страница 6
Eichmann vor Gericht. Recht und Gerechtigkeit in Jerusalem
ОглавлениеZum Glück stand Adolf Eichmann nicht vor einem bundesdeutschen Strafgericht. Hierzulande wohl als Gehilfe qualifiziert, wäre er mit einer zeitigen Freiheitsstrafe glimpflich davongekommen. Das empörende und beschämende Kapitel der justiziellen Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Bundesrepublik wäre um ein weiteres unsägliches Beispiel bereichert worden.1
Zum Glück also stand der »Spediteur des Todes«2 in Israel vor Gericht. Nach Recht und Gerechtigkeit wurde Eichmann von Richtern des Volkes, das er auf Befehl seines »Führers« hatte ausrotten wollen, wegen Verbrechen gegen das jüdische Volk, wegen Verbrechen gegen die Menschheit, wegen Kriegsverbrechen und wegen seiner Mitgliedschaft in feindlichen Organisationen schuldig gesprochen. Das retroaktive und extraterritoriale Gesetz von 1950 (Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law)3 sah für Verbrechen, wie sie von Eichmann verübt worden waren, die Todesstrafe vor. Der Tod durch Erhängen ereilte ihn im Sommer 1962. Sein beim Staatspräsidenten Israels eingereichtes Gnadengesuch war abgelehnt worden.4
Das Gesetz, auf dessen Grundlage Eichmann belangt wurde, hat eine besondere Vorgeschichte. Holocaust-Überlebende hatten in Israel Anzeigen gegen ehemalige Funktionshäftlinge und Ghettopolizisten erstattet. Ihr Vorwurf war, die Betreffenden hätten als Handlanger, als Kollaborateure der SS an Juden Verbrechen begangen. Das geltende Strafrecht Israels bot keine Handhabe, diese vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs im deutsch besetzten Europa verübten Taten zu ahnden. Um inneren Frieden im gerade gegründeten Staat herzustellen, erließ die israelische Legislative im August 1950 das »Gesetz zur Bestrafung von Nazis und Nazikollaborateuren«. Die Besonderheit des Gesetzes war, dass die Strafnormen auf Handlungen Anwendung fanden, die während der Naziherrschaft im feindlichen Ausland (»enemy country«) an einem Verfolgten (»persecuted person«) in einem Lager oder Ghetto (»place of confinement«) begangen worden waren.
Mit dem Gesetz ließen sich also rückwirkend die Taten ahnden, die nunmehrige israelische Bürger im »Dritten Reich« und in den besetzten Ländern in der Zeit von 1933 bis 1945 verübt hatten.5 Das Gesetz stellte mithin »eher eine innerisraelische Angelegenheit dar denn eine zwischen den überlebenden Opfern des Holocaust und dem Staat, der sie repräsentierte, auf der einen Seite und denjenigen, die den Holocaust zu verantworten hatten, den Nationalsozialisten und dem Dritten Reich, auf der anderen Seite«.6
Vor dem Eichmann-Prozess gab es in Israel sogenannte Kapo-Prozesse. Vormalige Funktionshäftlinge, der Kollaboration mit der SS beschuldigt, mussten sich verantworten.7 Meist fielen die Strafen milde aus. Einige Angeklagte wurden freigesprochen. In einem Fall erkannte das Gericht auf die Höchststrafe.8 Der Oberste Gerichtshof gab jedoch der Berufung statt, sah den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit nicht erfüllt, kassierte die Todesstrafe und milderte sie auf zwei Jahre Gefängnis.9