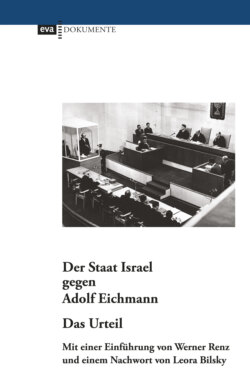Читать книгу Der Staat Israel gegen Adolf Eichmann. Das Urteil - Группа авторов - Страница 8
Der Eichmann-Prozess
ОглавлениеGroßes Interesse an der Verfolgung von NS-Verbrechern hatte die Regierung Ben Gurion nicht. Der junge Staat musste mit anderen Problemen kämpfen. Doch Bauer blieb hartnäckig und der israelische Geheimdienst Mossad wurde nach einigen unzulänglichen Versuchen, Eichmann zu finden und zu identifizieren, des Massenmörders habhaft.18 Nach Israel entführt wurde er im April 1961 vor Gericht gestellt.19
Unmittelbar nach der Entführung Eichmanns im Mai 1960 bildete die israelische Polizei eine Sonderabteilung (»Büro 06«) mit rund 50 Mitarbeitern.20 Ihre Aufgabe war, Dokumente (Urkunden) zusammenzustellen und Zeugen zu finden. Die Beamten arbeiteten der Generalstaatsanwaltschaft zu, die gemäß dem Gesetz von 1950 (§ 14) die Anklage zu erheben und zu führen hatte.
Von Ende Mai 1960 bis Mitte Januar 1961 ließ sich Eichmann bereitwillig von dem Mitarbeiter des Büro 06, Avner Werner Less, verhören. Sitzung für Sitzung legte ihm der Polizeioffizier die von seinen Kollegen zusammengestellten Dokumente vor. Oftmals verhielt es sich so, dass Eichmann allererst erläutern musste, wie die in bürokratischer Amtssprache abgefassten Dokumente zu lesen waren. Das Protokoll des Verhörs (Less nennt es verschiedentlich eine »Unterredung«21, in seinem Nachwort zu einer Auswahl des Verhörprotokolls spricht er gar davon, das Verhör sei »im Plauderton«22 geführt worden), von Eichmann eigenhändig korrigiert, umfasst 3564 Blatt und lag dem Gericht als Beweismittel vor.23
Der Prozess sollte vor dem Jerusalemer Bezirksgericht stattfinden. Seinem Präsidenten kam das Recht zu, den Vorsitzenden Richter und die beiden Beisitzer zu bestimmen. Präsident des Distriktgerichts war Benjamin Halevi. Er hatte bereits im Jahr 1954 sich mit Eichmann befassen müssen. Im Verfahren Attorney General vs. Malkiel Gruenwald ging es um die Frage, ob der Angeklagte Gruenwald in einem 1952 verbreiteten Pamphlet den Regierungsbeamten Israel Kasztner verleumdet hatte. Der als Retter und Helfer von Juden24 geltende Kasztner, führendes Mitglied des Hilfs- und Rettungskomitees (Vaada) in Budapest, war von Gruenwald bezichtigt worden, 1944 mit der SS kollaboriert und wenige Juden (darunter seine Familienmitglieder) auf Kosten Hunderttausender gerettet zu haben.25
Der vom Generalstaatsanwalt26 gegen den Willen Kasztners angestrengte Prozess hatte fatale Folgen. Richter Halevi sprach in dem turbulenten Verfahren den Angeklagten Gruenwald von den Anklagepunkten der Verleumdung und der üblen Nachrede frei. Hinsichtlich der Anwürfe des Angeklagten meinte Halevi, Kasztner habe bei seinen Verhandlungen mit der SS »seine Seele dem Teufel verkauft«.27 Mit der Bezeichnung »Teufel« meinte er Kasztners Hauptverhandlungspartner Adolf Eichmann.28 Überdies nannte er den Gegenspieler Kasztners in Budapest einen »Bloodhound«.29 Nahe lag deshalb, Halevi im zu führenden Verfahren gegen Eichmann als voreingenommen und befangen zu betrachten. Zumindest musste befürchtet werden, dass der Angeklagte Eichmann und sein Verteidiger gegenüber einem Vorsitzenden Halevi diese Besorgnis vorbringen und ihn deshalb ablehnen würden. Alle Versuche, Halevi von seinem Vorhaben abzubringen, den Vorsitz übernehmen zu wollen, scheiterten jedoch. Die Verantwortlichen der Regierung Ben Gurion entschieden sich in ihrer misslichen Lage für einen rechtsstaatlich bedenklichen Schritt.30 Sie änderten kurzerhand das Gerichtsgesetz, um Halevi zu verhindern. Nach dem neuen Gesetz bestimmte der Präsident des Obersten Gerichtshofs in Fällen wie dem Eichmann-Verfahren den Vorsitzenden Richter. Er musste dem Obersten Gerichtshof angehören. Hinsichtlich der Ernennung der beiden Beisitzer blieb es bei der alten Regelung.
Auch die Frage der Verteidigung Eichmanns bereitete Probleme und erforderte gesetzgeberische Schritte. Nach Auffassung der Regierung Ben Gurion sollte kein israelischer Anwalt den Angeklagten vertreten. Eine Gesetzesänderung ermöglichte es, einen ausländischen Rechtsanwalt mit der Aufgabe zu betrauen. In dem Kölner Anwalt Robert Servatius fand die Familie Eichmann einen Rechtsbeistand ihres Vertrauens. Der Untersuchungshäftling akzeptierte den Juristen.
121 Gerichtssitzungen (an insgesamt 76 Tagen) lang dauerte der Prozess. Rund 100 Holocaust-Überlebende traten als Zeugen der Anklage auf. Sie schilderten das deutsche Menschheitsverbrechen in aller Ausführlichkeit. Hunderte von Dokumenten legte die Anklagevertretung vor. Die Urkunden bewiesen zweifelsfrei Eichmanns Eifer bei der »Endlösung der Judenfrage«.31 Auch die als Verbrechen gegen die Menschheit betrachtete Aussiedlung von Polen und Slowenen, die Deportation von Sinti und Roma und die Verschleppung von Kindern des tschechischen Dorfes Lidice wurden ihm zur Last gelegt.
Der Angeklagte, der zu seinem Schutz in einem Glaskasten Platz nehmen musste, überstand nach dem Ende der Zeugenbefragungen (9. bis 74. Gerichtssitzung) circa 30 Sitzungen lang das Kreuzverhör von Verteidigung (75. bis 88. Gerichtssitzung),32 Anklagevertretung (90. bis 104. Gerichtssitzung)33 und Gericht (105. bis 107. Gerichtssitzung).34 Seinen Stuhl in der Glaskabine durfte der Zeuge Eichmann nicht verlassen und in den Zeugenstand treten. Die Sorge um sein Leben war zu groß.35 Mitte August 1961 endeten die Schlussplädoyers von Verteidigung und Anklage.
Das Jerusalemer Bezirksgericht sprach Eichmann im Dezember 1961 in allen fünfzehn Anklagepunkten schuldig. Nur in geringfügigen Einzelheiten, insbesondere bei der Datierung des Beginns von Eichmanns verbrecherischen Handlungen, wich es von den von der Anklage vertretenen Auffassungen ab. Die Anklageschrift hatte den Vernichtungsprozess vorverlegt und auch Eichmanns Rolle bei der »Endlösung der Judenfrage« überhöht.
Das Jerusalemer Urteil spiegelt den damaligen Kenntnisstand, die seinerzeitigen Forschungsergebnisse wider. Aus heutiger Sicht trafen die Richter nicht wenige von der Geschichtswissenschaft nicht bestätigte Feststellungen. Die Sachverhaltsaufklärung war aufgrund der unzureichenden Quellenlage unvermeidlicher Weise noch defizitär. Deshalb hob das Gericht auch hervor, dass es »weder verpflichtet noch in der Lage« sei, »die Arbeit eines Historikers auf [sich; W.R.] zu nehmen«. Seine Tatsachenfeststellungen seien »zwangsläufig nur unvollständig« und würden im Urteil »nicht zum Zwecke einer erschöpfenden historischen Schilderung angeführt«.36
Konsens in der damaligen Forschung war, dass Hitler Mitte 1941 den Befehl zur »Endlösung der Judenfrage« gegeben hatte. Folglich meinte auch das Gericht, der »Befehl zur Vernichtung wurde von Hitler selbst kurz vor dem Einmarsch nach Rußland erteilt«, also vor dem 22. Juni 1941.37 Und: »Wir stellen […] im Gegensatz zur Version des Angeklagten« fest, »daß die Erteilung des Führerbefehls zur physischen Vernichtung der Juden ihm nicht etwa erst im Spätsommer […] bekannt wurde, sondern noch zu Beginn des Sommers 1941.«38
Die Juden Europas galt es vollständig auszurotten. Die beauftragten Akteure teilten mit dem Staatsoberhaupt den Vorsatz, »das jüdische Volk qua Volk zu vernichten und nicht nur Juden als Individuen«.39 Auch der Judenreferent im SS-Reichssicherheitshauptamt (RSHA) hatte nach Auffassung des Gerichts »zu Beginn des Sommers des Jahres 1941 Kenntnis vom Plan der Endlösung«.40 An die Stelle der bis dahin von Eichmann organisierten Zwangsauswanderung der Juden, die er in Wien, Prag und Berlin mit drastischen Mitteln betrieben hatte, war ihre Ermordung getreten. Ab Ende August 1941 bemühte er sich auch, keine in den besetzten Gebieten lebenden Juden mehr ins rettende Ausland entkommen zu lassen. Kein Jude sollte der Vernichtung entrinnen können. Dem Urteil zufolge hatte Eichmann von August 1941 bis Mai 1945 seine Untaten in der Absicht vollbracht, das jüdische Volk zu vernichten, hatte mithin nach dem Gesetz von 1950 »Verbrechen gegen das jüdische Volk« begangen.
Auf Geheiß Reinhard Heydrichs (Chef des SS-Reichssicherheitshauptamts), so Eichmanns Schilderung im Polizeiverhör und in der Beweisaufnahme, besuchte er Mitte September 1941 Odilo Globocnik im besetzten Polen. Der SS- und Polizeiführer von Lublin hatte von Heinrich Himmler (Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei) den Befehl erhalten, im sogenannten Generalgouvernement Vernichtungslager zu errichten. Nach Eichmanns Erzählung zeigte Globocnik dem Abgesandten aus Berlin ein Todeslager. Eichmann nahm an, in Treblinka gewesen zu sein.41 Das von Eichmann besichtigte Lager war vermutlich Bełżec.
Die Holocaust-Forschung ist indes zu anderen Ergebnissen gelangt. Erst im Oktober 1941 erteilte Himmler Globocnik den Befehl, Todeslager zu errichten.42 Mit dem Bau von Bełżec wurde umgehend begonnen, im März 1942 ermordete die SS die ersten Opfer mit Motorabgasen.43
Die von Globocnik geleitete »Aktion Reinhardt« führte sein in Lublin ansässiger Stab unabhängig vom Reichssicherheitshauptamt durch. Eichmann und sein Referat waren freilich gut informiert und standen mit den Massenmördern in Kontakt. Im Fall der Vernichtung der polnischen Juden waren Eichmanns organisatorische Fähigkeiten jedoch nicht gefragt. Ghettoräumungen, »örtliche Aussiedlungen«, Deportationen und Massenmord in den Todeslagern führten die Männer des Lubliner SS- und Polizeiführers mit Hilfe ihrer Helfershelfer und den örtlichen SS-Dienststellen selbstständig durch.
Das eingesetzte reichsdeutsche Personal war im Morden geübt. Viele waren bereits im Rahmen der »Aktion T4« genannten Tötung von Insassen von Heil- und Pflegeanstalten tätig gewesen.44 Die federführende »Kanzlei des Führers«45 hatte die Mörder nach Lublin geschickt. Globocnik standen erfahrene, motivierte und weltanschaulich gefestigte Männer zur Verfügung. Sie mordeten aus Überzeugung und äußerst effektiv.46
Die irrtümliche Vorverlegung des Beginns des Holocaust hat für die Rechtsfrage, wie das Verbrechensgeschehen und Eichmanns Beteiligung zu werten sind, freilich keine Bedeutung. Das Gericht betrachtete »alle im Zuge der Ausführung der Endlösung der Judenfrage begangenen Handlungen als eine Einheit«.47 Diese Rechtsauffassung hat Bestand, auch wenn die Jerusalemer Richter historisch unzutreffend davon ausgegangen sind, dass Hitlers Vernichtungsbefehl »ein einziger, genereller, allumfassender Befehl«48 gewesen war. Ihre von der Forschung verworfenen tatsächlichen Feststellungen machten somit die rechtliche Wertung nicht falsch. An der Darstellung des arbeitsteilig begangenen Kollektivverbrechens ändert die Tatsache, dass es Mitte 1941 keinen verbindlichen, allumfassenden Mordbefehl Hitlers gegeben hat, nichts.49 Fraglos richtig ist deshalb, dass im Verlauf des Jahres 1942 der »Wille der Planenden und der Hauptausführungsorgane […] der gleiche […] war […] wie der des Urhebers, einheitlich und umfassend«.50 Rechtlich betrachtet setzte sich der »strafbare Vorsatz« der Holocaust-Täter »unentwegt fort und umfaßte all die begangenen Handlungen, solange die Aufgabe in ihrer Gesamtheit nicht durchgeführt war«51, sprich: nicht alle Juden restlos vernichtet waren.
Anders als viele bundesdeutsche Gerichte, die die »Vernichtungsaktion« nicht als »eine einzige umfassende Handlung« betrachteten, sie vielmehr »in einzelne Taten und Handlungen zergliedert« haben, die vorgeblich »von Einzelpersonen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ausgeführt wurden«, qualifizierte das Bezirksgericht die Tatbeteiligten als Mittäter.52 Jede »Einzelperson, die vom Plan der Endlösung Kenntnis hatte und an der Judenvernichtung mittat«, war daher »als Mittäter an der Ausrottung in den Jahren 1941 bis 1945 anzusehen«.53 Unerheblich war, an welcher Stelle der Mittäter im Vernichtungsapparat agiert und wie lange er im Vernichtungsprozess mitwirkt hatte. Die Verantwortlichkeit eines jeden Mittäters war nach Auffassung des Gerichts gleich der »Verantwortlichkeit eines Haupttäters (Principal Offender), der das Gesamtverbrechen in Mittäterschaft mit anderen begangen hat«.54 Anders auch als die Rechtsprechung hierzulande unterschieden die Richter nicht zwischen tatnahen und tatfernen Akteuren. Da es sich um »Massenverbrechen« handelte, hatte »die Nähe oder die Entfernung des einen oder des andern dieser vielen Verbrecher zu dem Manne, der das Opfer tatsächlich tötete, überhaupt keinen Einfluß auf den Umfang der Verantwortlichkeit«.55
Der Organisator eines Transports in Paris, der Teilnehmer an einer Fahrplankonferenz in Wien, der Bewacher eines Todeszuges von Westerbork nach Sobibór, der Häscher bei einer Razzia in Rom: sie alle waren, sofern sie in dem Wissen handelten, einen Beitrag zur »Endlösung« zu leisten, ebenso verantwortlich, wie der Schütze an der Erschießungsgrube im rückwärtigen Heeresgebiet der Ostfront, der »Selekteur« auf der Rampe in Birkenau, der die Opfer durch die »Himmelsstraße« in die Gaskammern der Lager der »Aktion Reinhardt« treibende SS-Mann, der das Zyklon B in Auschwitz und Majdanek in die »Duschräume« schüttende »Desinfektor«. Nach Auffassung des Gerichts wuchs das »Verantwortlichkeitsausmaß […] je mehr man sich von demjenigen entfernt, der die Mordwaffe mit seinen Händen in Betrieb setzt und zu den höheren Befehlsstufen gelangt, den ›Anstiftern‹«56, den Schreibtischtätern im Reichssicherheitshauptamt, in den Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD in den besetzten Gebieten und anderswo.
Anders gesagt: Die Frage, ob Eichmann an Vernichtungsaktionen in den Todeszentren beteiligt war, erachtete das Gericht »von sekundärer Wichtigkeit, da die rechtliche und moralische Verantwortung desjenigen, der das Opfer dem Tode ausliefert«, in den Augen der Richter »nicht geringer ist, als die Verantwortung desjenigen, der das Opfer mit eigenen Händen tötet, wobei sie sogar die Verantwortung des letzteren übersteigen kann«.57
Mit Entschiedenheit wies das Gericht die »Version des Angeklagten zurück, er sei nichts als ein ›Zahnrad‹ in der Vernichtungsmaschine gewesen«.58 Die meist zum Zweck der Eigenexkulpation vorgetragene »Rädchen-Theorie« lief auf das Argument hinaus, man sei gleich einem kleinen Rad im großen Getriebe des Massenverbrechens unwichtig und austauschbar gewesen. Oder, in weiterer Verwendung der metaphorischen Sprache, kein Motor, kein Schwungrad, kein Schalthebel sei man gewesen, sondern nur winziger Teil eines aus vielen tausend ineinandergreifenden Einzelstücken zusammengesetzten, automatisch und ohne eigenes Zutun funktionierenden Mechanismus.
Das Gericht hob hervor, das Reichssicherheitshauptamt sei die »Zentralbehörde in Angelegenheiten der Endlösung der Judenfrage« gewesen, Eichmann habe »an der Spitze der an der Durchführung der Endlösung Tätigen« gestanden.59 Wohl handelte Eichmann als Befehlsempfänger, agierte »nach den ihm von seinen Vorgesetzten erteilten Richtlinien«, doch ihm blieb in seiner Stellung als Referent »noch ein weites Ermessen sogar zur Planung von Handlungen aus eigener Initiative«. Mithin war Eichmann den Richtern entgegen seinen Beteuerungen »keine ›Marionette‹ in den Händen anderer, sondern nahm seinen Platz unter den Drahtziehern ein«.60
War die Shoah eine Tat, an der als Mittäter beteiligt war, wer im Vernichtungsapparat eine Funktionsstelle61 innehatte, dann konnte es in einem Strafverfahren nicht darum gehen, einem Angeklagten konkrete Tatbeiträge individuell zuzurechnen. Die Aufteilung der Shoah in Ort und Zeit, in Lokalereignisse und Episoden, die Annahme von unabhängigen, selbstständigen Einheiten62 betrachtete das Gericht als eine unangemessene rechtliche Wertung. Die Forderung des konkreten Einzeltatnachweises63 war angesichts des arbeitsteilig begangenen Kollektivverbrechens mithin obsolet.
Die Jerusalemer Richter erforschten auch Eichmanns innere Einstellung zu den ihm befohlenen Taten. Der Angeklagte rechtfertigte sich mit dem Verweis auf seinen unbedingten Befehlsgehorsam. Blinder Gehorsam war ihm eine Tugend, die Gesetzmäßigkeit eines Führerbefehls stand für ihn außer Frage. Verantwortung kam daher dem auf höheren Befehl handelnden Untergebenen seiner Meinung nach nicht zu. Schuldhaft konnte sein Tun und Lassen nicht gewesen sein, da er staatskonsensual, führertreu und befehlsergeben gemäß seinem geleisteten Eid agiert hatte. Die Stimme des Gewissens regte sich deshalb bei Eichmann nicht. Im Gegenteil: Spätestens nach der im Januar 1942 abgehaltenen Wannsee-Konferenz hatte er ein ruhiges und gutes Gewissen.
Die Richter verwarfen Eichmanns fadenscheinige Rechtfertigungsversuche. Der Befehl zur Vernichtung von Millionen schuldloser Menschen war kein »Staatsakt«,64 der den Befehlsausführenden aller persönlichen Verantwortung enthoben hätte. Es handelte sich vielmehr um einen »augenscheinlich unrechtmäßigen«65 Befehl, den Eichmann im Wissen um seine Rechtswidrigkeit dennoch mit Eifer befolgt hatte. Bei ihrer Erforschung der Wahrheit gelangten die Richter zu der Erkenntnis, der Angeklagte habe »seine Aufgabe in all ihren Phasen […] aus innerer Überzeugung mit ganzem Herzen und ganzer Seele geleistet«.66 Nie »lau« in seinen Befehlen und Taten sei er »tatkräftig, erfindungsreich und extrem in seiner Aktivität zur Durchführung der Endlösung«67 gewesen. Sein »verbrecherisches Handwerk« habe er »mit ganzem Herzen und ganzer Seele« betrieben,68 »[s]einer Aufgabe widmete er seinen regen Geist, seine List und sein Organisationstalent«.69 Dem Gericht war Eichmann folglich kein »initiativlose[r] Angestellter«, kein bloßer »bürokratischer Beamter«, vielmehr sah es in ihm einen »Mann von eigenem Willen, der sich so stark fühlt, daß sogar ein Führerbefehl ihm nicht als derart bindend erscheint, daß verboten sei, sich über ihn Gedanken zu machen«.70
Wie insbesondere die Anklagevertretung war auch das Gericht der Auffassung, Eichmann habe »eine Schlüsselstellung in der Durchführung der Endlösung«71 innegehabt, sein Referat im Reichsicherheitshauptamt habe »im Zentrum der Aktion der Endlösung«72 gestanden.
Eichmann war freilich nicht der »Architekt der Endlösung«. Anklage und Gericht überschätzten seine Rolle. Mit dem Verbrechensgeschehen in Polen, dem Baltikum und der Sowjetunion hatte er befehlsmäßig nichts zu tun. Er lieferte aber (»fahrplanmäßig«, »transporttechnisch« nur, wie er fortwährend in permanenter Selbstexkulpation beteuerte) Juden nach Łódź, Riga, Minsk, Kowno und Sobibór. Von den RSHA-Transporten ins in Ostoberschlesien gelegene Konzentrationsund Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (Ostoberschlesien war ins Deutsche Reich eingegliedert worden)73 ganz zu schweigen. In seiner Studie über den Mord an den europäischen Juden resümiert der Holocaust-Historiker Christian Gerlach: »Adolf Eichmann, der das Judenreferat des RSHA leitete, übte einigen Einfluss aus und koordinierte die Deportation von über einer Million Juden aus weiten Teilen Europas in Todeslager und Ghettos, aber seine Koordination erfasste nicht die meisten Juden in Polen und den besetzten sowjetischen Gebieten, wo die Mehrheit der europäischen Juden lebte.«74
Mit den Massenerschießungen der Einsatzgruppen war Eichmann gleichfalls operativ nicht verbunden. Allerdings gingen im Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes die Berichte über die Massenexekutionen ein. Im Referat IV A 1 wurden die »Ereignismeldungen UdSSR« auf der Grundlage der Berichte erstellt, ab Mai 1942 sodann die »Meldungen aus den besetzten Ostgebieten«.75 Auch Eichmanns Referat (IV B 4) erhielt eine Ausfertigung. Fraglos standen der Chef des Amts IV des RSHA, Heinrich Müller, sowie sein Untergebener Adolf Eichmann gleichsam im informatorischen Zentrum der Shoah. Nicht umsonst ließ sich der von Himmler beauftragte Statistiker Richard Korherr von Eichmann Opferzahlen geben.
Anders als die Anklagevertretung ging im Fall Einsatzgruppen das Gericht dem prominenten Zeugen Michael A. Musmanno nicht auf den Leim. Der einstige Vorsitzende Richter des Nürnberger Nachfolgeprozesses gegen die Kommandeure der Mordeinheiten (Fall 9)76 stilisierte Eichmann zum Chef der Einsatzgruppen. Der Zeuge stützte sich auf Angaben Walter Schellenbergs77 (RSHA, Chef von Amt VI), der zusammen mit Eichmann an einer Zusammenkunft teilgenommen hatte, auf der die Kommandeure der vier Einsatzgruppen von Reinhard Heydrich und Bruno Streckenbach (Chef von Amt I des RSHA) Weisungen erhalten hatten.78
Musmanno, des Deutschen79 nicht mächtig, hatte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit Personen aus dem Umfeld Hitlers Gespräche geführt. Sein Auftrag war gewesen, Erkenntnisse über den Verbleib bzw. den Tod des Staatsoberhaupts des Deutschen Reiches zu sammeln.80 Das Gericht hielt die von Musmanno wiedergegebenen Feststellungen Schellenbergs für wenig zuverlässig und sah deshalb »aus Gründen der Vorsicht« davon ab, »Tatsachenfeststellungen auf dieser Version Schellenbergs aufzubauen«.81 Auf weitere Einlassungen Musmannos, Göring, Ribbentrop und andere hätten Eichmanns dominierende Rolle selbst Hitler gegenüber bezeugt, ging das Gericht gar nicht ein.82
Das Beispiel Musmanno-Aussage wurde hier angeführt, um die Leichtfertigkeit der Anklagevertretung einerseits, die durchaus kritische Aussageprüfung des Gerichts andererseits deutlich zu machen.