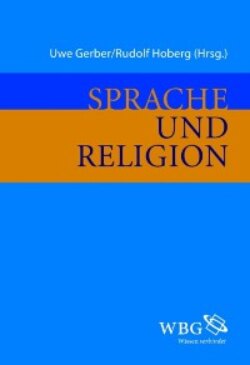Читать книгу Sprache und Religion - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sprache und Transzendenz
Оглавление1. Einleitung
Wie problematisch das Verhältnis von Sprache und Religion sein kann, ist uns heute wieder bewusst geworden angesichts der Sprache der Gewalt, die Hassprediger oder Terroristen mit Berufung auf die Religion verbreiten. Hier ist längst nicht nur Distanzierung gefordert, sondern die Kraft der Unterscheidung, die stichhaltige Gründe nennt, warum, wer sich auf eine erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen, auf die Erfahrung von Transzendenz bezieht, so nicht im Namen Gottes sprechen darf. Angesichts dieser Sachlage kommen wir heute nicht umhin, über das Verhältnis von Sprache und Religion neu nachzudenken.
Wir wenden uns im Folgenden der Frage nach dem Verhältnis von Transzendenz und Sprache zu und betrachten dieses unter zwei grundsätzlichen Aspekten:
1) Wir stellen zunächst die Frage: Führt überhaupt ein Weg von der Sprache zur Erfahrung von Transzendenz, und zwar in dem allgemeinen und grundlegenden Sinne, dass der Mensch selbst als sprechendes Wesen mit seiner Sprache an eine Grenze kommt und eine Grenz-Erfahrung macht? Dieser Frage gehen wir exemplarisch am Werk der Dichterin Ingeborg Bachmann nach.
2) Wir wenden uns sodann mit Emmanuel Levinas der ebenfalls grundlegenden Frage zu, ob Religion im weitesten Sinne nicht überhaupt als sinn- und bedeutungsstiftendes Sprachereignis zu verstehen sei, auf das alles menschliche Sprechen letztlich zurückverweist.
2. An der Grenze des Sagbaren
Der Mensch zeichnet sich vor allen anderen Wesen dadurch aus, dass er sprechen kann. Er ist das Sprache habende Wesen. Aber er besitzt die Sprache nicht wie ein Ding. Vielmehr eröffnet sich ihm Welt und Sein nur im Horizont seiner Sprache. In seinem Sprechen und seiner Sprache schwingen immer schon die Erfahrung und das Sprechen vieler Menschen mit, die ihn zum Sprechen ermächtigen und zum Antworten herausfordern. Nur indem er diese Herausforderung aufgreift und den ihm dabei zugespielten Raum an Möglichkeiten auslotet und für sich fruchtbar macht, kann der Mensch sich zu einer individuellen Existenz entwickeln. Von der Möglichkeit des Gelingen- oder Scheiternkönnens dieses Gesprächs hängt letztlich auch das Gelingen oder Scheitern der durch und durch dialogischen Existenz des Menschen ab. Sprache ist daher der Spiel-Raum der Freiheit und der Selbstüberschreitung des Menschen. Der Mensch als sprechendes Wesen hat sich in der Sprache immer schon überschritten und überschreitet sich beständig auf den Anderen hin, der ihn aus der Ferne der Überlieferung oder aus der Nähe menschlichen Sprechens anspricht.
2.1 Die Philosophie und die Grenze des Sagbaren
Dass der Mensch sich auch in der Sprache verirren, durch Sprache verführt werden, sich Wirklichkeiten vorgaukeln kann, wo nur Schein ist, veranlasste die Philosophie zu der Frage nach dem angemessenen Spielraum der Sprache und dem Zusammenhang von Sprache und Denken, sprachlicher Gestalt und der Sache, die die Sprache zum Ausdruck bringt.
2.1.1 Philosophie als Sprachkritik
„Alle Philosophie ist ‚Sprachkritik‘“1 , mit diesen Worten des frühen Wittgenstein lässt sich Antwort und zugleich der Wandel beschreiben, der sich in der philosophischen Methode des 20. Jahrhunderts ereignet hat und der im Allgemeinem mit einer Programmschrift R. Rortys als „Linguistic turn“ (1967) bezeichnet wird. Die sprachanalytisch orientierte Philosophie will Scheinprobleme, die durch Sprache verborgen werden, aufdecken. Nach Wittgensteins „Tractatus logico philosophicus“ (1984) hat die Philosophie den Zweck, Sätze klar werden zu lassen und zu zeigen, wenn man gewissen Zeichen in Sätzen keine Bedeutung beigelegt hat und keine Bedeutung beilegen kann, so dass man, d.h. der „Metaphysiker“, die Grenzen der Möglichkeiten von Sprache überschreitet.
Wissenschaftliche Sätze, an denen man sich vorzugsweise orientierte, wollen Sachverhalte beschreiben, mit denen sie sich auf Tatsachen beziehen. Wenn man von etwas redet, dann bildet man Sachverhalte mit der Sprache ab. Bringt man dadurch Wahres zum Ausdruck, dann bestehen diese Sachverhalte. Scheinsätze sind daher solche, bei denen entweder der behauptete Sachverhalt der Erkenntnis nicht zugänglich oder der Gegenstand der Rede tautologisch oder kontradiktorisch ist. Die Gesamtheit der wahren Sätze, d.h. derer die aufgrund empirischer und logischer Kriterien Bestand haben, beschreiben die gesamten wahren Tatsachen, d.h. die Welt; eine Erkenntnis, die Wittgenstein in dem berühmten, thesenhaften Merksatz zusammenfasst: „Die Welt ist alles, was der Fall ist. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.“ (1.11)
Damit ist nach Wittgenstein gleichsam „von innen“ her die Grenze des Sagbaren festgelegt. Denn es ist beschrieben, was die Welt ausmacht, und damit zugleich angezeigt, was nicht dazu gehört und wovon es daher auch keine sinnvollen Aussagen geben kann. Was nicht der Fall ist und niemals der Fall sein kann, das kann aus dieser Sicht auch nicht Gegenstand eines sinnvollen Satzes sein.
2.1.2 Sprache und Religion
In diesem Zusammenhang wurde dann Anfang des 20. Jahrhunderts im „Wiener Kreis“ die Frage laut, ob angesichts der Endlichkeit alles Endlichen ein konsistenter Begriff des Unendlichen, der dieses als den Grund und den Inbegriff von Sinn behauptet, überhaupt denkbar und damit auch aussagbar sei? Anders gesagt: ob Religion es also letztlich mit sprachlich geschickt verpackten Scheinproblemen zu tun habe und daher selber nur Schein sei. Religionskritik wird hier zur Sprachkritik. Sätze – so die sprachanalytische Fundamentalkritik des Wiener Kreises – in denen Gott vorkomme, seien sinnlos, denn sie setzten voraus, dass die Aussage ‚Gott ist‘ als sinnvoll ausgewiesen werden könne (vgl. Kreiner 2004, S. 53 - 68; Kreiner 2006, S. 173 - 222), was nicht der Fall sei, da es sich bei solchen Sätzen weder um synthetische, noch um analytische Propositionen handle (vgl. Ayer 1936).
Aus dieser Sicht ist es daher nur folgerichtig, dass von Gott und Religion nichts, zumindest nichts Sinnvolles gesagt werden kann. Ihnen fehlt der Tatsachenbezug. Tatsachen aber sind – z.B. durch Messung – exakt bestimmbar und, insofern sie messbar sind, auch in ihrer Bestimmung eingrenzbar und in diesem Sinne fassbar. Erkenntniserweiterung ist in diesem analytisch-empiristisch geprägten Denkhorizont nur dadurch möglich, dass (z.B. durch Verfeinerung der Messinstrumente) neue Wirklichkeitsbereiche, d.h. neue, messbare Sachverhalte erschlossen werden. Was logisch konsistent, d.h. kohärent und widerspruchsfrei, aber nicht messbar und in diesem Sinne verifizierbar ist, existiert für die Wissenschaften nicht.
Daher ist das, was über die Grenzen des so Bestimmbaren hinausgeht – das Transzendente –, kein Bestandteil der „normalen“ Welt, die wir erfahren können, und kann auch kein Bestandteil dieser Welt werden. Es ist un(aus)sagbar, zumindest muss die Sprache davor verstummen, denn – so ein weiterer thesenhafter Merksatz Wittgensteins - „die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“ (5.6); und zwar derart, dass nach Wittgenstein konsequent gilt und für den Umgang mit Sprache zu beachten ist: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“(7)
Hier wird also gleichsam von innen eine unerbittliche Grenze gezogen zwischen dem, was sagbar ist, und dem, was niemals Gegenstand einer sinnvollen Aussage werden kann, d.h. dem Unsagbaren.2 Damit nun aber wird den Religionen der sprachliche Boden und mithin jeder Anspruch auf Öffentlichkeit entzogen.
2.2 Sprachfindung als Grenzerfahrung
Die von Wittgenstein vorgeschlagene epistemologische „Selbstbeschränkung“ ist nun aber schon vonseiten der Wissenschaft keineswegs so evident, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Dies gilt einerseits nicht nur für die Tatsache, dass die All-Sätze der (empirischen) Wissenschaft(en) und auch die These, nur solche Aussagen seien sinnvoll, die sich verifizieren oder falsifizieren lassen, selbst nicht empirisch zu beweisen sind. Überdies geht aber die Wissenschaft stets über ihre einmal gezogenen Grenzen hinaus und bleibt nicht auf ein definitiv festgelegtes, epistemisches Koordinatensystem fixiert. Sie erweitert nicht nur ihr Wissen, sondern sie wechselt ihre Paradigmen, d.h. ihr Verständnis von Wissen und Wissenschaft selbst und verlagert daher auch ihre Denk- und Sprachgrenzen (vgl. Kuhn 1973).
Wie aber sind solche Grenzüberschreitungen, mit denen das Sagbare erweitert wird, möglich und wie geschieht die damit implizierte Spracherweiterung?
2.2.1 Die Sprache und die Erfahrung der Ohnmacht des Subjekts
Diese Frage der Grenze und der Sprachfindung hat – an Wittgenstein anknüpfend – die Philosophin und Dichterin Ingeborg Bachmann (1926 – 1973) ins Zentrum ihres Werks gerückt. Sie erteilt zwar den Sprachtheorien von Platon bis Nietzsche keine ausdrückliche Absage. Aber sie nähert sich dem Phänomen von Sprache und Sprachfindung nicht aus einer theoretischen Einstellung zur Sprache, sondern sie versucht, aus dem Vollzug des dichterischen Umgangs mit der Sprache diesen Vollzug selbst und die in ihm sich zeigenden Verweisungen zur Sprache zu bringen.
Für unsere Fragestellung ist in diesem Zusammenhang von Interesse: Dichtung bewegt sich in ihrem Umgang mit Sprache genau dort, wo Wittgenstein eine unüberschreitbare Demarkationslinie zieht: an der Grenze des Sagbaren. Sie setzt sich jener Erfahrung aus, vor der die sprachanalytische Grenzziehung ein ernüchtertes Denken schützen möchte oder dem sie sich zumindest nicht aussetzen will: dem Erleiden der Grenze, der Erfahrung des Versagens von Sprache oder dem Ringen um Sprache, in dem sich die Grenze des Sagbaren verschiebt.
Symptomatisch für diesen Grenzgang der modernen Literatur – und für Bachmann wegweisend – ist der sog. „Chandosbrief“ ihres Landsmanns Hugo von Hofmannsthal (1902). Hofmannsthal beschreibt das Ereignis von Grenze, das sich in der Spannung zwischen Sprachkrise und Sprachfindung3 ereignet, als ein „Hinüberfließen“ und bringt damit eine Welt ins Wort, „über die sonst ein Auge mit selbstverständlicher Gleichgültigkeit hinweggleitet“(Steiner 1976, S. 10)4
Der Dichter macht die Erfahrung, dass er nicht nach Belieben über die Sprache verfügen kann, dass sie sich ihm versagt, dass er mit ihr ringen muss. Die Grenzverlagerung, d.h. der Übergang zwischen der einen und der anderen Sprache, die in der Sprachfindung geschieht, ist nicht, wie Bachmann betont, eine Verlagerung der Grenze zwischen diesem oder jenem Seienden oder von im Grunde beliebig abrufbaren Sprachvarianten, sondern die Verlagerung der Grenze von Allem, und gerade von Welt als dem, „was der Fall ist“. Die „neue“ Sprache, um die Dichtung ringt, bringt nicht nur etwas Neues zu Wort, sondern sie bringt das Seiende selbst neu und so anders zu Wort, dass die eine Weise des Sagens nicht aus der anderen deduziert oder auf diese zurückgeführt werden kann. In diese Verschiebung, die im Ereignis von Sprache geschieht, wird der Mensch daher selbst mit hineingerissen.
Die Erfahrung der Unbeständigkeit von Sprache und ihres Fließens, von dem auch das Subjekt erfasst wird, ist die negative Seite der Erfahrung von Grenze, die die Sprache dem Sprechenden zumutet. Hier erlebt die Dichterin die Macht der Sprache und die Ohnmacht des Subjekts, das sich die Sprache nicht unterwerfen kann und dessen Herrschaft sich die Sprache nicht fügt. Sie erlebt die Widerständigkeit der Sprache und die Begrenztheit ihrer Ausdruckskraft, die sich ihrem Verfügenwollen nicht unterwerfen. Gegen diesen Widerstand der Sprache vermögen Vernunft und Wille nichts. Ihn kann man nicht theoretisierend überspringen. Die Dichterin muss ihn hinnehmen, sie muss ihn erleiden und kann nur darauf hoffen, dass an der Grenze des Sagbaren das Unsagbare sich öffnet und neue Weisen des Sagens freigibt, die die Wirklichkeit in anderer Weise einteilen.5
Was sich in solchen Erfahrungen zeigt, ist das Unverfügbare von Sprache selbst. Dem sprechenden Wesen Mensch wird in dieser Erfahrung von Grenze die ganze Zwiespältigkeit und Fraglichkeit seines Daseins bewußt. Der Mensch ist einerseits das Wesen, das Seiendes benennen kann. Ihm wird damit bewusst, dass es Anderes ist als er selbst und dass er selbst nicht in seiner Welt aufgeht. Der Sprechende kann aber andererseits weder von einem absoluten, gleichsam divinatorischen Standpunkt aus, von oben herab oder von außen, auf das Ganze seiner Welt blicken. Er ist nicht „Herr“ der Sprache, sondern lebt immer schon im „Haus des Seins“.
2.2.2 Der Sprechende als Austragungsort des Geschehens von Sprache
Das „Subjekt“ ist nicht bloß Zuschauer, sondern Austragungsort dieses Geschehens von Sprache und damit der jeweiligen Entdecktheit von Welt selbst. Der Mensch steht gerade nicht diesseits oder jenseits der Grenze, sondern ist mit seiner ganzen Existenz als Sprachwesen das Wesen oder der Austrag von Grenze: „metaphysisches Subjekt, nicht mehr Teil der Welt, sondern ‚Grenze’“ (4, 20 - 21).6
Im Schlummer einer ersten Naivität mag er seine Herrschaft über das Seiende durch die Sprache, die es ihm erlaubt, Seiendes benennbar und damit auch berechenbar und verfügbar zu machen, auskosten. Aber irgendwann drängt sich ihm die Frage auf, ob sich ihm die Dinge in seiner Art, sie sprachlich zu erfassen, wirklich fügen und ob er damit Anderem gerecht wird. Tun wir den Dingen, indem wir sie benennen, nicht immerfort Gewalt an? Werden sie durch Sprache nicht entstellt oder vergewaltigt? Ist die Sprache die Quelle der Gewalt und am Ende – wie Nietzsche mutmaßte – all unser Benennen nur ein sinnloser Konstruktivismus über dem Abgrund einer endlosen Leere, die alles verschlingt? Hier wird die Sprache selbst und in eines damit der Mensch sich selbst zur Frage.
Erst wer die Sprache auch von dieser Seite, wer sie als Fluch und Gefängnis, dem keiner so leicht entkommt, oder auch, wie Malina als „Strafe“ (3, 97) zu sehen lernt, hat das ganze Ausmaß der Sprachlosigkeit und Fraglichkeit, das den Menschen als Wesen der Grenze ausmacht, erfasst.
2.2.3 Sprache – Wahrheitsereignis – Transzendenz
Aber gerade hier macht der Dichter andererseits auch eine positive Erfahrung, die freilich nicht vorwegzunehmen ist. Er erlebt „in der Sprachfindung selber die Erfahrung, dass er von der Ungeheuerlichkeit und Unerhörtheit der Wahrheit einer neuen Sprache ‚geraubt wird’ (4, 23). [...] Der Dichter und jeder ursprünglich Sprechende machen die Erfahrung, dass die Grenze als Grenze der Sprache, die zunächst eine unaufhebbar festzuliegende scheint, durch von sich selbst gebender neuer Erfahrung der Wirklichkeit im ganzen überschritten wird.“(Casper 1983, S. 253f.)
Dieses ereignishafte „Hinausgeführtwerden“ über die Grenzen der Sprache wird von Bachmann einerseits als Akt der Befreiung, als Durchbrechen des Netzes meiner Intentionalität, mit dem ich das Seiende zu fassen versuche, beschrieben und zugleich als Aufleuchten der Schönheit, als die Unmittelbarkeit einer Nähe zu dem, was einem die Sprache verschlägt und „neue Fassungskraft“ (4, 192) schenkt.
Hier ist freilich nicht jener Akt postmoderner Ästhetisierung des spielerischironisch um sich selbst kreisenden Subjekts gemeint, das zu neuen Ufern aufbricht und doch immer nur bei sich selbst ankommt. Hier kommt etwas zum Aufscheinen, was sich gar nicht in die Synchronie meines Verstehenshorizontes und Sprechenkönnens fügt und diesen immer bloß in die Zeit einer schlechten Unendlichkeit verlängert.
Es hat vielmehr die Kraft, diese aufzubrechen und sie dadurch für die „je größere Wahrheit“ und für die Andere Zeit7 zu öffnen. In ihrer Frankfurter Vorlesung spricht sie daher auch von einem „moralischen Ruck“, den der Dichter erfährt oder von „einer Moral vor aller Moral.“ Das Aufscheinen von Wahrheit als Ereignis geschieht als Diskontinuität, als Verwundung, Verrückung oder Veränderung und zu allererst als Gabe von Zeit und (neuer) Sprache. Ihm wird man nur gerecht, wenn man sich mit seiner ganzen Existenz davon ergreifen, sich, seine Sprache und seine Art und Weise, da zu sein, verändern lässt.
Hier kann sich der Sprechende nicht mehr draußen halten und die Grenzen der Sprache bloß feststellen. Hier muss er eine Entscheidung treffen, hinter die es so leicht kein Zurück mehr gibt. Diese impliziert, dass man sich selbst verändert, um auf eine neue, aus dem Vorherigen und Gängigen nicht ableitbare Weise da, d.h. in der Welt und beim Anderen, zu sein und von der Wahrheit in seinem Sprechen Zeugnis zu geben. Jeder bloß dahergesagten Rhetorik, jedem nur aufgeputzten Manierismus und dem gängigen „Bimbam von Worten“ gegenüber gibt Bachmann zu bedenken, dass es daher keinen gibt, „der nicht unterschreibt.“ (1, 166)
Vom dichterischen Ereignis des Seins, das an den Ursprung von Sprache und Zeit rückt, zeugt die neue Fassungskraft der Sprache, auch wenn der Dichter das Ereignen von Wahrheit, das als Schönheit geschieht, nie ganz ins Wort zu bringen vermag. Denn: Tut er es, so tritt doch mit dem Sprechen unvermeidlich auch das Subjekt wieder in den Vordergrund. Spricht es, so braucht sein Sprechen selber wieder Zeit. In diesem Verstreichen von Zeit aber wird das Ereignis der Wahrheit (des Unsagbaren) zur Er-Innerung. So erfahren wir, dass mit jedem Versuch, es fassen zu wollen, das Ziel, „wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt.“ (4, 276) Es wird geborgen in Sprache und entzieht sich dabei doch zugleich in seiner Unmittelbarkeit dem Zugriff der Sprache und der Versuchung, sich ihrer zu bemächtigen. Nur „im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten“ (4, 276). Ihre Wirklichkeit erweist die Wahrheit allenfalls als lebendige und „gefährliche Erinnerung“: im Aufsprengen verengter Horizonte und in der verheißungsvollen Kraft der neuen Sprache, die einer neuen, gerechteren und wahrhaftigeren Praxis den Weg spurt.
2.2.4 Das Ereignis von Sprache und der Vorgriff der Vollendung
Die neue Sprache, mit der das Werk der Dichtung der alten Sprache begegnet und diese aufsprengt, ist also selbst der Ort, an dem sich die Spannung zwischen dem Sich-Ereignen von Wahrheit und der Entscheidung des Schreibenden, mit seiner Existenz und Freiheit in dieses Ereignis einzutreten und sich verändern zu lassen, zur Darstellung kommt.
Sie reißt die ganze Spannung der dichterischen Existenz auf, die vom Ereignis der Wahrheit zum Sprechen ermächtigt, mit der neuen Sprache auf die erfüllte Zeit und gegen die Beharrungskraft der schlechten Sprache auf eine neue Praxis verweist. Die neue Sprache ist daher der immer neu unternommene Versuch der Realisierung je größerer Gerechtigkeit, die dem unendlichen Anspruch verfügt bleibt, auch wenn sie immer wieder daran scheitert. Das Sprachgeschehen weist von sich aus über sich hinaus auf die Erfüllung des ihm im letzten freilich entzogenen unendlichen Sinns und umfassend gelingender Praxis. An ihr muss sie sich messen lassen, damit sie nicht ins Spiel ästhetischer Beliebigkeit, dogmatischer Selbstbehauptung oder existenzieller Belanglosigkeit umkippt. Die neue Sprache ist daher auch Ausdruck der „sittlichen Form“, die in der Sprache nicht darstellbar ist, auch wenn sie deren Spuren trägt.
Diese Interpretation Wittgensteins, „der gemäß das [...] selbst von der Sprache nicht Darstellbare für die Sprache nicht nur die logische, sondern auch die sittliche Form sei“, hat B. Casper zu Recht als „die entscheidende eigene These der Bachmann über den Ursprung von Sprache“ bezeichnet. „Die Erfahrung der sittlichen Form, die in der Sprache – auf unsägliche Weise – Wirklichkeit ist, bedeutet zugleich die Erfahrung der Grenze des Sprechenden. Aber diese Erfahrung von Grenze ist eine andere als die der bloßen Unaussprechlichkeit der logischen Form. Denn die logische Form lässt das zuschauende und die Welt abbildend zur Sprache bringende Subjekt draußen. Die Erfahrung der Unsäglichkeit der sittlichen Form hingegen betrifft das sprechende Subjekt selbst. Sie wirft es auf ein Sich-Rechtfertigenmüssen, welchem der Sprechende nie ganz gewachsen ist. Dies erkennt er in einem mit der Wahrnahme dieses Sich-Rechtfertigenmüssens, d.h. wiederum der undarstellbaren sittlichen Form, die ihn schon in Anspruch nimmt. [...] Dies könnte man auch die Verantwortlichkeit des Daseins nennen.“(Casper 1983, S. 256f.)
2.2.5 Dichtung als „Nachahmung“ der Sprache, die „noch nie gesprochen worden ist“
In der neuen Fassungskraft der Sprache aber bleibt eine Spur davon erhalten. Dichtung hat einen ganz grundlegenden, mimetischen Zug. Das Wort der Sprache kann nämlich verstanden werden als Antwort auf das Ereignen von Wahrheit oder das Geschehen dieses Widerspiels an der Grenze des Sagbaren im Verstreichen der Zeit. Die neue Fassungskraft der Sprache verdanke sich „der Nachahmung [...] dieser von uns erahnten Sprache, die wir nicht ganz in unseren Besitz bringen können.“ (4, 270 – 271) Auch die neue Sprache also kann immer nur „Nachahmung“ jener Sprache sein, die „noch nie gesprochen worden ist.“ (4, 186 – 187)
Was sich im Durchlaufen der Sprachkrise für den Sprechenden im Hinblick auf seinen Umgang und sein Wissen um Sprache verändert hat, ist dies: dass der Sprechende nun um die Grenzen seines Sprechens und um den Geschenkcharakter der Sprache weiß. Er weiß darum, dass er nicht Herr der Sprache ist, sondern mit seinem Sprechen immer schon eingerückt ist in eine menschliche Freiheit ermöglichende und tragende Bewegung, die sich immer neu als Freisetzung von Freiheit und als die Gabe neuer Sprache zuträgt und deshalb durchaus soteriologischen Charakter hat. In immer neuen Anläufen wird bei Bachmann das Unsagbare – auch mit religiösen Metaphern – benannt oder umkreist und bleibt doch unaussprechlich: die „Wirklichkeit“, die „ganze Sprache“, „das Vollkommene, das Unmögliche, das Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jener reinen Größe“ (4, 276). Darin geht Bachmann durchaus über Wittgenstein hinaus und sagt mehr. Denn „dieses äußerste Herausgefordertsein des Sprechenden ist überhaupt nur sinnvoll und insofern denkbar, wenn die äußerste Sprachfügung [...] zumindest erhofft werden kann.“ (Casper 1983, S. 260)
Die Sprache kommt aus dem unsagbaren Ursprung der Zeit und rührt an diesen. Sprachfindung geschieht auf dieser „Zeitenschwelle“, die die Dynamik offen legt oder aufscheinen lässt, worum es aller Geschichte geht; was letztlich selbst wieder nicht in Sprache ganz zu fassen ist. Allenfalls ist es „da“, als das Unfassbare und Unsagbare, als Ausgriff auf „die Sprache, die noch nie regiert hat“ und alles Sprechen von innen her bewegt.
3. Religion als Ursprung der Sprache und als Sprach-Ereignis
Gegenüber dem Verdikt der sprachphilosophischen Religionskritik hat Bachmann gezeigt, dass all unser Sprechen immer schon im Vorgriff auf jene Sprache steht, die „noch nie gesprochen“ worden ist, die aber in jedem Sprechen unausgesprochen mitschwingt. In jedem Sprechen schwingt immer schon unausgesprochen eine Sprachhoffnung mit, die den Sprechenden in Anspruch nimmt, von der allerdings bei Bachmann offen bleibt, ob diese letztlich erfüllbar ist oder im Utopischen verschwelt. Hier war es vor allem der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas (1906-1996), der über das Verhältnis von Transzendenz und Sprache weiter nachgedacht hat und die sittliche Form der Sprache, die uns in ihrer Unsäglichkeit immer schon in Anspruch nimmt, ausdrücklich in den Mittelpunkt seines Denkens gestellt hat. In unserem Zusammenhang von Interesse ist daher die Verhältnisbestimmung von Sprache und Religion, die Levinas in seiner Neugründung der Ontologie und der Sprache durch die Ethik unternimmt (vgl. Müller 1997).
Levinas geht also im Hinblick auf die Bestimmung des Religionsbegriffs ausdrücklich von der Erfahrung des Anderen aus. Er legt damit die Grundlage für ein vertieftes Verständnis von Sprache und Religion, das sich jenseits der Totalisierungen des vorstellenden Denkens der abendländischen Metaphysik situiert und dessen Gewaltsamkeit unterläuft; ein Aspekt, der gerade angesichts des heute wieder zu Tage tretenden Gewaltpotentials von Religion von zukunftsweisender Bedeutung ist.
Nach Levinas, dessen Philosophie von der Erfahrung der Shoa in Atem gehalten wird, ist die ganze okzidentale Denkgeschichte dadurch gekennzeichnet, dass sie dem Verhältnis zum Anderen nicht wirklich gerecht geworden ist. Das Scheitern der abendländischen Denkgeschichte vor der Herausforderung des Anderen gilt nach Levinas auch noch für das seinsgeschichtliche Denken Heideggers. Heidegger hatte zwar gegen Husserl geltend gemacht, dass die Einfühlungstheorie – als Versuch, das Fremde zu verstehen – dem Anderen nicht gerecht wird, weil sie ihn zu einer Doublette meiner selbst degradiert. Was die Einfühlungsthese – im Gefolge eines unkritisch angeeigneten Erbes der romantischen Schule – übersieht, ist, dass sie den Anderen, indem sie ihn als meinesgleichen denkt, auf die Endlichkeit meiner Vorstellungen vom Anderen reduziert.
Levinas radikalisiert diese Kritik noch einmal. Denn nach Levinas bleibt auch in der Philosophie Heideggers der Primat des Selben über das Andere erhalten. Obwohl Heidegger das Ich als sterbliches Ich – als Sein-zum-Tode – erkannt hat, behält es seine dominante Stellung, die es als das Selbe innehat. Der Tod wird ihm gerade nicht zur Erfahrung der Infragestellung des Ich, sondern zur Bestätigung seiner Macht. Hier bleibt, wie im gewöhnlich alltäglichen Verständnis, das Ich „Subjekt“ des Sprechens. Dieses Subjektsein, das im Sprechen als Thematisierung, Präsentation und Re-Präsentation zum Ausdruck kommt, hat die Rückkehr meiner zu mir selbst zum Inhalt. Es zeigt sich in meinem Bestreben, das Sein des Seienden in die Gegenwart (m)einer Rede (vgl. AQ8 , S. 179) einzuholen und gibt sich daher in erster Linie zu erkennen als sich im Widerspiel von Noesis und Noema entfaltende Intentionalität, die auf Synchronisation zielt. Hier reduziert das vorstellende Denken die Komplexität der Welt auf die vergegenwärtigende Sprache der transzendentalen Einheit des Ich.
Dieser auf den ersten Blick nicht hintergehbare Modus des Sprechens erweist sich bei genauerem Hinsehen, so die These von Levinas, als abkünftiger und darüber hinaus als defizitärer Modus des Sprechens.
3.1 Die An-Archie der Sprache und die Erfahrung des Unbedingten
Die grundlegende Situation, von der Levinas ausgeht und die er phänomenologisch in immer neuen Anläufen zu erhellen versucht hat, ist die jedem nachvollziehbare Situation angesichts des anderen Menschen. Die Erfahrung des Anderen als Anderen ist eine alltäglich zu bestehende Herausforderung für unser Verstehen und unseren Umgang miteinander, denn der andere Mensch bleibt uns bei aller Nähe, in die wir vielleicht zueinander kommen, immer auch unbegreiflich. Sein Andersein zeigt sich gerade darin, dass es sich nicht als „meinesgleichen“ vereinnahmen lässt, sondern sich uns immer schon, wenn auch nicht total, entzieht. „Der Andere ist weder das alter ego, noch der Fremde, zu dem ich keine Beziehung habe.“ (Sundermeier 1996, S. 133) Diese Erfahrung ist nicht eine unter anderen. Sie ist das ursprünglichste Verhältnis, in dem sich der Mensch befindet.
Im Angesicht des Anderen findet sich das Subjekt in einer Situation vor, in der ihm etwas begegnet, dessen es nicht mächtig ist und das sich nicht in die Kategorien einer egologischen Intentionalität einholen lässt. Aufgrund dieses Widerstand des Identifiziertwerdens ist das Subjekt gezwungen, sich der Erfahrung des Anderen zu stellen: seinem Anspruch, es als es selbst sein zu lassen und als solches nicht zum Schweigen zu bringen. Diese Erfahrung, die mich vom Anderen her anspricht, noch vor jeder Verlautbarung seinerseits, ist gebietend. Sie sagt mir vom Anderen her: „Töte mich nicht!“
Die Initiative geht dabei vom Anderen aus. Was sie von mir fordert – und damit kriteriologisch als Bedingung der Möglichkeit gelingender Begegnung offen legt – ist dies: die Widerständigkeit des Anderen gegen das Identifiziert- und Festgelegtwerden auszuhalten, dem „Antlitz“ nicht auszuweichen, sondern sich von ihm und seiner Verwundbarkeit und Sterblichkeit stellen zu lassen und zu antworten.
Der Versuch, diese Erfahrung von Alterität, die im Antlitz des Anderen aufscheint (Widerstand, Ohnmacht, Appell an meine Verantwortung), entweder zu leugnen oder im Gange eines dialektischen Erkenntnisfortschritts aufheben zu wollen, hieße, den Anderen in seiner Ursprünglichkeit und Wahrheit als Sprechenden zum Schweigen zu bringen, ihn zu töten9 und meiner Verantwortung angesichts seiner nicht gerecht zu werden. Sie wäre nach Levinas der ontologisch gegründete Akt der Gewalt, noch vor dem faktischen Kampf gegen den Anderen.
Indem ich den Anderen zum Verschwinden bringe, werde ich ihm gerade nicht gerecht. Vielmehr weiche ich der über mich hinausgehenden größeren Wirklichkeit, die sich mir darin bekundet, aus. So aber bleibe ich in einer Welt gefangen, die für mich beherrschbar zu sein scheint, aber letztlich doch leer und unwirklich, da eine Welt ohne Alterität ein narzistischer Monolog ist.
Dieses Verhältnisses zum Anderen kann ich mich nicht noch einmal von außen versichern; ich kann es nicht objektivieren. Daher belässt Levinas es methodisch und geltungslogisch bei einer phänomenologischen Deskription und verzichtet ganz bewusst darauf, nach den subjektiven Bedingungen der Begegnung mit dem Anderen zu fragen und diese als notwendig für gelingende Freiheit auszuweisen.10
Das Verhältnis zum Anderen als Anderem ist nur dann gegeben, wenn ich in es eintrete und mich durch den Anderen verändern lasse. Diese je größere Wirklichkeit erschließt sich mir nur in der und als diese Beziehung selbst und der mir damit aufgegebenen Wahrnehmung der Verantwortung für den Anderen. Indem ich aus mir herausgehe, auf die „Stimme“ des Anderen antworte und ihn anspreche, trete ich in dieses Verhältnis ein, anerkenne seine von mir unableitbare Würde und verpflichte mich auf die Integrität seiner Alterität. Daher ist das Sprechen und Denken, das sich angesichts des Anderen vollzieht, notwendigerweise ethisch bestimmt. Daran, ob ich in diesem Sinne Verantwortung übernehme, dass ich mich, dem Anspruch des Anderen antwortend, auf ihn einlasse und das Verhältnis als solches von mir her da sein lasse, wird erkennbar, ob es mir wirklich um den Anderen geht und ob ich mich öffne für die mit dem Anderen auf mich zukommende je größere Wirklichkeit.
Der Herausforderung, vor die der Andere mich stellt, kann ich also nur gerecht werden durch „eine Umkehr meiner Intentionalität“ (DE 196), in der sich auch mein Sprechen verwandelt. Erst vor dem Antlitz des Andern und seinem Gebieten aber kommt die Sprache an ihren Ursprung. Denn das Antlitz zeigt sich hier als Sprechen. Sprechen ist letztlich kein Akt meiner Selbstherrlichkeit, der auf der Ebene des Verstehens anzusiedeln ist, sondern – als Sprechen-zu – ein an-archischer Akt, „relation an-archique“ (AQ 201): Ein Mich-Überschreiten auf den Anderen hin ohne Rückkehr, Durchbrechen narzistischer Selbstreflexivität, Re-Aktion auf eine Verwundung des „ego cogito“ durch den Anderen. „Sprechen geschieht, weil ich den Anspruch des Anderen erleide und ihm antworten muß. [...] Es geschieht als eine Darreichung des dire in der Gabe des dit. Die Veränderung, die in der Verleiblichung meines Sprechens geschieht und in dem Zwang, sich in schon vorliegender Sprache auszusprechen, erweist sich als ein Moment jenes Über-mich-Hinausgehenmüssens, das ich erleide, weil es den Anderen gibt.“(Casper 1992. S. 19)
3.2 Sprache und Religion
Der entscheidende Punkt in der Begegnung mit dem anderen Menschen im Hinblick auf die Erfahrung des Unendlichen ist der, dass der Andere sich meinen Versuchen, ihn auf die Ordnung des Seins, des Bewusstseins und des Verstehens zu reduzieren, entzieht. Im Antlitz des Anderen tritt mir ein absoluter Widerstand gegen das Vereinnahmtwerden durch mich gegenüber, der zwar gewaltlos ist, aber gleichwohl von einer Mächtigkeit, vor der ich kapitulieren muss. Denn wenn ich den Anderen nicht als Anderen sein lasse, sondern ihn unter die Macht meiner Vorstellungen zu bringen versuche, dann bringe ich gerade seine Anderheit zum Verschwinden. Sie leistet dem Identifiziertwerden durch mich absoluten Widerstand, indem sie sich mir entzieht. Diese absolute Widerständigkeit gegen die identifikatorische Vereinnahmung ist ein Hinweis oder eine Spur auf etwas, das den Bereich des Endlichen überschreitet, da es außerhalb von jedem sinngebenden und ergreifenden Verstehen bleibt. Das Unendliche geht das Endliche an, ohne doch von ihm ergriffen werden zu können. In der Unbedingtheit, mit der das Gebieten des Antlitzes mich vom Anderen her anspricht, werde ich mit einer Mächtigkeit konfrontiert, die nicht aus dem Endlichen ableitbar ist.
Levinas qualifiziert dieses Verhältnis daher als ein geradezu religiöses und spricht daher in diesem Zusammenhang ausdrücklich von Religion. „Diese Verbindung mit dem Anderen, die nicht auf seine Vergegenwärtigung, sondern auf seine Anrufung zurückgeführt wird, wobei der Anrufung kein Verstehen vorausgeht, nennen wir Religion. Das Wesen der Religion ist Gebet.“ (SA 116)
Wenn Levinas in diesem Zusammenhang von Religion spricht, dann möchte er auf drei grundlegende Sachverhalte hinweisen, die das Verhältnis zum Anderen offenlegen:
dass das Verhältnis zum Anderen nicht auf Verstehen zurückführbar, sondern bleibend ein Verhältnis zum Anderen meiner selbst ist, dem ich nur gerecht werden kann, wenn ich in das ethische Verhältnis eintrete. Damit aber hängt dann notwendig zusammen,
dass das religiöse Verhältnis „eben dadurch von der Ausübung von Macht entfernt“ (SA 115) und
dass in allem Sprechen Gott mitspricht, insofern alles Sprechen auf einen unbedingten Anspruch zurückverweist, der Gerechtigkeit und Güte gebietet und der weder aus mir oder dem Anderen, d.h. der Endlichkeit des Endlichen, ableitbar ist.
Es geht also nie nur darum, dem faktisch Anderen gerecht zu werden, sondern in eins damit je immer schon auch dem Unbedingten, das hier gebietet, also jenem Un-Endlichen, das das Endliche angeht, ohne ergriffen werden zu können, jenem „Dritten“, das nicht Gegenwart wird, sondern als ethisches Gebieten oder Fordern, als Appell an Freiheit zur Sprache kommt und sich mir entzieht. Im Verhältnis zum Anderen trete ich also nicht nur in Bezug zu einem faktisch Anderen, sondern treffe darin zugleich auf einen unbedingten Anspruch, der das Verhältnis zum Anderen als einem Abwesenden und damit das Sprechen überhaupt erst konstituiert. Denn gerade diese Entzogenheit, dieses Sich-nicht-von-mir-Festhalten-lassen ist es, die seine Absolutheit, Herrlichkeit und Göttlichkeit manifestiert.
Erst durch diese Entzogenheit des Absoluten ist ein Verhältnis zum Anderen als solchem und damit Gemeinschaft möglich. Es stiftet den Bezug nicht nur zwischen dir und mir. Denn die Bewegung zwischen mir und dir richtet sich schon immer auf ein Unendliches, das immer das Andere jeder Erfüllung und jeden Stillstandes ist. Dasjenige, was über jede denkbare Erfüllung hinaus immer weiter gesucht werden kann, ohne dass je eine Sättigung des Suchens eintritt, kann aber nur das sein, was für alle das Gute ist. Das Suchen nach dem Guten aber kann man bezeichnen als die Bewegung oder Haltung der Güte.
Trotz seiner Unabweisbarkeit oder gerade wegen ihr, trotz der Unmöglichkeit das Sprechen Gottes festzuhalten, ist es keine Fiktion, keine Willkür, keine Projektion. Gottes Sprechen erweist seinen Ernst, sein Gewicht, seine unerschütterliche Festigkeit in dem, was es sagt, in seinem Inhalt: Es gebietet Güte zum anderen Menschen. Religiöses Reden und Denken, das diesem Standard nicht gerecht zu werden vermag, kann sich nicht wirklich darauf berufen, Zeugnis jener Wirklichkeit zu sein „quo maius cogitari nequit“. Erst auf dieser Basis, die früher ist als die Gemeinsamkeit, ist die Entdeckung von Entsprechungen möglich.
Dadurch dass Gott dem Menschen das Sich-mitteilen-Können mitteilt, erschafft er ihn. Indem aber der Mensch auf dieses schöpferische Sich-Mitteilen Gottes antwortet und das Sich-Mitteilen im Umgang mit dem Nächsten als Sprechen zu, das die Anderheit des Anderen wahrt (Gebet), vollzieht, wird ihm Gott selbst offenbar.
Damit weist Levinas auf die grundlegende Dimension von Religion hin, die jeder geschichtlich-kulturellen Ausprägung von Religion als Ausdruck und Vollzug der Anerkennung und des Verdankens meines Sprechenkönnens und Sprechendürfens und -müssens zugrunde liegt.
Religion geht nie nur darin auf, tradierte Lebensform oder Begegnung mit dem faszinierend Sakralen zu sein. Diese Betrachtungen von Religion sind zwar nicht falsch, aber dem Wesen der Religion insofern äußerlich, als sie noch als eine Stufe der Selbst- und Daseinssicherung verstanden werden können, die der Transzendenz des Anderen nicht gerecht werden. Wenn man das religiöse Verhältnis von Sprache und Religion ernst nimmt, dann kann man dem darin sich zeigenden Absoluten nur gerecht werden, indem man sich unter seinen Anspruch stellt und diesen als Ethik im Sprechen vollzieht. Das schließt den Gewaltverzicht ein.
Da wir aber leibliche Wesen sind, ist auch das religiöse Verhältnis auf Versprachlichung angewiesen. Es ist niemals ein für alle Mal da, sondern hat sich im Sprechen zum Anderen stets neu zu bewähren. Dadurch aber wird der Anspruch ein Gesagtes. Dies bringt eine doppelte Gefahr mit sich: Das, was sich im Modus des Weltverstehens und der Sprache einer Zeit auslegt, neigt dazu, sich in Sprache zu verfestigen und abzukoppeln vom religiösen Verhältnis und der sich darin anzeigenden Rede. Religion steht daher „von sich her wesentlich in der Versuchung, ihr Gesagtes in der Abgeschlossenheit und Beherrschbarkeit seines Gesagtseins zum ein für alle Mal Gesagten, zum ‚letzten Wort’ als zu einem abgeschlossenen Vorliegenden, woran man sich nun in alle Zukunft zu halten hat, zu machen.“ (Casper 1992. S. 24).
Dies gilt auch für Schrift, die das Gesagte dadurch, dass es situativ entbunden und vom Kontext unabhängig wird, überlieferbar macht. Durch diese Herauslösung aus dem lebendigen Geschehen des Angesprochenseins (traditio) wohnt ihr aber immer auch ein Zug zur Konservierung und Abstraktheit inne.
Wenn aber das, was die Heiligen Schriften zur Sprache bringen, aus seiner Zeitlichkeit „oder aus dieser seiner im sich Zutragen der Übersetzung geschehenden Rückstellung in die Zeitigung von Sprache gelöst und als für sich Bestehendes behauptet [wird], so wird es zum Idol, nämlich zum vermochten ‚Unendlichen’, d.h. zu dem vom Menschen in die verfügende Hand genommenen Unbedingten.“ (Casper 1992. S. 25).
Vor solchen Funktionalisierungen sind Religionen niemals gefeit. Religionen können daher auch zu sublimen Formen der Selbstbehauptung entarten, wo in ihnen das Verhältnis zum Anderen als dem Anderen negiert, objektiviert oder wo der Andere zum Befehlsempfänger und der unbedingte Anspruch Gottes im Sprechen zum Idol degradiert wird. Das macht zutiefst ihre Ambivalenz aus. Denn das Ich wird ja angesichts des Anderen immer wieder mit seinen Grenzen und mit seiner Endlichkeit konfrontiert, die es zwingt, sein Sprechen und Denken kritisch zu hinterfragen, ob es dem Anderen entspreche und ob es überhaupt den Anderen als Anderen sprechen lasse, d.h. Sprechen sei oder nur Monolog und ihn so in eine Krise bringt. Demgegenüber kommt alles darauf an, dass „diese Fleischwerdung offen bleibt für das transzendierende Verhältnis selbst, das sich in ihr vollziehen will“(Casper 1992. S. 26). Religion und Ethik sind daher nicht voneinander zu trennen.
„Nur so degradiert man den Andern nicht als „Zwischenstation“ auf dem Weg zum eigentlichen Gegenüber. Nur so wird er mir nicht der ‚notdürftige Ersatz für eine verfehlte Gegenwart‘ (GD 19), sondern ist als er selber gemeint. Und nur so wird Gott nicht zu einem letztendlichen Objekt, also von mir verendlicht, sondern erscheint – meine Kategorien sprengend – als der Heilige in seiner Herrlichkeit. Nur im rücksichtslosen Abschied von mir auf den Anderen hin komme ich zu Gott (Adieu – à Dieu – GD 165 –).“(Splett 1994)
Literatur
Ayer, Alfred 1936: Language, Truth and Logic. New York (Dover).
Casper, Bernhard 1983: Die Grenze der Sprache. Überlegungen zum Werk Ingeborg
Bachmanns. In: Koschel, Christine/Weidenbaum, Inge von (Hrsg.): Kein objektives
Urteil – nur ein lebendiges. München (Piper), S. 249 – 265.
Casper, Bernhard 1992: Die Genese des Sprechens im Übersetzen. In: Archivo di Philosophia, S. 15 – 26.
Koschel, Christine/Weidenbaum, Inge von/Münster, Clemens (Hrsg.) 1978: Ingeborg
Bachmann, Werke. München (Piper).
Kreiner, Armin 2004: Wahrheit und Perspektivität religiöser Rede von Gott. In: Dalferth,
Ingo U./ Stoellger, Philipp 2004: Wahrheit in Perspektiven. Probleme einer offenen
Konstellation. Tübingen (Mohr Siebeck), S. 53 – 68.
Kreiner, Armin 2006: Die Geltung des Gottesbegriffs. In: Kreiner, Armin 2006: Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen. Freiburg (Herder), S. 173 – 222.
Kuhn, Thomas 1973: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt (Suhrkamp).
Levinas, Emmanuel 1974a: Autrement qu‘ être ou au-delà de l‘ essence. La Haye (M. Nijhoff).
Levinas, Emmanuel 1974b: En découvrant l‘ Existence avec Husserl et Heidegger. Paris (Librairie philosophique J. Vrin), 3. Aufl.
Levinas, Emmanuel 1983: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Freiburg – München (Alber).
Levinas, Emmanuel 1985: Wenn Gott ins Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Freiburg/München (Alber).
Müller, Andreas 1997: Von Gott sprechen nach Auschwitz. In: Müller, Andreas u.a. (Hrsg.). Denkend vom Ereignis Gottes sprechen. Die Bedeutung der Philosophie in der Theologie. Freiburg i. Br. (Verl. d. Kath. Akad. d. Erzdiözese Freiburg), S. 79 – 104.
Rorty, Richard 1967: The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method. Chicago.
Schwind, Georg 2000.: Der Andere und das Unbedingte. Anstöße von M. Blondel und E. Levinas für die gegenwärtige theologische Diskussion. Regensburg (Pustet).
Splett, Jörg 1994: Gotteserfahrung im Antlitz des Anderen? In: Münchener Theologische Zeitschrift 45, S. 1 – 49.
Steiner, Herbert (Hrsg.) 1976: Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Prosa II. Frankfurt (S. Fischer), S. 7 - 20.
Sundermeier, Theo 1996: Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).
Wittgenstein, Ludwig 1984: Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt a.M.
Wright, Georg Henrik von (Hrsg.) 1969: Wittgenstein, Ludwig: Brief an Ludwig von Ficker. Salzburg (O. Müller).