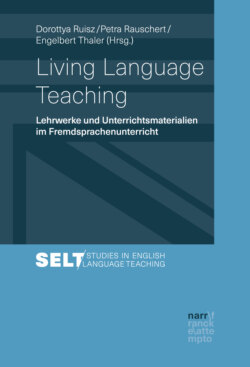Читать книгу Living Language Teaching - Группа авторов - Страница 17
2 Vier Gründe für Storytelling in der Sekundarstufe I
ОглавлениеDa Storytelling und in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Arbeit mit Picture Books bisher vorwiegend der Grundschuldidaktik zugeordnet wurden, stellt sich die Frage, warum diese Art der Textarbeit künftig auch in den weiterführenden Schulen stärker berücksichtigt werden sollte. Vier Argumente sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden. Zunächst leitet sich gerade aus der Tatsache, dass Storytelling im Grundschulenglischunterricht häufig genutzt wird, ein wesentliches Argument für die Fortsetzung der Methode in der Sekundarstufe I ab. Der Übergang von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen bringt für die Lernenden viele Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Eine gewisse Methodenkontinuität im Sinne eines Einbezugs bereits bekannter und bewährter Verfahren kann den Übergang erleichtern.
Ein zweiter sehr wesentlicher Faktor lässt sich als Bonding (vgl. Klippel 2006: 89) beschreiben. Indem die Schülerinnen und Schüler beim Storytelling vergleichsweise eng um die erzählende Lehrkraft gruppiert werden, wird bereits räumlich eine besondere Beziehung geschaffen. Das Geschichtenerzählen ist durch den intensiven Kontakt und die Interaktion zwischen Erzähler und Zuhörer immer auch ein sehr persönlicher Vorgang, was sich auf das Verhältnis zwischen Lehrkraft und Lernenden, aber auch insgesamt auf die Klassengemeinschaft positiv auswirken kann.
In unterrichtspragmatischer Hinsicht ergeben sich weitere Gründe für Storytelling. Durch die große Auswahl an verfügbaren Stories und Picture Books lässt sich Storytelling mit nahezu jedem Thema verknüpfen. Mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand können thematische Schwerpunkte gesetzt und auch komplexe Themen in anschaulicher Weise aufgegriffen werden.
Zuletzt korrespondiert Storytelling stark mit den Zielen kompetenzorientierten Lernens und Lehrens, d.h. beispielsweise der Förderung kommunikativer, interkultureller und methodischer Kompetenzen sowie Text- und Medienkompetenz, wie sie in den Bildungsstandards oder auch im Kompetenzstrukturmodell für Moderne Fremdsprachen im bayerischen Lehrplan verankert sind (vgl. KMK 2012: 12; ISB 2016). Im Rahmen der kommunikativen Fertigkeiten als Teilbereich kommunikativer Kompetenz trainiert Picture-Book-basiertes Storytelling das Hörsehverstehen. Der interaktive Ansatz, der phasenweises Mitsprechen oder auch Unterbrechungen vorsieht, um beispielsweise predicting anzuregen, fördert zusätzlich die Sprechkompetenz. Hinsichtlich der sprachlichen Mittel bietet der thematische Fokus vieler Geschichten eine hervorragende Grundlage für die kontextualisierte Wortschatzeinführung, während so genannte repetitive oder cumulative Stories (vgl. Ellis/Brewster 2014: 14), d.h. Geschichten, bei denen immer wieder dieselbe Struktur aufgegriffen wird, sich für die Erarbeitung grammatikalischer Strukturen eignen. Als literaturdidaktischer Ansatz beinhaltet Storytelling außerdem umfangreiches Potential zum interkulturellen Lernen, sei es in kulturspezifischer Weise, um Einblicke in bestimmte Kulturen zu gewinnen – nicht zuletzt auch in deren literarische Traditionen – oder in kulturübergreifender Weise, um allgemeine Ziele wie Toleranz und Fremdverstehen anzubahnen. Die Interpretation der Geschichten und das gemeinsame Aushandeln von Bedeutung sind Teil der Textkompetenz. Erkennen die Lernenden beispielsweise durch die Arbeit mit Parodien oder adaptierten Märchen intertextuelle Strukturen oder ziehen sie Querverbindungen zu anderen Repräsentationen derselben Geschichten, erweitern sie schrittweise auch ihre Medienkompetenz.