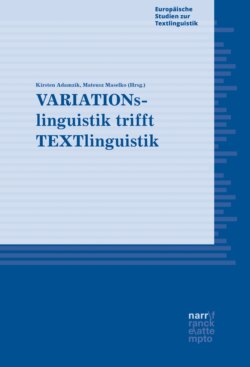Читать книгу VARIATIONslinguistik trifft TEXTlinguistik - Группа авторов - Страница 13
5 Fazit
ОглавлениеAnliegen des Beitrags war es, den mit der Tagung angestoßenen Austausch zwischen der Variationslinguistik und anderen Subdisziplinen näher zu begründen, und zwar in einer Zeit, in der Interdisziplinarität eigentlich groß geschrieben wird, zugleich aber der Druck zu innovativer Spitzenforschung so stark ist, dass selbst an den ,gleichen Gegenständen‘ arbeitende und traditionell kooperierende Forschungsrichtungen sich leicht zu einer Menge hochspezialisierter Sonderzweige auseinanderentwickeln, denen (verständlicherweise) mehr an der eigenen Profilierung als an gemeinsamen Grundlagen und Zielen gelegen ist. Ein gutes Beispiel dafür ist die getrennte Behandlung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die in der frühen Textlinguistik ausdrücklich zurückgewiesen wurde.
Von weitem gesehen behandeln auch Variations- und Textlinguistik denselben Gegenstand, nämlich den Sprachgebrauch, ein ausgeprägtes Bewusstsein der (potenziellen) Gemeinsamkeiten hat sich aber nie entwickelt. Wenn man die Untersuchung von Variablen und Varianten als Kern der Variationslinguistik betrachtet, so sind Untersuchungsansätze, die sich auf Texte als fixierte Produkte konzentrieren, von diesem Interessenschwerpunkt allerdings auch relativ weit entfernt.
Hier wurde die Voraussetzung, beide Subdisziplinen wendeten sich gleichermaßen gegen die Systemlinguistik, als nur vordergründige Gemeinsamkeit betrachtet, die einer antagonistischen Betrachtung von Langue vs. Parole entspringt und zu wenig produktiven Extrempositionen verleitet. Die Rückbesinnung auf weitere Nachbardisziplinen und Forschungstraditionen ist hilfreich, wenn nicht notwendig, um allzu verengte methodische Ansätze zu vermeiden. Diesem Vorgehen entsprechen die Arbeiten von Ulla Fix und Thomas Luckmann, die beide mündlich tradierte Gattungen als Paradebeispiel für Texte mit relativ großem Variationsspielraum behandeln und dabei auf die klassische Studie von André Jolles zurückgreifen.
So erhellend die Ausführungen zu Reproduziertexten und kommunikativen Gattungen sind, so problematisch scheint es mir allerdings, sie anderen Arten von Texten scharf entgegenzustellen. Dies entspricht m. E. auch nicht der Absicht Luckmanns, zumal die angestrebte soziologische Sprachtheorie ja unmöglich die wichtigsten Werkzeuge hochentwickelter Gesellschaften außer Acht lassen könnte, mit denen Sinn produziert und tradiert wird, nämlich schriftliche Texte. Ein Desideratum der soziologischen Forschung hatte Luckmann darin gesehen, dass sie sich nicht mit der Frage befasst hat, wie sich diese Sinnerzeugung im Einzelnen vollzieht. Als Antwort auf diese Frage betrachte ich seine Metapher von der kommunikativen Urproduktion. Sie ist zugleich geeignet, der extremen Expansion des Kommunikationsbegriffs entgegenzutreten, die auch diesen sinnlos macht:
„Nicht alles an menschlichen Begegnungen, ja nicht einmal alles, was für den einen oder anderen Beteiligten als sinnvoll erscheint, ist Kommunikation. Gedanken und Gefühle des einen können vor dem anderen verborgen werden. Überdies ist auch nicht jede Kommunikation sogleich kommunikative Interaktion. Gedanken und Gefühle können manchmal nicht vor dem anderen verborgen werden – und manchmal sollen sie das auch nicht. Wann immer menschliche Wesen kopräsent sind, bilden ihre Körper (mögliche) Ausdrucksfelder, und diese Ausdrücke können in vergleichsweise systematischer, wenn auch nicht immer sehr verläßlicher Weise gedeutet werden, und zwar auch dann, wenn sie nicht Teile von mimetischen, gestischen, taktilen oder olfaktorischen Zeichensystemen sind. Die empirisch bedeutsamste Form der Kommunikation ist jedoch die soziale Interaktion.“ (Luckmann 2002: 187)
Zentrale These dieses Beitrags ist, dass zum kollektiven (Sprach-)Gedächtnis bestimmter Gruppen nicht nur Lexeme, feste Wendungen und Muster diverser Ebenen gehören, sondern auch Texte. Diese müssen immer wieder aktualisiert werden, um die Identität des Kollektivs zu bestätigen und fortzuschreiben; dabei treten sie unweigerlich in vielen Varianten auf.
Man könnte allerdings sagen, dass damit nur die Erkenntnis von Humboldt wiederholt wird: Sprache „selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Tätigkeit (Energeia)“ (vgl. Luckmann 2002: 159).