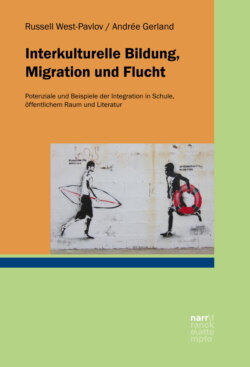Читать книгу Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht - Группа авторов - Страница 10
Migration und wie Schule mit ihr umgeht
ОглавлениеSowohl die Theorie der Schule als auch die Interkulturelle Pädagogik sind Arenen, in denen gesellschaftliche Kämpfe ausgetragen werden. Die Schule ist traditionell eher auf Homogenität ausgerichtet und soll nun mit Vielfalt umgehen, ohne die Vielfalt in einer Einfalt aufgehen zu lassen. Was Schule genau zu tun habe, wie sie mit Vielfalt umgehen solle, markiert den Schauplatz zahlreicher Auseinandersetzungen, an denen neben der Pädagogik auch die Politik und die Medien maßgeblich beteiligt sind. Es wundert folglich nicht, dass die Beantwortung der Frage, warum Kinder mit Migrations- oder Fluchthintergrund noch immer oft auf der Strecke bleiben und von der Schule in ihren Möglichkeiten nicht hinreichend gefördert werden, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Sehr oft ist die Perspektive die einer mangelnden Passung: einer mangelnden Passung zwischen dem, was das Herkunftsmilieu für die Kinder tun will oder tun kann; und spiegelbildlich dazu: einer Ausrichtung der Schule an Vorstellungen von Normalität oder an den Werten und Normen der Mittelklasse. In diesem Zusammenhang zu nennen wäre beispielsweise der Ansatz der kulturellen Reproduktion, der mit dem Namen Pierre Bourdieu verbunden ist. Dieser, wie andere Reproduktionstheorien, geht davon aus, dass die Schule gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht nur spiegelt, sondern auch aktiv hervorbringt. Im Falle der kulturellen Reproduktionstheorie Bourdieus wäre der Habitus der Mittelklasse der maßgebliche Bezugspunkt, an dem sich das Handeln der Lehrerinnen und Lehrer ausrichtet. Kinder aus Arbeiterfamilien oder aus depravierten Familien, so die These, bringen keine der Kapitalformen mit, die in der Schule geschätzt werden: weder kulturelles noch soziales noch symbolisches Kapital. Sie tun sich daher mit den schulischen Anforderungen eher schwer. Eine ähnliche Sichtweise findet sich in den soziolinguistischen Studien der sechziger und siebziger Jahre. Auch diese Studien gehen davon aus, dass die Schule eine andere Sprachform erwartet oder voraussetzt als die von den Kindern in ihren Familien praktizierte. Unter anderem arbeiten diese Studien mit der mit dem Namen Basil Bernstein verbundenen Unterscheidung in den so genannten elaborierten und restringierten Sprachcode.
Ganz anders dagegen der Ansatz der institutionellen Diskriminierung, der mit den Namen Frank-Olaf Radtke und Mechtild Gomolla (2009) verbunden ist. Der Kern der Argumentation ist, dass durch das Routinehandeln der Organisation Diskriminierungen erfolgen – ohne eine wie auch immer geartete Absicht. Um zu verdeutlichen, dass Diskriminierungen relativ beliebig sind, nennen die AutorInnen das Beispiel des Schicksals der Katholischen Arbeitertochter vom Lande. Dies war eine soziologische Kunstfigur der sechziger Jahre und galt als Inbegriff der Bildungsbenachteiligung. Sie war weiblich, weil Mädchen aufgrund der noch vorherrschenden Vorstellung des männlichen Ernährers als weniger in ihren Bildungsaspirationen zu unterstützen galten als Jungs. Dies wurde verstärkt durch den eher mit konservativen Wertvorstellungen assoziierten Katholizismus. Hinzu kam die soziale Herkunft in den unteren sozialen Schichten (Arbeiterkind). Diese galten und gelten noch immer, das ist konstant geblieben, als bildungsfern und wenig geeignet, Kinder, gleich welchen Geschlechts, auf höheren Bildungswegen zu unterstützen. Ländliche Regionen, im Unterschied zur Stadt, waren in den sechziger Jahren noch deutlich schlechter versorgt mit weiterführenden Schulen, eine Bildungsungerechtigkeit ergab sich also allein schon durch den Wohnort. Nun wäre die heutige Kunstfigur eher der muslimische Arbeiterjunge aus dem sozial benachteiligten Viertel der Großstadt. Daran sieht man, dass sich fast alle „Markierungen“ oder „Differenzlinien“ geändert haben, außer der sozialen Herkunft. Für Frank-Olaf Radtke und Mechtild Gomolla sind dies klare Indizien dafür, dass die Diskriminierungen nicht erfolgen, weil die Lehrerinnen und Lehrer xenophob oder rassistisch sind, sondern nur aufgrund der Handlungsroutinen der Organisation Schule – schließlich sind die Mädchen nicht auf einmal klüger geworden, sie haben keine großräumigen Fördermaßnahmen erfahren; vielmehr hat nur die Schule ihre Routine verändert und andere Entscheidungen getroffen. Mit der Bildungsexpansion einher ging die Suche nach bisher unausgeschöpften „Bildungsreserven“ – und die fand man unter anderem in den Mädchen. Im letzten Teil des Beitrags werden diese unterschiedlichen Zugänge nochmals kommentiert. Allerdings sollen zunächst Beispiele aus ethnographischer Perspektive angeführt werden, welche den Gedanken des Titels des Beitrags aufnehmen: Othering „Other People’s Children“.