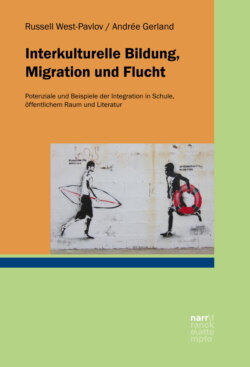Читать книгу Interkulturelle Bildung, Migration und Flucht - Группа авторов - Страница 12
Geflüchtete Kinder und Jugendliche und ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler
Оглавление„Flucht“ und „Vertreibung“ lassen sich als Sonderfälle von Migration beschreiben, man kann aber auch umgekehrt sagen, dass Flucht und Vertreibung nochmals auf die Problematik verweisen, in vereinheitlichendem Gestus über Migration zu reden. Kinder und Jugendliche mit so genanntem Fluchthintergrund fordern Schule, aber auch die Pädagogik als Wissenschaft sichtbarer als andere Gruppen an zwei Fronten heraus: Die eine ist ihre oft unglaubliche Leistungsbereitschaft und ihr Wille und ihre Einsatzbereitschaft, es zu schaffen. Und tatsächlich schaffen es viele auch, erstaunlich schnell, allen Belastungen zum Trotz. Es überrascht nicht, dass dies in den meisten Fällen die Kinder sind, die aus bildungsnahen Familien kommen. Auch wenn die Familie nicht direkt unterstützen kann, so vermittelt sie doch die Haltung und verfügt über kulturelles Kapital. Auch wenn die Bildungsabschlüsse der Erziehungsberechtigten vielleicht nicht immer anerkannt werden, ist die Bedeutung des inkorporierten kulturellen Kapitals nicht zu unterschätzen. Im Lichte der oben genannten Theorien zur kulturellen Reproduktion und institutionellen Diskriminierung lässt sich erklären, warum dies so ist. Diese Kinder und Jugendliche „passen“, sie sind bereit und fähig Leistungen zu erbringen, verfügen über eine hohe Motivation und Bildungsaspirationen, sie sind Hoffnungsträger für die Beseitigung des Fachkräftemangels, einige von ihnen werden Teil der wissenschaftlichen Elite von morgen sein. Diese Kinder bestätigen das kollektive soziale Image, das in der Schule transportiert wird, und sind weniger von Othering-Prozessen betroffen. Diese Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung irritieren das System nicht; in sie zu investieren, verspricht hohe „rates of return“. Auch für die Lehrkräfte sind diese Kinder und Jugendliche nur sehr bedingt „other people’s children“; es ist nicht schwer, aus ihnen gleichberechtigte „Landeskinder“ zu machen, wie es unser föderales System vorsieht. Mit Hannah Arendt gesprochen, sind diese Kinder gesellschaftlich gewollt. Gleichzeitig stehen sie nicht für das Menschsein an sich, sondern für das differenzierte Menschsein: nicht Vulnerabilität, sondern Selbstvertrauen und der Glaube an die Selbstwirksamkeit zeichnen sie aus. Hinzu kommt, dass sie, im Unterschied zu den Arbeitsmigranten der sechziger und siebziger Jahre und deren Kindern und Kindeskindern, mit keiner kollektiven Erzählung des Defizits und der (Selbst)Ab- und Ausgrenzung belastet sind, ihnen wird keine Geschichte zugeschrieben, sie beginnen vielmehr gleichsam „tabula rasa“. Die Flucht hat eine Zäsur in ihren Lebensweg gesetzt, aber das gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit eines neuen Anfangs, macht sie zu Pionieren, die sich den Lebensweg nun selbst fortschreiben müssen. Selbstverständlich werden hier viele Projektionen deutlich, aber es sind zumeist positive, die sich um den schulischen Erfolg unter erschwerten Bedingungen anlagern.
Gelingt es hingegen nicht, relativ rasch an das Leistungsniveau der Regelklassen anzuschließen, sind Kinder und Jugendliche traumatisiert, sind ihre Familien so belastet, dass sie sich nicht einlassen können auf den schulischen Alltag in der neuen Umgebung, tut sich das Schulsystem deutlich schwerer mit den Geflüchteten. Wenn die Kinder und Jugendliche vielleicht weniger Eigeninitiative und Motivation zeigen, wenn sie mehr Ressourcen fordern als die Schulen bereit oder fähig sind zu geben, hat die Schule wesentlicher seltener Konzepte zur Verfügung, um die Kinder und Jugendlichen anders als primär in kognitiver Hinsicht anzusprechen. Die Integrationsvorbehalte seitens der Aufnahmegesellschaft sind größer, die Skepsis, ob diese Kinder und Jugendliche einen produktiven Beitrag leisten werden, ist höher usw. In gewisser Hinsicht wiederholt sich hier, was aus dem Bildungsteilhabestudien nur zu bekannt ist: Nicht nur Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Herkunftsfamilien tun sich schwer mit der Schule, die Schule tut sich auch schwer mit ihnen. Dies sind die Kinder, deren Potenziale oft erst gar nicht erkannt werden, weil man es ihnen doch nicht zutraut. Wenn diese grundsätzliche Wahrnehmung dann noch auf eine rigide Einstellung trifft, die Begabung als erblich betrachtet und folglich Misserfolg quasi genetisch zurechnet, wird das Scheitern schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Hinzu kommt ein Drittes: so unterschiedlich beide Gruppen sind, sie verweisen durch die Tatsache der Flucht- und Vertreibungserfahrung auf das ungelöste Problem der Menschenrechte und der Menschenrechtserziehung. Denn das Gewolltsein der einen und das potentielle Nichtgewünschtsein der anderen bezieht sich auf die Dimension der antizipierten bürgerlichen Teilhabe, nicht auf das rein Menschliche. Dies zu denken, ist nach wie vor ein Problem. So holzschnittartig diese Darstellung auch ist, so kann sie illustrieren, dass es nicht die Frage der Flucht an sich ist, die über die schulische Integration entscheidet, sondern das Zusammenkommen oder Auseinanderdriften von Vorstellungen, Erwartungen, Bereitschaften sowohl seitens der geflüchteten Kinder und Jugendlichen und ihren Familien als auch des Schulsystems und seines Personals. In anderen Worten: Am Ende des Tages wird in diesen nervösen Zeiten viel daran entschieden werden, wie es den jungen Zugewanderten gelingt, zu ihrer Rolle als Schülerinnen und Schüler zu finden bzw. wie sie darin unterstützt werden. Gelingt ihnen dies nicht oder werden sie darin nicht unterstützt, dann liegt es nahe, dass Othering-Prozesse aus Kindern und Jugendlichen „other people’s children“ machen.