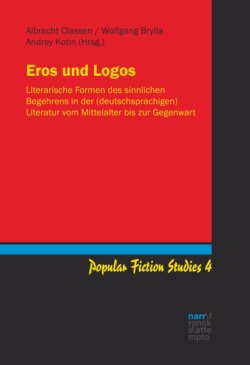Читать книгу Eros und Logos - Группа авторов - Страница 28
6. Christian Hölmann: Abbildungen der Schooß
ОглавлениеEiner anderen, aber nicht minder innovativen Strategie bedient sich Christian Hölmann in seinem Zyklus über weibliche Körperteile1, dessen pointierter Abschluss das Gedicht Abbildungen der Schooß bildet. Hier wird dem Leser nicht die voyeuristische Mitsicht auf eine entblößte Schlafende geboten. Stattdessen nimmt das lyrische Ich die Perspektive des weiblichen Schoßes selber ein und legt einen umfassenden Bericht über sich ab. Mit der veränderten Perspektive thematisiert Hölmann wie seine Vorgänger das Motiv der weiblichen Scham und stellt es ins Zentrum des Gedichts, in dem es in 84 kreuzgereimten Alexandrinern beschrieben wird. Hatte Neukirch noch die Geschlechter der Persona von Bessers Ruhestatt der Liebe invertiert, verkehrt Hölmann die Kommunikationssituation und macht aus dem heimlich mitwissenden Leser nun den von einer Vagina apostrophierten:
| In meinen gründen ist die liebe ja gebohren/ Ich bin ihr erster Sitz/ ihr Stammhauß/ Vaterland/ | |
| 15 | Mich hat zu dieser See selbst die natur erkohren/ An deren ufern sich das schöne Mädgen fand. Ihr glieder möget nun vor mir die seegel streichen/ Weil ich die Götter selbst durch mich hervor gebracht/ Ihr selber müstet auch im Mutterleib' erbleichen/ |
| 20 | Wenn nicht durch mich das Thor wär' in die welt gemacht. Es füllet meine frucht den Himmel und die Erde/ Ich mache daß der bau der wundergrossen welt/ Nicht vor der letzten zeit zu einer wüsten werde/ Die nichts als distel-sträuch und dörner in sich hält. (V. 13–24) |
Die Häufung der Personalpronomen konfiguriert unmissverständlich die surreale Kommunikationssituation, durch die die Beschreibung der weiblichen Scham surreal verzerrt wird. Während die bisher beschriebenen, voyeuristisch figurierten Prätexte Hölmanns auf das erotische Vorstellungspotential der Leserschaft zielen, löst Hölmann das Gedicht aus seinem eigentlich erotischen Kontext, denn das beschriebene Motiv entzieht sich durch die Erzählsituation jeder realistischen Vorstellung.
Eindeutig markiert Hölmann den intertextuellen Bezug zu Besser, wenn sich das lyrische Ich – Bessers Titel zitierend – metaphorisch als „[d]er liebe ruhestadt“ (V. 61) beschreibt. Da Hölmann den vierten und fünften Teil der Neukirchschen Sammlung selbst herausgab, ist anzunehmen, dass er auch die Gedichte der ersten beiden Bände gut kannte und den Bezug zu Claudians Epithalamium bewusst über das wirkungsmächtige Gedicht Bessers markierte. Die Konkurrenz zu den motivgeschichtlich verwandten Gedichten ist bei Hölmann durchaus programmatisch:
| 1 | Der geist des alterthums schrieb den beschaumten wellen Die künstliche Geburth der liebes-Göttin zu/ Und daß ein muschelhaus auf den gesalznen stellen So wohl zur überfuhr als ihrer ersten ruh |
| 5 | An statt der wiege sey damals bestimmt gewesen; Allein so wurde da die wahrheit eingehüllt/ Wer ihre Perlen nun wolt' aus dem schlamme lesen Der fand sie endlich zwar/ doch frembde vorgebildt. (V. 1–8) |
Den Geburtsmythos der Venus nach Hesiod2 weist Hölmann als Verschleierung der Wahrheit aus und nimmt so auch die aemulatio mit der Antike auf. Bei den antiken Dichtergrößen könne man die „Perlen“ nur „frembd[…] vorgebildt“ aus „dem schlamme lesen“; für die Wahrheit solle man jedoch den „vorhang weg [ziehen] und […] die fabeln schweigen“ (V. 9) lassen. Durch die ‚sprachliche Handlung‘ lässt das lyrische Ich Hölmanns tatsächlich „alle Hüllen fallen“ und straft in seiner Offenheit alle Prätexte als eingehüllte Wahrheit ab. Da die Erzählsituation aber wiederum fiktionalisierend wirkt, wird der Wahrheitsanspruch ironisch gebrochen und das Motiv künstlich überblendet. Die aemulatio gelingt, weil Hölmann mit der neufigurierten Erzählsituation die technischen Möglichkeiten der extremen Gestaltung ausreizt und die Verhüllung neu dimensioniert.