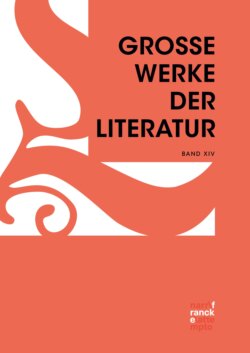Читать книгу Große Werke der Literatur XIV - Группа авторов - Страница 10
3.3 Inhalt und Bedeutung
ОглавлениеDas Werk lässt sich mit Neumann grob so gliedern:1
In den ersten beiden Büchern treten besonders die „Wechselgesänge zwischen der Seele und Gott“ und die „Dialoge über Wesen und Wirkung der Minne“ hervor. Dabei stehen „brautmystische Vorstellungen und Minneklagen im Vordergrund, oft im Anklang an das Hohelied, an den frühen Minnesang oder an volkstümliche Lieddichtung.“ Seit dem dritten Buch werden einfache Visionsberichte über Himmel, Fegefeuer und Hölle sowie verschiedene Lehrdialoge mit Gott und verschiedene Minnebetrachtungen häufiger. Im siebten Buch ist dann die wieder stärker hervortretende Brautmystik kein Ausdruck der Minneekstase mehr, sondern Zeugnis der Unioerwartung nach dem Tod.
Alois Haas hat einen etwas anderen Gliederungsansatz versucht und dargestellt, wie sich die Mechthild’sche Mystik in insgesamt drei Aspekten gliedern lasse: Der erste Aspekt betreffe die Unmittelbarkeit der mystischen Vereinigung der Seele mit Gott; der zweite die Entfremdung der Seele zu Gott; der dritte die dialektische Versöhnung beider im Konzept der sinkenden Demut und Liebe.2
Zum ersten dieser Aspekte (Vereinigung) hält Haas fest: „Mechthilds Mystik ist affektive Liebesmystik, in der die gnadenhafte Vereinigung von Gott und Seele durch das Personal von Bräutigam und Braut und entsprechende erotische Symbolik vergegenwärtigt wird.“3 Dafür gibt Haas ein anschauliches Beispiel aus Mechthilds Werk:
| 1 | Herre, nu bin ich ein nakent sele,Und du in dir selben ein wolgezieret got.Únser zweiger gemeinschaftIst der ewige lip ane tot. |
| 5 | So geschihet da ein selig stilliNach ir beider willen.Er gibet sich ir und si git sich ime.Was ir nu geschehe, das weis si,Und des getroeste ich mich.4 |
Auf den ersten Blick verwirrend ist der Gebrauch der Pronomina, wenn in den Zeilen 1–4 die Seele zu Gott spricht und in den Zeilen 5–9 ‚Mechthild‘ über ihre Seele und Gott. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass gerade so – im Sinn einer Einheitsmystik – Differenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Person, Seele und Gott verwischt werden.
Der zweite von Haas benannte Aspekt besteht in einer Entfremdung oder in einer Gottesferne, die freilich bewusst angenommen wird; etwa wenn die Seele gerade die Leiderfahrung in der Gottesferne überschwänglich begrüßt:
Siest willekomen, vil selig vroemedunge! Wol mir, das ich ie geboren wart, da du, vrouwe, nu min kamererin solt sin, wan du bringest mir ungewone vroede und unbegriffenlich wunder und darzuo untreglich suessekeit! Aber, herre, die suessekeit solt du von mir legen und la mich din vroemedunge han! 5
Eya, selige gotzvroemedunge, wie minnenklich bin ich mir dir gebunden? Du stetigest minen willen in der pine und liebest mir die sweren, langen beitunge in disem armen libe. Swa mitte ie ich mich zuo dir geselle, got ie grossor und wunderlichor uf mich vallet. O herre, ich kan in der tieffi der ungemischeten diemuetikeit nit entsinken.
Ouwe, ich dir in dem homuote lihte entwenke.
Mere: ie ich tieffer sinke,
ie ich suessor trinke. 6
Die Bewegung der Einheit erfolgt dabei, wie Haas betont, weniger vom Individuum zu Gott als vielmehr von Gott zur menschlichen Seele hin. Notwendig dafür ist der dritte, von Haas benannte Aspekt, der Aspekt der sinkenden Liebe. Damit die Liebe Gottes in den Menschen sinken oder hinabfließen kann, bedarf es freilich sowohl der göttlichen als auch der menschlichen Demut. Mechthild bringt dies im Buch II ins Wort, wenn sie Gott so sprechen hört:
Wa ich je sunderliche gnade gap, da sůchte ich je zů die nidersten, minsten, heimlichosten stat; die irdenschen hohsten berge moegent nit enpfan die offenbarunge miner gnaden, wan die vluot mines heligen geistes vlússet von nature ze tal. 7
Susanne Köbele hat für Mechthilds Kennzeichnung dieses Bild des Flusses gewählt, ist aber dessen Fließrichtung von oben nach unten gefolgt und hat damit auch die Bedeutung der Demut erfasst;8 das wird besonders an dem von Köbele gewählten Textausschnitt evident, wo Gott Mechthild verkündet, er wähle sich für seine Offenbarung die niederste und geringste Stätte:
[…] wan die vlůt mines heligen geistes vlússet von nature ze tal. Man vindet manigen wisen meister an der schrift, der an im selber vor minen oͮgen ein tore ist. Und ich sage dir noch me: Das ist mir vor inen ein gros ere und sterket die heligen cristanheit an in vil sere, das der ungelerte munt die gelerte zungen von minem heligen geiste leret.
Hier, so Köbele, werde ein „ungelehrtes Charisma“ beschworen, und damit liege hier eine „Schlüsselstelle für das Selbstverständnis der Autorin“ vor. Mechthild setze „ihr Nicht-Wissen […] der schulwissenschaftlichen Theologie selbstbewusst gegenüber“. Dem Meister der – lateinischen – Schrift trete mit Mechthild die ‚Laienautorin‘ gegenüber. „Die Niedrigkeit der Volkssprache qualifiziert diese […] in besonderer Weise für die mystische Offenbarung.“9
Halten wir also noch einmal die drei von Haas benannten Aspekte Mechthilds fest: Einerseits die Unmittelbarkeit der mystischen Vereinigung der Seele mit Gott, andererseits die Entfremdung der Seele zu Gott, und schließlich die dialektische Versöhnung beider im Konzept der sinkenden Demut und Liebe.
Ruh hat diese drei Aspekte durch Umrisse einer theologischen Konzeption ergänzt, die sich weniger am mystischen Gehalt als vielmehr an der Theologie Mechthilds orientieren. Ruh geht davon aus, dass dabei erstens der trinitarische Gott und die Sicht darüber hinaus, zweitens die Heilsgeschichte und drittens die Betrachtung und Erwartung der Endzeit eine Rolle spielten.
So lässt sich mit Ruh zeigen, wie Mechthilds Gedanken vielfach um den dreieinigen Gott kreisen und wie dies zumeist in der bei ihr relativ selten vorkommenden direkten Vision geschieht.10 Entscheidend ist, dass Mechthild, wie etwas später dann auch Meister Eckhart, letztlich über die trinitarische Vorstellung hinausweist:
„Dem Bild der Engel vom dreieinigen Gott vor der Menschwerdung Christi geht nach Mechthilds Vorstellung ein anderes voran: die Gottheit vor der Schöpfung (VI 31, 26–31): ‚Wo war Gott, bevor er etwas geschaffen hat? Er war in sich selber, und ihm waren alle Dinge (im Geiste) gegenwärtig und offenkundig, so wie sie heute (geschaffen) sind. Welche Gestalt hatte damals unser Herrgott? Ganz so wie eine Kugel, und alle Dinge waren in Gott beschlossen ohne Schloß und ohne Tür. Der unterste Teil der Kugel ist die grundlose Festung über allen Abgründen, der oberste Teil ist eine Höhe, über die nichts hinausgeht, der Umfang der Kugel ist ein nicht zu umgreifender Kreis (cirkel).‘ Ruh deutet dies so: „Das Bild dieser intelligiblen Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist, das immer wieder in der platonisierenden Tradition auftaucht und bis auf Empedokles zurückgeführt wird, ist sicher ein theologischer Bildungssplitter. Das Erstaunliche ist, wie immer bei Mechthild, die Umformung ins Eigene. Die implizierte Offenheit der Kugel wird mit ‚ohne Schloß und Tür‘ konkretisiert, zum ‚nicht zu umgreifenden‘ Umfang tritt die Vorstellung eines ‚unten‘ und ‚oben‘: hier reicht sie ins Unendliche, dort ist sie Materie, organisierter Stoff der Welt.“
Dem besonders im dritten Buch geschilderten Ablauf der Heilsgeschichte mit ihrer extremen Vermenschlichung der göttlichen Personen folgt dann eine Konzentration auf die letzten Dinge, nämlich die Darstellung des Antichrist und der beiden Propheten Enoch und Elias, wobei diese Partien sich besonders in den Büchern IV und VI finden. Ruh hat Recht, wenn er darstellt, wie wichtig solche Partien für Mechthilds kirchliche Sendung, wie unwichtig sie aber für ihre mystische Spiritualität sind. Freilich hat Neumann mit Recht das Auftauchen auch subtiler theologischer Probleme bei Mechthild benannt:11 trinitarische Spekulationen in den Büchern II,3, III,9, und IV,14; die Erschaffung der Seele (I,22, III,9, VI,31); das Verhältnis von Seele und Leib während der Ekstase (VI,13) und die Rückkehr des Geschöpfs in den Schöpfer (VII,25). Diese Aufstellung einzelner theologischer Themen, wie sie Neumann vorgenommen hat, lässt sich durch eine generelle Bemerkung ergänzen: Für Mechthild von Magdeburg steht es außer Frage, dass sie mit ihrem Buch eigenhändiges Zeugnis ihrer mystischen Offenbarungen ablegt und für sie steht es, und dies wird im Buch II,26 besonders deutlich, stets außer jeder Frage, dass sie dabei im göttlichen Auftrag handelt. In diesem göttlichen Auftrag kann sie auch Prophezeiungen aussprechen, die eine scharfe Kritik der Kirche und kirchlicher Institutionen beinhalten. Buch VI,21 beispielsweise ist stark geprägt von einer Sichtweise, wie sie etwa Joachim von Fiore in seinen Prophezeiungen formuliert hatte. Mechthild spricht hier joachitisch geprägt eigene Prophezeiungen aus, die den Niedergang der Kirche, das Kommen des Jüngsten Gerichts und das Heraufdämmern eines eigenen Ordens der Jüngsten Brüder beschreiben:
XXI. Wie boͤsú pfafheit sol genidert werden, wie predier alleine predien soͤnt und beschoͤve sin und von den jungesten predieren
Owe crone der heligen cristanheit, wie sere bistu geselwet! Din edelsteine sint dir entvallen, wan du krenkest und schendest den heligen cristanen geloͮben; din golt das ist verfúlet in dem pfůle der unkúscheit, wan du bist verarmet und hast der waren minne nit; din kúscheit ist verbrant in dem girigen fúre des frasses; din diemůt ist versunken in dem sumpfe dines vleisches; din warheit ist ze nihte worden in der lugine dirre welte; din blůmen aller tugenden sint dir abegevallen.
Owe crone der heligen pfafheit, wie bistu verswunden! Joch hastu nicht mere denne das umbeval din selbes, das ist pfaͤffeliche gewalt, da mitte vihtestu uf got und sine userwelten vrúnde. Harumbe wil dich got nidern, e du icht wissest, wan únser herre sprichet alsus: »Ich wil dem babest von Rome sin herze ruͤren mit grossem jamere, und in dem jamere wil ich ime zůsprechen und klagen im, das minú schafhirten von Jerusalem mordere und wolve sint worden, wande si vor minen oͮgen die wissen lamber mordent, und die alten schaf dú sint allú hoͮbtsiech, wan sú (118v) moͤgent nit essen die gesunden weide, die da wahset an den hohen bergen, das ist goͤtlichú liebi und heligú lere. Swer den helleweg nit weis, der sehe an die verboͤsete pfafheit, wie rehte ir leben zů der helle gat mit wiben und mit kinden und mit andern offenbaren súnden. So ist des not, das die jungesten brůder kommen; wan swenne der mantel ist alt, so ist er oͮch kalt. So muͤs ich miner brut, der heligen cristanheit, einen núwen mantel geben.“ Das soͤllent die jungesten brůder wesen, als da vor ist geschriben.
„Sun babest, dis soltu vollebringen, so mahtu din leben lengen; das nu din vorvaren also unlange lebeten, das kumt da von, das si mines heimlichen willen nit vollebrahten.« Alsus sach ich den babest an sinem gebette, und do horte ich, das im got kúndete dise rede. 12
Auch vor Kritik am eigenen Stand der Beginen scheut Mechthild während ihrer Beginenzeit nicht zurück, so etwa wenn sie die Frage anspricht, mit welchen Tugenden man an der Eucharistie teilnehmen soll:
Die vil torehtigen beginen, wie sint ir also vrevele, das ir vor únserm almehtigen rihter nit bibenent, wenne ir gotz lichamen so dikke mit einer blinden gewonheit nemment! Nu ich bin die minste under úch, ich můs mich schemmen, hitzen und biben.13
Auch als Nonne in Helfta spart sie beispielsweise im Kapitel VII,27 (Wie der geistlich mensche sin herze sol keren von der welt) nicht mit Kritik an den Klosterschwestern. Bei der Kritik spart sie sogar den Orden der Dominikaner, den sie sonst lobt, nicht aus:
Sant Dominicus der merkte sine bruͤder mit getrúwer andaht, mit lieplicher angesiht, mit heliger wisheit, und nit mit vare, nit mit verkerten sinnen und nit mit grúwelicher gegenwúrtikeit. Den wisen leret er fúrbas me, das er mit gotlicher einvaltekeit solte temperen alle sin wisheit; den einvaltigen lerte er die waren wisheit; den bekorten half er tragen heimelich alles ir herzeleit; die jungen lerte er vil swigen, da von wurden si uswendig gezogen und inwendig wise; die kranken und siechen troste er vil minneklich, und er bedahte oͮch alle ir not mit getrúwem vlisse. Si vroͤweten sich alle gemeine siner langen gegenwúrtekeit, und sin suͤssú geselleschaft mahte inen senfte alle ir kumberliche erbeit. Dirre orden was in den ersten ziten reine, einvaltig und dar zů vol der brennenden gottes liebi. Die reine einvaltekeit, die got einigen menschen git, die wirt <underwilen also> gespottet von etlichen lúten, das er die gabe verlúret, da man die gotz wisheit inne vindet und kúset; das verloͤschet oͮch gotz brennende minne. […] Das man die brůdere ze sere tribet ane erbarmherzekeit und ane suͤsse lere, da von geschehent schedelichú ding, der ich nu muͤs swigen.14
Noch schärfer freilich formuliert Mechthild ihre Kritik am Domkapitel:
Das got die tůmeherren heisset boͤke, das tůt er darumbe, das ir vleisch stinket von der unkúscheit in der ewigen warheit vor siner heligen drivaltekeit. 15
Die allgemeine Kritik umgreift auch den Papst, was besonders deutlich wird, wenn man sich das eben zitierte Buch VI,21 (vgl. oben Anm. 30) noch einmal näher ansieht, denn die Krone der hl. Christenheit, die dort im Verfall geschildert wird, ist niemand anders als der Papst, was gerade die direkte Anrede am Ende von Buch VI,26 (Sun babest, dis soltu vollebringen) verdeutlicht. Mechthilds Kritik umgreift dann auch die Kirche als Ganzes (Buch V,34). Gleichzeitig scheut sie nicht davor zurück, ihren eigenen Herkunftsstand und den Adelsstand insgesamt zu kritisieren, etwa wenn sie sich gegen adelige Damen wendet. Die Kritik bleibt allerdings auch nicht einseitig. So ist festzustellen, dass Mechthild die Gefahren, die in den Augen der Kirche von einer kirchenfernen Mystik ausgehen, selbst erkennt und sich unmissverständlich gegen Strömungen ihrer Zeit ausspricht, die auch in ihren Augen häretisch sind: Das Buch VII mit dem Kapitel 47 ist ein sprechendes Beispiel dafür:
XLVII. Von einer súnde dú boͤse ist úber alle súnde
Ein súnde hab ich gehoͤret nemmen. Ich danken des gotte, das ich ir nit erkenne; si dunket mich und ist ob allen súnden boͤse, wan si ist der hohste ungeloͮbe. Ich bin ir von aller miner sele und von allem minem libe und von allen minen fúnf sinnen und von allem minem herzen gram. Ich danken des Jhesu Christo, dem lebendigen gotz sune, das si nie in min herze kam. Dise súnde ist nit von cristanen lúten ufkomen; der homuͤtige vient hat die einvaltigen lúte mit betrogen. Si wellent also helig sin, das si sich in die ewigen gotheit wellent ziehen und legen bi der ewigen heligen menscheit únsers herren Jhesu Christi. Wenne sich die vindent in bobenheit, so gebent si sich in den ewigen vlůch, si wellent doch die heiligosten sin; si habent iren spot uf gotz wort, die von der menscheit únsers herren sint gescriben.
Du allerarmester mensche, bekantestu werlich die ewigen gotheit, so were das unmugelich, du bekantest oͮch die ewigen menscheit, die da swebet in der ewigen gotheit. Du muͤstest oͮch bekennen den heligen geist, der da erlúhtet des cristan menschen herze und smeket in siner sele úber alle suͤssekeit und leret des menschen sinne úber alle meisterschaft, (154v) das er diemuͤtekliche da sprichet, das er vor gotte vollekomen nit mag wesen.16
Dass Mechthild hier sehr konkrete ‚Ketzereien‘ im Auge hat, macht der letzte Satz ihrer Kritik deutlich: Er richtet sich „gegen die Vorstellung von homines perfecti, als welche sich die Mitglieder ketzerischer Sekten, etwa der im Nördlinger Ries, verstanden.“17 Mechthild kritisiert also „Ketzerei“ ebenso scharf wie den Papst, die Beginen wie die Mitschwestern, den Adelsstand und sogar den Orden ihres Beichtigers. Von der eigenen Wahrheit zutiefst durchdrungen, setzt sie sich, bildlich gesprochen, zwischen alle Stühle. Um als Nicht-Theologe, als Laiin und als Frau (!) in dieser Zeit eine solch heftige Kritik in alle Richtungen wagen zu können, bedarf es einer ganz besonderen Legitimation. In der Tat hat sich Mechthild selbst verteidigt. Dies wird in Buch V,12 deutlich, wo sie zur ihrem Beichtvater spricht:
Meister Heinrich, úch wundert sumenlicher worten, die in disem bůche gescriben sint. Mich wundert, wie úch des wundern mag. Mer mich jamert des von herzen sere sid dem male, das ich súndig wip schriben můs, das ich die ware bekantnisse und die heligen erlichen anschowunge nieman mag geschriben sunder disú wort alleine; si dunken mich gegen der ewigen warheit alze kleine.
Ich vragete den ewigen meister, was er har zů spreche. Do antwúrt er alsus: »Vrage in, wie das geschach, das die aposteln kamen in also grosse kůnheit nach also grosser bloͤdekeit, do si enpfiengen den heligen geist. Vrage me, wa Moyses do was, do er niht wan got ansach. Vrage noch me, wa von das was, das Daniel in siner kintheit sprach.« 18
Mechthild beruft sich dabei nicht nur auf das Pfingstereignis der Apostel, auf die Begegnung Moses‘ mit Gott und die prophetische Gabe Daniels; sie nimmt diese Gabe für sich selbst in Anspruch und lässt Christus selbst sie ihr zusprechen. Ebenso deutlich wird diese Selbst-Legitimation im Prolog des Werkes, das die Autorschaft des Buches quasi für Gott selbst in Anspruch nimmt. Dabei handelt es sich um ein hochkomplexes Verfahren, das Burkhard Hasebrink, wenn er die Ungelehrte als Lehrerin der Gelehrten vorstellt, so erklärt:
„Die Individualität der Gotteserfahrung verleiht dem ‚Fließenden Licht der Gottheit‘ eine außerordentliche Autorität. Die Provokation, die das Buch offensichtlich schon zu Lebzeiten Mechthilds darstellte, verlangte nach Absicherung und einer grundsätzlichen Legitimation ‚ungelehrter‘, laikal-volkssprachiger Literatur. Im Zentrum dieser Legitimation steht das Konzept der doppelten Autorschaft […], das eine zweifache Legitimation erlaubt:
Das eine Begründungsverfahren zielt auf die religiöse Unterweisung der Magdeburger Begine durch die Dominikaner und ihren Anteil an der Entstehung des ‚Fließenden Lichts der Gottheit‘. Damit stehen die Aussagen des Buches unter der Autorität des gelehrten Diskurses, in dem, wie wir aus der monastischen Tradition wissen, auch das Konzept einer ‚heiligen Einfalt‘ des theologisch Ungelehrten seinen festen Platz hat. Die schlichte Opposition ‚gelehrt‘ versus ‚ungelehrt‘ greift daher zu kurz. Das zweite Begründungsverfahren zielt in der Tradition der Offenbarung auf die Inspiration der Sprecherin durch Gott selbst, so daß nach dieser Vorstellung das Gespräch der Seele mit dem geliebten Partner letzten Endes ein offenbares Selbstgespräch Gottes darstellt.“19
Schon Ruh hatte versucht, Mechthilds Legitimationsmuster durch das Modell der Inspiration zu erklären, indem er auf eine besonders klare Stelle aus Buch IV hinwies:
Ich enkan noch mag nit schriben, ich sehe es mit den oͮgen miner sele und hoͤre es mit den oren mines ewigen geistes und bevinde in allen liden mines lichnamen die kraft des heiligen geistes 20
Mechthild macht dabei die Gefahr, die von diesem ihrem Buch für sie selbst ausgeht ebenso deutlich, wie sie sich selbst und ihre Leser(innen) gleichzeitig der göttlichen Autorschaft versichert:
Ich wart vor disem buͦche gewarnet, und wart von menschen also gesaget: Woͤlte man es nit bewaren, da moͤhte ein brant úber varen. Do tet ich als von kinde han gepflegen; wenne ich betruͤbet ie wart, so muͦste ich ie betten. Do neigte ich mich zuͦ minem liebe und sprach: »Eya herre, nu bin ich betruͤbet dur din ere; sol ich nu ungetroͤstet von dir beliben, so hastu mich verleitet, wan du hies mich es selber schriben.« Do offenbarte sich got zehant miner trurigen sele und hielt dis buͦch in siner vordern hant und sprach: »Lieb minú, betruͤbe dich nicht ze verre, die warheit mag nieman verbrennen. Der es mir us miner hant sol nemen, der sol starker denne ich wesen. Das buͦch ist drivaltig und bezeichent alleine mich. Dis bermit, das hie umbe gat, bezeichent min reine, wisse, gerehte menschheit, die dur dich den tot leit. Dú wort bezeichent mine wunderliche gotheit; dú vliessent von stunde ze stunde in dine sele us von minem goͤtlichen munde […]«.21
Damit erscheint Mechthilds Buch als Gottes Buch, ihre Worte erscheinen als seine Worte. Und das Buch hat an vielen Stellen eine sprachliche Struktur, die die sprechende Instanz (Gott, Seele, „Mechthild“?) nicht klar erkennen lässt. So erscheint die Frage, wer in diesem Buch eigentlich spricht, als zentrale Frage des gesamten Werkes, in der Forschung heftig diskutiert. Diese Offenheit der Sprecherinstanz im Text findet in der mittelalterlichen Überlieferung des Textes eine Entsprechung. Dies zeigt sich, wenn man die Widmung betrachtet, mit der die Einsiedler Handschrift des Textes verschickt worden war:
Den swesteren in der vorderen oͮwe / Ir soͤnt wissen / das das bůch / das úch wart / von der zem Guldin Ringe / das do heist / das liecht der Gotheit / des soͤnt ir wol war [übergeschrieben] nemen / also das es sol dienen in alle húser des waldes / und sol us dem walde niemer kommen / und sol ie ein monat in eim huse sin/ also [wenne man gestrichen] das es umb sol gan / von eim in das ander / wenne man sin bedarf / und soͤnt ir sin sunderlich behůt sin / wand si sunderlich trúwe zů úch hatte / bittent oͮch fúr mich / der ir bichter was / leider unwirdig /
Von mir Her Heinrich von Rumershein von Basel ze sant Peter. 22
Die Handschrift der alemannischen Umschrift ‚geht um‘, sie zirkuliert, sie ist zugleich Mittel der Kommunikation zwischen ihrem Absender, der sie seinerseits nur weiterreicht, und den Empfängerinnen; sie ist im Gebrauch einer bestimmten Gruppe, die sie damit geradezu konstituiert: Sie bildet deren Arkanum, sie oszilliert zwischen Veröffentlichung und Geheimhaltung, zwischen Offenbarung und Geheimnis; sie ist im Gebrauch, aber dieser Gebrauch ist zugleich Heil. Deutlich formuliert wird das im ‘Begleitschreiben’ Heinrichs von Nördlingen:
Ich send euch ain buch das haisst Das liecht der gothait. dar zu zwinget mich das lebend liecht der hitzigen mine Christi, wan es mir das lustigistz tützsch ist und das innerlichst rürend minenschosz, das ich in tützscher sprach ie gelas. eia! ich man euch als des gutz, das got in im selber ist und in diszem buch bewiszt hat. lesent es begirlich mit ainem innern gemerck ewers hertzen und ee irs an vahint ze lesent, so beger ich und gebüit euch in dem heiligen geist, das ir im vii Veni sancte Spiritus mit vii venien vor dem altar sprechent und unserm heren und seiner megdlichen mutter Maria auch vii paternoster und Ave Maria sprechent auch mit vii venien, und der junckfroulicher himelscher orgelkunigin, durch die got ditz himelschs gesang hat usz gesprochen, und allen heiligen mit ir auch vii paternoster und Ave Maria mit vii venien sprechint. und ee brechent das versigelt buch nit uf, ee ir desse gebet tuwend und nemen dar zu alle, die gnad dar zu habint mit ernst, und dar nach vahent an ze lesend sitlichen und nit ze vil […]. uberlesent es dri stund, es stat dran ix. ich getrüwe, es sulle ewer sel gnaden vil mer ernst sein. 23
Mechthilds Mystik, ihr buch, ist Schrift-Mystik,24 es wird von den Rezipienten gar teilweise an die Stelle der Heiligen Schrift gesetzt. Die weitergereichte Handschrift tritt an die Stelle des versiegelten Buches der Offenbarung des Johannes; und wenn das Siegel eröffnet ist, wird Mechthilds Licht im quasi-liturgischen Gebrauch zum Heilsboten, dessen Heilsbotschaft im Nachvollzug des Textes in der gemeinsamen mehrmaligen Lektüre nicht nur zu erlesen ist, sondern erfahrbar und erlebbar wird.
Von den Reflexionen seiner Überlieferer her gesehen also ist Mechthilds Licht ein ausgesprochen lebendiges Wesen, das lebende Buch. Dass es dies auch von der Überlieferung selbst her ist, steht seit langem außer Zweifel: Die Textgeschichte führt von Mechthilds mehrjährigen Aufzeichnungen über einen (oder mehrere) Redaktor(en) zu einer alemannischen Bearbeitung, einer Übersetzung ins Lateinische, eine Rückübersetzung ins Deutsche und so fort. Wie lebendig diese Text- und Überlieferungsgeschichte ist, hat der erwähnte – sensationelle – Fund des Halberstädter Fragmentes in Moskau mit einer mitteldeutsch/niederdeutschen Fassung gezeigt.25
Wer aber hat das bůch gemachet? Nach Aussage des Prologs die gotheit. Beteiligt ist aber auch eine „Ich“ genannte Instanz, und beteiligt sind Schreiber, die nach Aussage dieses Ich das Buch na mir haben geschriben.26 Balász Nemes hat in seiner großen Überlieferungsstudie die Ergebnisse auf den Punkt gebracht:
Der Anteil der an der Buchgenese beteiligten Instanzen ist nicht zu bestimmen. […] Die hier besprochenen Stellen führen uns einen komplexen Schreibprozess vor Augen, der bis in Autornähe zurückreicht und auf eine „tradition vivante“ schließen lässt. Bemerkenswerterweise findet diese ihre Bestätigung in dem aufgezeigten textgeschichtlichen Befund. Demnach müssen wir sowohl auf auktorialer (gemeint ist die Situation Mechthilds als schreibende Frau) als auch auf semiauktorialer (gemeint ist der Fall des Diktats und des Abschreibens mit all ihren Implikationen für die Textgeschichte) sowie auf redaktioneller Ebene (Dominikaner, Helftaer Mitschwestern als Bearbeiter) mit einer kontinuierlichen „Arbeit am Text“ rechnen, einer Arbeit, die auch nach der Veröffentlichung einzelner Werkabschnitte, beispielsweise der Bücher I–VI, fortgesetzt wurde und zur Entstehung von Versionen beigetragen hat. Das immer wieder postulierte Original – Original meint hier nicht den Autortext, sondern den Ausgangspunkt der uns vorliegenden Überlieferung – scheint es offenbar nur im Plural gegeben zu haben.27
Dies sind demnach nicht Ergebnisse, die sich erst aus der Überlieferungsgeschichte ableiten ließen, sondern sie sind dem Text selbst von allem Anfang an eingeschrieben: Das Buch selbst ist die entscheidende Größe; es kommt von Gott, fließt durch den ungelerten munt und wird vom schriber / von den schribern geschrieben. Das Buch selbst aber steht im Mittelpunkt, nicht als (ab)geschlossenes, sondern als werdendes. Der Text heißt – in den Augen der Instanzen, die ihn zu verantworten haben (bei der Autorin, wenn wir sie denn so nennen wollen, bei dem/den Redaktor(en), bei dem/den Schreiber(n) – ein fließendes Licht der Gottheit. Damit wird der prozessuale Charakter eben dieses Textes betont: Es handelt sich um einen Fluss, der von Gott, über die verschiedenen Instanzen des Textes, bis zu seinen Rezipienten fließt. Damit gewinnt das Buch eine Qualität, die in der Mystik gemeinhin der göttlichen Emanation zugeschrieben wird. Mechthilds Text beschreibt nicht den Fluss, er ist der Fluss, er (be)schreibt nicht mystisches Ereignis, er ist mystisches Ereignis. Der Text vereint so Gott und Sprecher und Schreiber und Hörer und Leser im unaufhörlichen Prozess seiner eigenen Buch-Werdung.
Aus all dem ergibt sich auch ein eminent dialogischer (wenn nicht polylogischer) Charakter des Fließenden Licht der Gottheit, den schon Kurt Ruh hervorgehoben hat:
Mechthild verfügt über die verschiedensten Arten des Dialogs und die ihm benachbarten Formen wie die Anrede, das Gebet, den Lobpreis, die ja alle den Partner voraussetzen. Wo Liebe das Thema der Gottesbeziehung ist, wird die Gesprächsform vielfach hymnisch oder auf den Ton des Hoheliedes gestimmt. Die Partnerschaft des Ich bzw. der Seele mit Gott schafft einen personalen Gesprächstyp, der sich nirgends so unmittelbar geäußert hat wie im ‹Fließenden Licht›. Es ist nicht zuletzt dieser Gesprächscharakter der Liebesbeziehung zu Gott, der die Einzigartigkeit Mechthilds ausmacht.28
Diese Einzigartigkeit Mechthilds hat Ruh mit dem dichterischen Charakter ihres Werkes in Verbindung gebracht. Ruh feiert Mechthild geradezu als Dichterin:
Jede Lektüre bestätigt erneut den ungewöhnlichen Rang von Mechthilds ‹Fließendem Licht der Gottheit›, und er gilt weit über ihr Jahrhundert hinaus. An poetischer Kraft hat Mechthild nicht ihresgleichen. Sie ist eine Dichterin, freilich ohne höhere poetische Technik – das unterscheidet sie von Hadewijch –, aber dies ist auch nicht nur ihre Einzigartigkeit, sondern ihre eigentliche Qualifikation. Das Mittelalter hat eine hochentwickelte Kunstlyrik hervorgebracht, und wo uns schlichte Reimereien begegnen, da handelt es sich in der Regel um abgesunkene Kunstformen. Das ist bei Mechthild anders. Wo sie mit Rhythmen und Reimen spielt, wo sie «singt», treten uns Formen und Bilder entgegen, die ihre Welt- und Seelenerfahrung in einer für das Mittelalter sonst nicht bezeugten Unmittelbarkeit spiegeln.29
Dass Mechthild sprachlich dabei von der höfischen Literatur geprägt ist, steht außer Zweifel. Das dürfte sie ihrer adligen Erziehung verdanken. So lässt sich zum Beispiel eine Nähe zur höfisch-ritterlichen Sprache konstatieren:
XVIII. Von des ritters strite mit vollen waffenen wider die begerunge
Ich bat fúr einen menschen, als ich was gebetten, das im got des lichamen beruͤrunge woͤlte benemen, das doch ane sûnde geschiht, des der boͤse wille da zuͦ nit bringet. Do sprach únser herre: »Swig! Behagete dir, das da ein ritter were mit vollen waffenen und von edeler kunst unde mit warer mankraft und mit geringen henden, das der lidig were und versumete sines herren ere und verlúre den richen solt und den edeln lobes schal, den beide, der herre und der ritter, in den landen behaben sol? Mere wa aber were ein ungetroierter man, der von ungerete nie ze strite kam – woͤlte der in fúrsten turneie komen, dem were schiere sin lip benomen. Darumbe muͦs ich der lúten schonen, die so lihte ze valle koment. Die lan ich striten mit den kinden, uf das si ein bluͦmenschappel ze lone gewinnin.«30
Noch deutlicher ist die Nähe zum Bereich des Höfischen, wenn etwa der Hof selbst erwähnt wird oder im Bereich der höfischen Terminologie des Minnesangs. Dies zeigt sich etwa im Buch I,4:
IV. Von der hovereise der sele, an der sich got wiset
Swenne die arme sele kumet ze hove, so ist si wise und wol gezogen. So siht si iren got vroͤlichen ane. Eya, wie lieplich wirt si da enpfangen! So swiget si und gert unmesseklich sines lobes. So wiset er ir mit grosser gerunge sin goͤtlich herze. Das ist gelich dem roten golde, das da brinnet in einem grossen kolefúre. So tuͦt er si in sin gluͤgendes herze. Alse sich der hohe fúrste und die kleine dirne alsust behalsent und vereinet sint als wasser und win, so wirt si ze nihte und kumet von ir selben. Alse si nút mere moͤgi, so ist er minnesiech nach ir, als er ie was, wan im gat zuͦ noch abe. So sprichet si: »Herre, du bist min trut, min gerunge, min vliessender brunne, min sunne und ich bin din spiegel.« Dis ist ein hovereise der minnenden selen, die ane got nút wesen mag.31
Dass Mechthilds Sprache dabei auch durch Kolonreime geprägt ist, hat Hans Neumann in seiner Edition auch optisch deutlich gemacht. Man muss insgesamt von einer Mischform zwischen Prosa und Lyrik ausgehen. Eine einzige Stelle dürfte reichen, um dies zu zeigen:
Do klagte si: »Owe herre, joch bist du mir alze lange vroͤmde; koͤnde ich dich, herre, mit zoͮfere gewinnen, das du nit moͤhtest geruͦwen denne an mir; eya, so gienge es an ein minnen; so muͤstest du mich denne bitten, das ich fuͤre mit sinnen.« Do antwúrt er und sprach alsust: »O du unbewollen tube, nu goͤnne mir des, das ich dich muͤsse sparen; dis ertich mag din noch nit enbern.« Do sprach si: »Eya herre, moͤhte mir das ze einer stunt geschehen, das ich dich nach mines herzen wúnsche moͤhte angesehen und mit armen umbevahen und din goͤtlichen minnelúste muͤsten dur mine sele gan, als es doch menschen in ertrich mag geschehen. Was ich da nach liden woͤlte, das wart nie von menschen oͮgen gesehen; ja, tusent toͤde weren ze lihte. Mir ist, herre, nach dir also we! Nu wil ich in der trúwe stan; maht du es herre, erliden, so las mich lange jamerig nach dir gan. Ich weis das wol, dich muͦs doch, herre, der erste lust nach mir bestan.«32
Die kurzen Beispiele der Kapitel XVII–XX aus Buch I können vielleicht zeigen, mit welcher Intensität Mechthild hier den Dialog zwischen der Seele und dem himmlischen Bräutigam gestaltet und welche sprachgewaltigen Sprachspiele sie dabei auch verwendet.
XVII. Die sele lobet got an fúnf dingen
O du giessender got an diner gabe, o du vliessender got an diner minne, o du brennender got an diner gerunge, o du smelzender got an der einunge mit dinem liebe, o du ruͦwender got an minen brústen, ane dich ich nút wesen mag!
XVIII. Got gelichet die selen fúnf dingen
O du schoͤne rose in dem dorne, o du vliegendes bini in dem honge, o du reinú tube an dinem wesende, o du schoͤnú sunne an dinem schine, o du voller mane an dinem stande, ich mag mich nit von dir gekeren.
XIX. Got liebkoset mit der sele an sehs dingen
Du bist min senftest legerkússin, min minneklichest bette, min heimlichestú ruͦwe, min tiefeste gerunge, min hoͤhste ere! Du bist ein lust miner gotheit, ein trost miner moͤnschheit, ein bach miner hitze!
XX. Dú sele widerlobet got an sehs dingen
Du bist min spiegelberg, min oͮgenweide, ein verlust min selbes, ein turm mines hertzen, ein val und ein verzihunge miner gewalt, min hoͤhste sicherheit! 33
Alois Haas hat anhand solcher und ähnlicher Wendungen des Textes deutlich gemacht, dass der mystische Diskurs, der hier literarische Autonomie und das Niveau der Poetizität gewinnt, paradoxerweise die Dimension der Alterität Gottes in poetische Formen gießt und die Grenze des Sagbaren gerade in der Poesie übersteigt, gleichzeitig auf die dichterische Sprache selbst und die Grenze des Sagbaren aufmerksam macht:34 „Unbeschadet der poetischen Autonomie und gewissermaßen sie bestätigend und gleichzeitig aufhebend wirkt“, so Haas,
das Moment der Transzendenz in der mystischen Aussage: Oft tritt es als Gebot des Schweigens auf, als mystische Sprachfeindlichkeit, die über dem Unsagbaren zu verstummen gebietet, oft aber auch als ein schwer zu bestimmender Mehrwert des Gesagten, als ‚Entrückung‘ des Sprechens selber, erkenntlich an ganz bestimmten Sprachformen wie Negation, Kontradiktion (Paradox), Superlation (‚über‘-Wendungen).35
Ingrid Kasten hat mit Blick auf das mystische Schweigen auf folgende, von sexueller Metaphorik geprägte Stelle hingewiesen:
So gat dú allerliebste zů dem allerschoͤnesten in die verholnen kammeren der unsúnlichen gotheit. Da vindet si der minne bette und minnen gelas, von gotte unmenschliche bereit. So sprichet únser herre: »Stant, vroͮwe sele!« »Was gebútest du, herre?« »Ir soͤnt úch usziehen!« »Herre, wie sol mir denne geschehen?« »Froͮw sele, ir sint so sere genatúrt in mich, das zwúschent úch und mir nihtes nit mag sin. […] Darumbe sont ir von úch legen beide vorhte und schame und alle uswendig tugent; mer alleine die ir binnen úch tragent von nature, (14v) der sont ir eweklich phlegen: Das ist úwer edele begerunge und úwer grundelose girheit; die wil ich eweklich erfúllen mit miner endelosen miltekeit.« »Herre, nu bin ich ein nakent sele und du in dir selben ein wolgezieret got. Únser zweiger gemeinschaft ist das ewige lip ane tot.« So geschihet da ein selig stilli nach ir beider willen. Er gibet sich ir und si git sich ime.36
Ich zitiere Kasten:
Diese Stelle vermittelt einen Eindruck davon, mit welchen Mitteln Mechthild die Intensität und Direktheit der mystischen Liebeserfahrung sprachlich zum Ausdruck bringt. Das Schweigen, die Stille, erscheint hier nicht, wie bei Augustin und später noch bei Eckhart, als Voraussetzung für die Entrückung, sondern als deren Höhepunkt. Es markiert das Intimum, das Unaussprechliche, der Gotteserfahrung. Gelegentlich markiert Mechthild diese Grenze ausdrücklich, indem sie erklärt, der Genuß in der unio sei unsagbar (S. 264) und das allerliebeste müsse sie verschweigen (S. 258), sie macht ferner für die Bräute Christi das Recht geltend, darüber zu schweigen, was sie erfahren (S. 50). Schließlich verweist sie auch auf die Unzulänglichkeit der menschlichen Sprache, die göttliche Wahrheit zu kommunizieren (S. 166): „mich jamert des von herzen sere sid dem male, das ich súndig wip schriben muos, das ich die ware bekantnisse und die heligen erlichen anschouwunge nieman mag geschriben sunder disú wort alleine; sie dunkent mich gegen der ewigen warheit alze kleine.37
Das fließende Licht der Gottheit provoziert bei seiner Empfängerin also mindestens ebenso sehr wie die Sprache das Schweigen. Ohne in stetem Fluss je ein Verstummen zu erlauben.