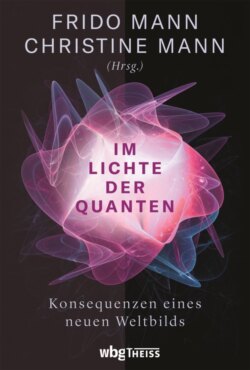Читать книгу Im Lichte der Quanten - Группа авторов - Страница 9
Das Geistige im Rückwärtsgang
ОглавлениеWenn wir uns der Frage zuwenden wollen, ob Geistiges die Grundlage unserer Welt ist, müssen wir uns erst einmal eine genauere Vorstellung davon bilden, was denn das Geistige ist. Es gibt Bereiche, wo man das Geistige sofort erkennt. Die Geisteswissenschaften beschäftigen sich sogar wissenschaftlich mit Geistigem. Dazu zählen zum Beispiel Philosophie, Geschichte und alle Sprachwissenschaften. Diese Gebiete gelten als Geistiges. Aber auch der Naturwissenschaft, der Mathematik oder den Sozialwissenschaften lässt sich durchaus der Charakter geistiger Betätigung zuerkennen, denn das Nachdenken über Fragen aus diesen Gebieten findet weitgehend im Kopf statt. Denken, etwas was im Kopf stattfindet, gehört eindeutig zum Geistigen. Schwieriger wird es, wenn die Gedanken dazu aufgeschrieben werden. Dazu braucht es einen Stift und Papier oder den Computer, also Materie. Und es braucht Energie, um die Finger zu bewegen, die Tasten zu drücken oder den Stift über das Papier zu führen. Aber das wäre völlig sinnlos, wenn nicht die Gedanken die Finger so steuern würden, dass die richtigen Zeichen entstehen, die es anderen Menschen ermöglichen, die Gedanken aus dem Kopf des Schreibers zu verstehen und nachzuvollziehen. Dass die Finger sich bewegen, wird durch biochemische Umsetzung von gespeicherter Energie in Bewegung bewirkt. Aber um eine lesbare Botschaft zu erzeugen, braucht es zusätzlich eine Steuerung, die die Bewegung in feinste Detailbewegungen mit immer wieder unterschiedlicher Richtung und Stärke aufgliedert. Und diese Steuerung geschieht durch die Gedanken. Der Weg von den Gedanken bis zu den Fingern wurde zwar in der Schulzeit mühsam eingeübt, aber welches Zeichen nun realisiert werden soll, welcher dieser eingeübten Wege also durchlaufen werden soll, das wird allein durch die Gedanken bestimmt. Das heißt, die Gedanken können etwas bewirken. Geistiges kann also etwas bewirken.
Es gibt allerdings auch, das soll nicht verschwiegen werden, hochdotierte Hirnforscher, die den Aussagen des letzten Abschnittes nicht zustimmen würden. Sie haben Experimente durchgeführt, die es so aussehen lassen, als ob erst in den Muskeln der Impuls für die Bewegung gegeben würde und dann erst das Denken als ein Epiphänomen hinterherkäme. Biochemische Signale und Impulse würden also meine Hände dazu bringen, all diese Sätze aufzuschreiben, und erst anschließend würde mein Kopf diese Sätze auch noch denken. Diese Idee widerspricht so sehr all dem, was wir erleben, und ist so absurd, dass wir sie hier nicht weiterverfolgen (mehr dazu im dritten Beitrag in diesem Buch.)
Auch das Denken, diese Kopftätigkeit, braucht biochemische Aktivität in den Gehirnzellen, um zu entstehen. Diese biochemischen Aktivitäten werden mit modernen bildgebenden Verfahren sichtbar, aber nicht die Gedanken, die daraus entstehen. Wir können sie nur von dem, der sie gerade denkt, erfahren. Diese Gedanken bestehen nicht aus beobachtbarer Materie oder messbarer Energie. Sie sind etwas anderes. Sie brauchen zwar das aus Materie bestehende Gehirn und die biochemisch messbaren Energien als Grundlage, um entstehen zu können, aber sie sind nicht diese Materie oder diese Energie, sondern etwas, das darüber hinausgeht. Und trotzdem können sie bewirken, dass die biochemisch aktivierte Hand nicht nur Krickelkrakel erzeugt, sondern eine lesbare Zeichenfolge. Wir können also festhalten:
Die Gedanken sind keine Materie, keine physikalisch messbare Energie, sondern etwas Geistiges, aber sie brauchen Materie und Energie als Grundlage und sie können etwas bewirken.
Vielleicht sollten wir diese Aussage noch etwas überprüfen. Sind alle Gedanken etwas Geistiges? Wenn ich mich ärgere und denke „Du Esel!“, ist das etwas Geistiges? Es ist zumindest weder Materie noch physikalisch messbare Energie, sondern etwas darüber hinaus Gehendes, das in meinem Kopf stattfindet. In dieser Hinsicht gleicht es den tiefgründigeren Gedanken, auch wenn die Metapher des von Gott eingehauchten Geistes da nicht mehr so ganz zu passen scheint. Aber wo ist die Grenze zu der als ein Gottesgeschenk empfundenen geistigen Tätigkeit? Und sind erst die Mitglieder unserer Spezies, die solche tiefgründigen Gedanken denken können, wirkliche Menschen und die anderen nicht? Das kann nicht sein. Wir müssen wohl auch diese Art von sehr einfach strukturierten, gefühlsbetonten Gedanken als etwas Geistiges anerkennen.
Das passt auch besser zu der Erkenntnis, dass der Mensch ebenso in der Evolution entstanden ist wie die Tiere und Pflanzen. In der Evolution haben die Vorformen des Menschen sich sicher ebenso Signale gegeben wie heute die Tiere, um auf Gefahr aufmerksam zu machen oder Reviere zu verteidigen. Diese Signale wurden allmählich immer differenzierter, wie zum Beispiel bei den Makaken. Diese, eine in Afrika und Asien lebende Affenart, haben drei unterschiedliche Signale für Gefahr aus der Luft, Gefahr auf dem Boden oder Gefahr von vorne oder hinten, also auf Augenhöhe. Und wenn ein junger Affe eines dieser Signale aus-stößt, werden die Alten zwar aufmerksam, aber erst, wenn ein alter Affe dieses Signal wiederholt, reagiert die ganze Herde mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Denn die Jungen müssen die richtige „Sprache“ erst erlernen, so wie auch die Menschenkinder zunächst durch die Antworten der Erwachsenen ihre Sprache präzisieren und in der richtigen Weise ausdifferenzieren.
Das heißt, dass auch die Makakenkinder ihre „Sprache“, die hier aus drei unterschiedlichen Warnsignalen besteht, lernen. Die Sprache gehört aber, wie wir an dem Ausdruck „Geisteswissenschaften“ gesehen haben, zum Geistigen. Folglich gibt es auch bei den Tieren Geistiges, wenn auch in primitiverer Form als bei den Menschen. Obwohl, wie primitiv, das wissen wir gar nicht so genau, wie folgendes Experiment zeigt: Delphine haben einen eigenen Gesang, der unter Wasser sehr weit getragen wird und mit dem sie sich über große Entfernung hinweg mit Artgenossen zu unterhalten scheinen und diese gelegentlich auch anlocken. Dieser Gesang besteht nicht, wie bei vielen Vögeln, in einfachen, immer wiederholten Signalen, sondern ist sehr komplex. Nun hat man den Gesang eines Delphins aufgenommen und anderen Delphinen vorgespielt. Zunächst wurden die anderen Delphine aufmerksam und antworteten. Aber schon nach der zweiten oder dritten Antwort, die wieder vom Tonband abgespielt wurde, verloren die Delphine jedes Interesse. Es wirkte so, als ob die Tonbandantworten nicht zu dem passen würden, was die echten Delphine auf den ersten Tonbandabschnitt geantwortet hatten. Das hieße aber, dass die Sprache der Delphine doch ziemlich differenziert ist. Man hat ja auch sonst mehrere Belege für die hohe Intelligenz dieser Tiere. Sie scheinen also durchaus geistige Fähigkeiten zu haben. Und auch da ist wieder die Frage: Wo ist die Grenze zum Geistigen? Die Sprache der Delphine scheint eine noch höhere Form des Geistigen zu sein als die drei Warnsignale der Makaken.
Wenn schon die drei Warnsignale als Vorform oder primitive Form des Geistigen gesehen werden müssen, ist dann das Warnsignal des Eichelhähers, der bei Gefahr immer den gleichen Krächzlaut ausstößt, aber dadurch alle Tiere im Wald warnt, auch schon Geistiges? Er nimmt einen Menschen wahr, der den Waldfrieden durch sein Kommen stört, und krächzt. Vermutlich kann er nicht unterscheiden zwischen dem Jäger mit Flinte und dem Liebespaar, das einfach nur die Waldeinsamkeit sucht. Aber offensichtlich kann er unterscheiden zwischen einem Menschen und einem Reh, denn sonst müsste er sehr viel häufiger und sinnlos krächzen, und die Tiere würden aufhören, auf seine Signale zu reagieren.
Auch die Amsel hat einen Warnruf. Wenn sie den ausstößt, hören die Jungen im Nest auf, nach Futter zu fiepen und werden ganz still. Dieser Warnruf gilt der Katze, die im Garten umherschleicht, aber nicht dem Menschen, der unter dem Nest auf der Terrasse sitzt, weil von diesem Menschen keine Gefahr ausgeht. Die Amsel gibt damit ihre Erfahrung an ihre Jungen weiter. Und wenn die Jungen auf den Warnruf hin verstummen, ist das eindeutig ein Überlebensvorteil. Die Jungen mussten ihre Reaktion auf den Warnruf nicht lernen, sondern die ist ihnen angeboren. Trotzdem findet in diesem Moment zwischen den Eltern und den Küken eine Art Kommunikation statt, bei der Erfahrung weitergegeben und damit zum Überleben der Brut genutzt wird.
Sprache ist Kommunikation. Aber offensichtlich gibt es auch Kommunikation ohne Sprache. Die Amsel sendet ein angeborenes Signal aus, die Küken reagieren darauf mit einer angeborenen Reaktion. Ist das schon etwas Geistiges? Spontan spottet das natürlich jeder Vorstellung vom Geistigen. Aber wo ist die Grenze? Die Delphine, die das Interesse verlieren, wenn die Tonbandantwort nicht zu ihren Gesängen passt? Die Makaken, die drei verschiedene Warnrufe entwickelt haben, und diese Sprache erst als Jungtiere richtig lernen müssen. Oder die Amsel, die mit ihrem angeborenen Warnruf ihre gelernte Erfahrung von der gefährlichen Katze, aber dem ungefährlichen Hausbewohner an die Jungen weitergibt? Es wird wohl deutlich, dass das Geistige in Abstufungen existiert. Denn obwohl das Signal und die Reaktion darauf angeboren sind, wird damit eine Information an die Jungen übermittelt, die eine Bedeutung für ihr Überleben hat. Diese Information enthält Lebenserfahrung der Eltern, die damit an die Jungen weitergegeben wird. Und diese Information ist weder Materie noch Energie. Sie ist etwas darüber Hinausgehendes, eine Vorform dessen, was die Menschen sich dann mit der Entwicklung ihrer Sprache zu einer unglaublich reichhaltigen und komplexen Tätigkeit weiterentwickelt haben.
Sprache heißt in diesem Fall, dass mit den Stimm- und Artikulationswerkzeugen Töne produziert werden. Die dadurch in Schwingung gebrachte Luft transportiert die Töne zu den Wahrnehmungskanälen anderer Lebewesen, die die Schwingungen in der Luft hören und an das Gehirn weiterleiten. Aber nicht alle Lebewesen, die den Ton hören, können ihn als ein Signal für eine Botschaft, eine Information nutzen. Am ehesten können das die Artgenossen, in manchen Fällen, wie zum Beispiel beim Eichelhäher, auch andere Tiere. Und ein Vogelkundler wird dem morgendlichen Vogelgesang sehr viel mehr an Information entnehmen können als der davon gerade geweckte Stadtbewohner. Das heißt, nicht die Töne allein sind die Sprache, sondern sie übermitteln eine Information an diejenigen, die sie deuten können. Und diese Information wechselt den Träger. Im Kopf des Senders, also beispielsweise des Vogels, findet eine Wahrnehmung oder ein Impuls, vielleicht sogar etwas wie ein Gedanke statt. Dieser Gedanke führt dazu, dass die Nervenbahnen vom Gehirn zu den Artikulationsorganen aktiviert werden und der Vogel seinen Ruf ausstößt. Dieser Impuls des Vogels und die darauf gegebene Information wechselt also den Träger vom Gehirn in die Nervenbahnen zu den Artikulationsorganen und schließlich zu den Schallwellen der Luft. Bei allen Lebewesen, die diese Schallwellen hören, werden die Schallwellen im Hörorgan in Impulse für die Nervenzellen umgewandelt, die dann wieder die mit den Tönen gegebenen Informationen in das Gehirn des Empfängers weiterleiten. Aber welches Handeln damit ausgelöst wird, hängt von der Bedeutung ab, die der Empfänger dieser Töne ihnen beilegt. Wenn es sich um den morgendlichen Amselgesang handelt, so wird eine andere Amsel, die ihr Nest in der Nähe hat, vielleicht deuten: „Da will mir jemand mein Revier streitig machen, ich muss schnell antworten und damit zeigen, dass das mir gehört.“ Der Arbeiter, der dadurch geweckt wird, wird vielleicht denken: „Ach, die Amseln fangen an zu singen, ich muss gleich aufstehen.“ Und der Vogelkundler wird vielleicht denken: „Oh, da konkurrieren zwei Amseln um das Revier, ich will mal schauen, wo die beiden Nester sind.“
Die Natur hat viele verschiedene Formen solcher Informationsübertragung entwickelt. Die Bienen etwa informieren ihre Kollegen aus dem Bienenstock über einen bestimmten Tanz darüber, wo eine Futterquelle ist. Forscher haben auch entdeckt, dass sogar Pflanzen durch chemische Signale, Duftstoffe oder durch in den Wurzeln weitergeleitete Substanzen ihre Artgenossen in der Umgebung über Fressfeinde informieren. Informieren klingt sehr anthropomorph, so, als ob die Pflanze durch den Duft erfahren würde: „Da ist ein Fressfeind, also muss ich jetzt schnell Abwehrstoffe produzieren.“ So ist das höchstwahrscheinlich nicht, sondern die Duftstoffe lagern sich wohl auf den Blättern der Nachbarpflanze ab und bewirken dort eine kleine biochemische Veränderung, die das Wachstum beeinflusst. Bei der Amsel kann man sich noch vorstellen, dass der Warnruf der Eltern etwas wie Schrecken bei den Küken auslöst, der sie dann zum Schweigen bringt, aber bei den Pflanzen scheint uns das ausgeschlossen. Aber wissen wir es? Trotzdem sprechen Forscher von Kommunikation und Information und das sind Funktionen der Sprache, die wir bei den Menschen als die Grundlage des Geistigen empfinden.
Wir halten also fest: Es gibt das Geistige und das ist weder Materie noch physikalisch messbare Energie, aber es braucht die Materie als Grundlage und kann etwas bewirken. Spontan stellen sich die meisten Menschen unter dem Geistigen Bereiche vor wie Mathematik, Literatur oder Philosophie. Aber es gibt Geistiges auch in einfacherer Form in Abstufungen bei Tieren und Pflanzen und die Grenzen zu dem, was wir als hochgeistig empfinden, sind nicht klar erkennbar.