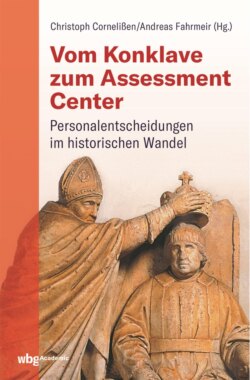Читать книгу Vom Konklave zum Assessment-Center - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Johannes Chrysostomos – Bischof zwischen Scheitern und Heiligung
ОглавлениеHartmut Leppin
Antiochia, das heutige Antakya am türkischen Teil der Ostküste des Mittelmeers, gehörte zu den glanzvollsten Metropolen des spätantiken Reiches und war das Zentrum der historischen Landschaft Syrien, einer der wohlhabendsten ihrer Zeit: Öl und Getreide wurde hier gewonnen; Handelsstraßen bis weit in den Osten begannen in dieser Region. Von dem hellenistischen König Seleukos I. um 300 v. Chr. an der Mündung des Orontes gegründet, besaß Antiochia im 4. Jahrhundert n. Chr., als Johannes Chrysostomos dort wirkte, eine beachtliche wirtschaftliche und strategische Bedeutung. Unschwer gelangte man über das Meer in das kulturelle Zentrum Alexandria und in die Hauptstadt Konstantinopel, doch auch die persische Grenze lag nicht allzu fern. Hohe Beamte der Administration wie der Comes Orientis, der weite Teile der Levante kontrollierte, hatten hier ihren Sitz; immer wieder waren angesichts der Grenznähe Truppen in der Stadt stationiert, einige Kaiser wählten sie zeitweilig als Residenz und bauten sie prachtvoll aus. Antiochia bot vorzügliche Schulen, etwa für Rhetorik. Menschen aus der gesamten antiken Welt strebten in diese Stadt.
Nach wie vor prägten alte Tempel der klassischen Götter öffentliche Plätze, Bäder boten vielfältige Annehmlichkeiten, der kaiserliche Palast stand für die politische Bedeutung.1 Besonderen Ruhm genossen die künstlich beleuchteten Straßen. Doch immer mehr christliche Kirchen zeugten von Glanz und Machtanspruch der neuen Religion. Wer die Stadt verließ, traf auf Asketen, die in den Hügeln und im Hinterland hausten und sich an Strenge überboten. Einige gaben sich absonderlichen, qualvollen Praktiken hin, indem sie lange hungerten, Schlaf mieden, schwere Ketten mit sich schleppten oder aber lebenslanges Schweigen gelobten. Manche verkrochen sich in Höhlen, andere verbrachten ihr Leben auf Säulen, alle übten Keuschheit. Für die gläubigen Christen waren sie noch zu Lebzeiten Heilige, die Wunder wirken und helfen konnten, da sie Gott nahe schienen – wen störte es da, wenn sie kein ordentliches Griechisch sprachen, weil viele aus dem syrischsprachigen Umland kamen?
Konkurrenzlos waren die Christen nicht: Eine florierende jüdische Gemeinde übte mit ihren lebendigen Ritualen auch auf Nicht-Juden eine große Anziehungskraft aus. Es überrascht nicht, dass immer wieder Konflikte aufloderten; antijüdische Stereotypen führten viele Christen im Munde und Übergriffe blieben nicht aus. Heiden gab es in allen Schichten, einige waren durchaus einflussreich. Doch mussten sie erleben, wie ihre Tempel durch die Obrigkeit geschlossen und bisweilen vom Mob attackiert wurden. Und die Christen standen sich selbst im Wege, denn sie waren untereinander zerstritten. Zeitweise agierten drei christliche Bischöfe nebeneinander in Antiochia, die sich gegenseitig zu Häretikern erklärten; persönliche Rivalitäten kamen hinzu. So war das 4. Jahrhundert für Antiochia eine Zeit des Glanzes und des Streites.2
Um 340 wurde Johannes geboren.3 Als Träger eines christlichen Namens wuchs er in dieser spannungsreichen Welt auf. Sein Vater, ein leidlich erfolgreicher Beamter, starb, als Johannes noch ein Kind war. Seine Mutter Anthusa blieb wohlhabend genug, um ihm eine sichere Kindheit und eine gute Ausbildung zu vermitteln. Er studierte bei Libanios, einem der berühmtesten Redner seiner Zeit, der paganen Vorstellungen treu blieb.4 Ob der Heide den künftigen Bischof tatsächlich als seinen begabtesten Schüler betrachtete, wie eine spätere Überlieferung (Sozomenus, Kirchengeschichte 8,2,2) behauptet, steht dahin, aber Sprachgewalt besaß Johannes, und er dürfte sie auch Libanios verdankt haben. Die rhetorische Ausbildung und seine Netzwerke hätten ihm den Weg in die Administration öffnen können. Dort waren diese Karrieren einigermaßen berechenbar, vermittelten Einkommen und Prestige. Weltlichen Ehrgeiz kannte Johannes durchaus und nährte auch ein leidenschaftliches Interesse am Theater, so berichtet er jedenfalls (Über das Priestertum 1,3 f.). Das alles hätte für den Weg in die Verwaltung gesprochen.
Doch Johannes empfing noch andere Einflüsse. Er begegnete engagierten Christen, darunter dem Bischof Meletios, der ihn taufte. Johannes schloss sich damit der sogenannten nizänischen Richtung des Christentums an, die sich unter Theodosius dem Großen (379–395) durchsetzte und für die meisten Kirchen bis heute bestimmend bleiben sollte. Eine Taufe war für einen jungen, gut ausgebildeten Mann keine selbstverständliche Entscheidung. Denn angesichts der Sorge, man könne noch einmal sündigen, ohne dass die Taufe einen reinwusch, verschoben viele die Taufe bis nahe ans Lebensende, und wer ein weltliches Leben führte, musste damit rechnen, sich noch etwas zuschulden kommen zu lassen. Johannes ließ sich jetzt in theologische Fragen einführen. Vor allem aber: Er ging in die Wüste, fast wörtlich. Denn das Hinterland von Antiochia war eine höchst unwirtliche Gegend, keine Sandwüste wie die Sahara, aber ein trockenes, im Sommer heißes, im Winter eisiges Gebiet, wo die Asketen hausten. Die Entscheidung, sich ihnen anzuschließen, traf man selbst. Eine gesellschaftliche Schlüsselposition schloss man für sich damit eigentlich von vornherein aus, doch gesellschaftliche Macht erlangten die heiligen Männer durchaus; gerade weil sie demonstrativ keine diesseitigen Interessen verfolgten, besaß ihr Urteil Gewicht. Heilige Männer konnten selbst Kaiser in die Schranken weisen.
In diese Welt zog es Johannes, doch es war nicht die seine. Die körperlichen Qualen, die unbekömmliche Nahrung setzten ihm zu, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, und so kehrte er nach sechs Jahren wieder in die Stadt zurück. Als Asket war er gescheitert. Gleichwohl lag nahe, einen rhetorisch begabten, frommen Mann wie ihn zum Priester zu machen. Doch verfasste er zunächst eine Schrift über das Amt, in der er dessen Bedeutung herausstrich, um seine mangelnde Eignung zu erweisen. Wie ernst das gemeint war, steht dahin. Zu den erwarteten Eigenschaften christlicher Kleriker gehörte es ja, dass sie ihr Amt demonstrativ nicht anstrebten. So konnte eine Ablehnung durchaus als Bewerbung gelesen werden.
Jedenfalls ließ Johannes sich zum Diakon und 386 zum Priester weihen. Diese Personalentscheidung, die Weihe eines Priesters, lag in der Hand des Bischofs, der die Kandidaten zu prüfen hatte. Allerdings gab es weder einen formalisierten Karriereweg noch eine spezifische Ausbildung. Typischerweise bewährten die Kandidaten sich in niederen Ämtern, wie Johannes als Diakon. Als Priester wurde er zu einem beliebten Prediger, der seiner Gemeinde mit Strenge und rhetorischer Wucht ins Gewissen redete. Seine Worte trafen auf die Bevölkerung einer Stadt, die viel Luxus kannte. Antiochia begegnete er daher mit Ambivalenz: Es war der Raum, in dem er lebte und wirkte, doch es war ein Raum voller Versuchungen und Gefahren. Er strebte danach, sie den strengen Idealen eines christlichen Lebens zu unterwerfen.5 Etliche der Predigten sind erhalten, gewiss redigiert, aber doch mit der Anmutung von Unmittelbarkeit erfüllt.
Als 387 Steuererhöhungen angekündigt wurden, brach ein Aufstand los, bei dem auch Statuen des Kaisers und seiner verstorbenen Frau umgestürzt wurden; das war Majestätsbeleidigung. Der Kaiser drohte, die Stadt gegenüber den Nachbarstädten abzuwerten und ihre Bedeutung zu zerstören. Angst ging um in Antiochia, während der Bischof, nunmehr Flavian, an den kaiserlichen Hof reiste, um bei Theodosius Gnade zu erwirken. Johannes hielt die Stellung und predigte, fast täglich, intensiv, unerbittlich. Verdient hätten die Antiochener eine Strafe angesichts ihrer Sünden, unter denen die Gewaltakte gegen die Statuen nicht einmal die schlimmsten seien, sondern die Sünden wider Gott; umkehren sollten sie, Buße tun, sich Gott anvertrauen, so predigte er. Am Ende konnte er vom Erfolg der Reise des Bischofs zum Kaiser berichten, ein großer Prestigegewinn seiner Gemeinde, dieses Bischofs gegenüber anderen Christen und anderen religiösen Gruppen.6 Der Wechsel von Mahnung und Trost scheint viele überzeugt zu haben. Offenbar goutierten die Christen Antiochias derartige Gemeindebeschimpfungen, zumal wenn es gut ausging. Johannes war es nicht nur erneut gelungen, seine Begabung als Prediger zu zeigen, sondern auch seine Fähigkeit zu beweisen, eine Gemeinde in Zeiten der Not zu führen. Wahrscheinlich war nun jeder von seiner Eignung für das Bischofsamt überzeugt.
Unbestreitbar war und ist seine glanzvolle Sprachbeherrschung, die ihm später den Beinamen Chrysostomos, Goldmund, eintragen sollte. Doch der goldene Mund transportierte manchen Schmutz. Ein anderer Predigtzyklus mehrte den Ruhm des Johannes bei Zeitgenossen und beschädigte seinen Ruf bei der Nachwelt. Er wird traditionell mit Adversus Iudaeos (Gegen die Juden) überschrieben. Tatsächlich enthalten die Homilien üble Beschimpfungen von Juden, die Johannes als rücksichtslose Feinde der Christen hinstellt. Seine tatsächlichen Gegner sind andere: nämlich Christen, die sich zu jüdischen Praktiken hingezogen fühlten, sei es, dass sie jüdischen Lebensregeln folgten, sei es, dass sie die Lebendigkeit der Synagogengottesdienste genossen oder aber den jüdischen Gott als strengen Wächter über Verträge zu schätzen wussten. Dieses Predigtcorpus sollte als ein Grundtext des christlichen Antijudaismus dienen und belegt zugleich die Attraktivität des Judentums zur Zeit des Johannes.
Auch Heiden attackierte der Priester in vielen Predigten. Man sprach sogar von physischen Attacken und der Zerstörung von Heiligtümern unter seiner Führung, die die kaiserliche Gesetzgebung nicht erlaubte, die Regierungspraxis aber duldete.
Die Aggressivität des Priesters zeigt, dass das Christentum noch längst nicht so stark war, wie er sich das vorstellte. Johannes Chrysostomos wirkte in einer Stadt, die religiös durchaus fluide war. Viele Antiochener wollten sich offenbar gar nicht eindeutig als Juden, Christen oder Heiden definieren lassen, sondern nahmen die unterschiedlichen religiösen Angebote flexibel wahr. Hier suchte Johannes zu polarisieren, indem er von den Gläubigen ein eindeutiges, alles andere ausschließendes Bekenntnis zum Christentum seiner, der nizänischen Richtung verlangte. Ihm sollte es auf diese Weise immer wieder gelingen, eine ergebene Anhängerschaft um sich zu scharen, eine potenziell disruptive Basis seiner Macht. In Antiochia aber blieben größere Konflikte aus; seinem Bischof Flavian gegenüber war er offenbar loyal und auch die weltlichen Eliten scheinen ihn geschätzt, zumindest ertragen zu haben. Der Ruhm des Johannes drang bis hin in die Hauptstadt Konstantinopel.
Konstantinopel war älter als Antiochia, denn bereits um 660 v. Chr. hatten Griechen die Stadt als Byzantion gegründet, am Bosporus, wo Asien und Europa sich nähern. Alle Schiffe, die zwischen Ägäis und Schwarzem Meer Handel trieben, mussten durch die Meerenge fahren. Die Stadt erlangte dennoch nie eine größere Bedeutung, bevor Konstantin der Große sie 330 n. Chr. auf seinen Namen als Konstantinopel neu gründete. Sie entwickelte sich im 4. Jahrhundert zur Hauptstadt des Reiches, in der seit Arcadius (395–408) die oströmischen Kaiser fest residierten.
Konstantinopel war eine aufblühende, wachsende Stadt, die eine neue, reiche Elite besaß, deren Angehörige zu einem großen Teil über den Dienst am Kaiser aufgestiegen waren. Auch Konstantinopel hatte kirchliche Konflikte erlebt, aber nicht so heftige wie Antiochia; auch in Konstantinopel gab es Asketen, aber nicht die Radikalität des Asketentums, die man aus Syrien kannte.
Lange Jahre, von 381–397, saß Nectarius auf dem Bischofsthron der Stadt. Er gehörte wie auch sein berühmterer Zeitgenosse Ambrosius von Mailand (im Amt 374–397) zu den ersten Bischöfen, die senatorischer Herkunft waren. Ambrosius ist berühmt dafür, dass er Kaiser ohne Scheu mit seiner Kritik an persönlichem Fehlverhalten konfrontierte, was man gerne mit seiner Sozialisation als selbstbewusster Angehöriger der Eliten in Verbindung bringt. Nectarius war ganz anders, gerade nicht konfrontativ, sondern ausgleichend, ein Mann von Lebensart. Er war auch anders als der Mailänder kein bedeutender Theologe. Dafür verstand er sich mit Geschick in der Hauptstadt zu bewegen und mit den Aristokraten Kontakt zu halten. So war seine Wirkung eher integrativ.
Der Tod des Nectarius löste heftige Nachfolgekämpfe aus. Viele Angehörige des lokalen Klerus machten sich Hoffnungen auf das Amt; der Bischof von Alexandria, Theophilos, versuchte Einfluss zu nehmen. Vielleicht war gerade das der Grund, warum man nach Antiochia blickte, wo Johannes sich so hervorgetan hatte. Dass der Hof, der offenbar einen wesentlichen Einfluss ausübte, an einem Bischof Interesse hatte, der berühmt, aber in der städtischen Gesellschaft nicht verankert war, liegt nahe. Denn ein solcher Amtsinhaber verschaffte der Stadt Glanz und war zugleich ganz auf den Hof angewiesen.
Aufgrund des einmütigen Votums von Klerus und Volk ließ Kaiser Arcadius Johannes holen, berichtet der Kirchenhistoriker Sokrates (6,2,3). 398 empfing er die Weihe; Theophilos musste auch mitwirken. Sokrates erweckt, wenn er in kanonistischer Tradition von Klerus und Volk spricht, den Eindruck eines formalisierten Verfahrens; möglicherweise wollte er gerade dadurch den Druck vonseiten des Hofes verschleiern. Dies war nicht untypisch für spätantike Bischofserhebungen, die eine Semantik der prozeduralen Korrektheit mit einer Praxis politischer Einflussnahme verbanden.
Der heilige Johannes Chrysostomos. Ikonenmalerei, nachbyzantinisch, frühes 16. Jahrhundert
Doch Johannes sollte seine Förderer enttäuschen.7 Denn er besann sich auf seine eigentliche Machtressource, seine spirituelle Autorität, mit der er bestimmte Teile der Bevölkerung fest an sich band. Ihnen machten seine Radikalität und seine Abkehr vom aristokratischen Lebensstil Eindruck. Seine Kritik am Luxus erfreute die weniger Vermögenden und verdross die Reichen, bis auf wenige wie die Witwe Olympias. Sie hatte schon unter Theodosius I. (379–395) nach kurzer Ehe trotz kaiserlichem Drängen die Wiederverheiratung abgelehnt und aus ihrem gewaltigen Vermögen den Armen großzügig gespendet. In Johannes fand sie einen Wahlverwandten, für den sie eine Quelle von Finanzmitteln öffnete, die den Armen halfen und sie näher an ihn banden.8 Auch die gewöhnliche Bevölkerung tadelte er für ihre Freude am populären öffentlichen Unterhaltungsprogramm, an den unziemlichen Reizen des städtischen Lebens; doch auch so etwas begeisterte das Publikum. Die Eignungserwartungen gegenüber dem Bischof in der Stadt gingen offenbar weit auseinander.
So schürte gerade sein weltfeindlicher Habitus das Misstrauen gegenüber Johannes. Einladungen zu Gastmählern lehnte er im Gegensatz zu seinem Vorgänger ab. Da sein asketischer Lebensstil auf Unverständnis stieß, berief er sich schließlich auf Magenprobleme. Der Hof hatte lange zu seinen Unterstützern gehört und erwartete offenbar Dankbarkeit. Doch Chrysostomos setzte sich gegen alle zur Wehr, die er als übergriffig betrachtete. Auch die Kaiserin war über seine Luxuskritik irritiert. Zudem attackierte er den mächtigen kaiserlichen Kammerherrn Eutrop, der den konfessionellen Gegnern des Chrysostomos entgegenkam, überdies das Kirchenasyl einzuschränken suchte. Dieser Konflikt sollte Johannes einen großen symbolischen Triumph bescheren, denn schließlich fand Eutrop sich als Asylsuchender am Altar der Kirche des Johannes Chrysostomos wieder und musste sich dessen Predigt über seine Vergehen und über die Milde des Bischofs anhören.
Wer Eutrop entmachtete, war eine andere einflussreiche Gestalt, die Chrysostomos sich zum Feind machte, ein gewisser Gainas, ein Militär fremder Herkunft, der mit seinen überwiegend gotischen Truppen Konstantinopel dominierte und die Regierung unter Druck setzte, bis hin eben zum Sturz Eutrops. Johannes griff ein, als Gainas für seine Truppen eine eigene, arianische Kirche forderte. Der Bischof setzte ganz auf seine spirituelle Autorität. Gainas ließ von dem Ansinnen ab. Doch geriet die Bevölkerung der Stadt immer mehr in Unruhe; ein Aufstand führte zum Tod von Tausenden Goten. Schließlich wurde Gainas von anderen römischen Truppen gotischer und hunnischer Herkunft besiegt.
Gerade diese Episode zeigt die Möglichkeiten bischöflicher Macht und ihre Grenzen. Sie reichte weit über den Kirchenraum hinaus, aber sie brachte, anachronistisch ausgedrückt, kein allgemeinpolitisches Mandat. Das Handeln des Bischofs hatte politische Auswirkungen; doch beruhte seine Autorität darauf, dass er den Eindruck erweckte, er schere sich nicht darum. Der Bischof war persönlich unangreifbar, doch verfügte er über keine Gewaltressourcen. Seine Unangreifbarkeit beruhte auf seiner Verletzlichkeit: Wer ihn tötete, machte ihn zum Märtyrer und verlor damit sein Gesicht. Es sei denn, man griff ihn auf seinem ureigenen Feld an, dem geistlichen.
Und das sollte geschehen: Denn nicht nur in weltlichen Kreisen hatte Chrysostomos sich Feinde gemacht, sondern auch in kirchlichen. Viele Kleriker waren von seiner brüsken Art irritiert und fühlten sich in ihrem angenehmen Leben gestört, wenn er Korruption und Wohlleben in ihrer Welt beklagte; wer des Amtes in den Augen des Bischofs nicht würdig war, verlor seine Position. In der Stadt umherstreifende Mönche zwang er ins Kloster. Johannes bewies seine bischöfliche Autorität, die nicht allein auf seiner Amtsstellung beruhte, sondern auch auf seinem persönlichen Ansehen und auf seinen finanziellen Mitteln. Gegen die, die er als Glaubensabweichler ansah, ging er unnachsichtig vor. Die Nachbarbistümer erlebten den Hauptstadtbischof als übergriffig, denn er schreckte nicht vor der Absetzung des Bischofs von Ephesos zurück. Zu den Vorwürfen gegen Johannes gehörte überdies die Zweckentfremdung von kirchlichem Besitz. Das betraf, so sagten seine Freunde, Aufwendungen des Johannes für die Krankenfürsorge, die er vielleicht besten Gewissens vorgenommen hatte.
Klagen über ihn trafen auf offene Ohren: Theophilos von Alexandria war nicht versöhnt. Er fühlte sich zusätzlich provoziert, als Chrysostomos Mönche, die wegen Fehlglaubens aus Ägypten vertrieben worden waren, freundlich empfing und bei Olympias unterbrachte. Johannes setzte weiter auf sein Charisma und auf die Unterstützung des Hofes; gerade die Kaiserin hielt ihm trotz aller persönlicher Attacken lange die Treue. So wurde für 403 eine Synode nach Chalkedon in der Nähe von Konstantinopel einberufen, eine der eigenartigsten ihrer Art, die unter dem Namen Eichensynode bekannt wurde, da sie auf einem Gut dieses Namens stattfand. Unter Vorsitz des Chrysostomos sollte Theophilos sich für seine Handlungen verantworten, Konstantinopel sollte über Alexandria richten. Doch damit hatte Chrysostomos sich übernommen. Theophilos kam in die Hauptstadt, unterstützt durch eine starke Schar von Anhängern und auch versehen mit Bestechungsgeldern, wie seine Gegner suggerieren (Palladios, Dialog über das Leben des Johannes Chrysostomos 8). Er begann Chrysostomos zu attackieren. Er drehte die Versammlung, indem er seine ägyptischen Anhänger um sich scharte. Die Wut über den so strengen, so kämpferischen Bischof von Konstantinopel brach sich Bahn. Jetzt hielt Theophilos über Johannes Gericht, Alexandria über Konstantinopel. Johannes weigerte sich, vor dieses Tribunal zu treten – und konnte gerade deswegen verurteilt werden, mit Zustimmung des Kaisers. Er wurde abgesetzt und verbannt.
Proteste der Anhänger des Chrysostomos folgten; man sprach auch von Zeichen Gottes, einem Erdbeben oder einer Fehlgeburt der Kaiserin. Jedenfalls holte man den Bischof eilends zurück: Ein Triumph. Der nur kurz währte. Denn Johannes ließ in seinen Kämpfen nicht nach, sodass er bereits 404 endgültig verbannt wurde, mit der (formal korrekten) Begründung, dass er nach seiner Rückkehr ohne Synodalbeschluss wieder zu predigen begonnen habe. Viele Briefe an seine Anhänger in der Hauptstadt, namentlich an Olympias, schreibend, wurde er, gesundheitlich angegriffen, in immer unwirtlichere Gegenden transportiert. Er vermisste Ärzte und das tägliche Bad. Zunächst war Kukusa im östlichen Kleinasien sein Verbannungsort, doch bald kam der Befehl, dass er noch weiter nach Norden ziehen musste. Auf dem Weg starb er 407.
Als Mönch scheiterte Johannes an sich selbst, als Priester war er erfolgreich und begründete eine kirchliche Karriere. Aufgrund seiner intellektuellen Autorität, die sich mit Rigorosität verband, galt er als Kandidat für das Bischofsamt, doch erwies er sich nach den in Konstantinopel herrschenden Auffassungen als ungeeigneter Amtsinhaber. Denn die diplomatischen und sozialen Funktionen, die man in der Kapitale mit dem Bischofsamt verband, wusste er nicht auszufüllen. Offenbar waren die entsprechenden Erwartungen unausgesprochen geblieben. Die Rolle des »Starpredigers« im reichen Antiochia schien ihn hinreichend für die glanzvolle Aufgabe des hauptstädtischen, dem Kaiser wie den Eliten nahen Bischofs vorzubereiten. Doch beruhte diese Rolle gerade auf der Rigorosität, die es ihm nicht erlaubte, sich in die luxuriöse Welt Konstantinopels zu integrieren. Hätte er das getan, wäre er charakterlich gescheitert und unglaubwürdig geworden. Insofern stand er, vermutlich ohne es vorher zu wissen, mit der Berufung in die Hauptstadt vor einem unlösbaren Dilemma, das in den widersprüchlichen Anforderungen eines Bischofsamtes in einer sozial angesehenen und reichen Kirche lag: Betstuhl und Bankett waren nicht leicht zu vereinbaren.
Die amtlichen und die spirituellen Funktionen standen in einer unauflöslichen Spannung, in der Person des Johannes, aber auch im Bischofsamt als solchem. Indem man davon ausging, dass Gott auf das Verfahren der Bischofserhebung Einfluss nahm, hoffte man, das Dilemma zu beseitigen und gerade durch ein Verfahren denjenigen zu identifizieren, der geeignet war.9 Doch in der Praxis bewährte sich das nicht, und viele Bischöfe gaben sich mit ihren administrativen und finanziellen Funktionen Blößen, die es leicht machten, sie auf der spirituellen Ebene zu kritisieren.
Zu Lebzeiten war Johannes an diesen Dilemmata gescheitert. Doch war er wirklich gescheitert? 438 holte der Sohn von Eudoxia und Arcadius, Theodosius II., die Reliquien des Verbannten nach Konstantinopel zurück, wo sie höchste Verehrung erfuhren. Johannes Chrysostomos galt als Heiliger und ist es fortan in den Augen vieler Kirchen geblieben. Was konnte es Größeres geben für einen frommen Christen? Damit war aus frommer Sicht alles weltliche Scheitern kompensiert.
1Zur Stadt Gunnar Brands, Antiochia in der Spätantike. Prolegomena zu einer archäologischen Stadtgeschichte, Berlin, Boston 2016; Frauke Krautheim, Das öffentliche Auftreten des Christentums im spätantiken Antiochia. Eine Studie unter besonderer Berücksichtigung der Agonmetaphorik in ausgewählten Märtyrerpredigten des Johannes Chrysostomos, Tübingen 2018 (STAC 109).
2Christine Shepardson, Controlling Contested Places. Late Antique Antioch and the Spatial Politics of Religious Controversy, Berkeley u. a. 2014.
3Zu ihm John Kelly, Golden Mouth. The Story of John Chrysostom. Ascetic, Preacher, Bishop, Ithaca, New York 1995; Aideen Hartney, John Chrysostom and the Transformation of the City, London 2004; als Überblick über die jüngere Forschung vor allem zu den Predigten Chris De Wet und Wendy Mayer (Hgg.), Revisioning John Chrysostom. New Approaches, New Perspectives, Leiden, Boston 2019 (Critical Approaches to Early Christianity 1). Pauline Allen und Wendy Mayer, John Chrysostom, London 1999 verbindet eine Einführung mit einer durchdachten Textauswahl.
4Heinz-Günther Nesselrath, Libanios. Zeuge einer schwindenden Welt, Stuttgart 2012.
5Jan R. Stenger, Johannes Chrysostomos und die Christianisierung der Polis. »Damit die Städte Städte werden«, Tübingen 2019 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 115).
6Zu dem Ereignis Hartmut Leppin, Steuern, Aufstand und Rhetoren. Der Antiochener Steueraufstand von 387 in heidnischer und christlicher Sicht, in: Gedeutete Realität. Krisen, Wirklichkeiten, Interpretationen (3.–6. Jh. n. Chr.), hg. von Hartwin Brandt, Stuttgart 1999 (Historia ES 134), S. 103–123; Stenger, Johannes Chrysostomos, 174–237.
7Zu dieser Zeit Claudia Tiersch, Johannes Chrysostomus in Konstantinopel (398–404). Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches, Tübingen 2002 (STAC 6); Wolfgang Liebeschuetz, Ambrose and John Chrysostom, Oxford 2011.
8Heike Grieser, Olympias. In: Reallexikon für Antike und Christentum 26 (2015), S. 125–131.
9Zu diesen Dilemmata Hartmut Leppin, Personalentscheidungen und Kontingenzbewältigung unter frühen Christusanhängern, in: Ermöglichen und Verhindern. Vom Umgang mit Kontingenz, hgg. von Markus Bernhardt, Stefan Brakensiek und Benjamin Scheller, Frankfurt am Main 2016, S. 49–81; ders., Zu den Anfängen der Bischofsbestellung, in: Personalentscheidungen für gesellschaftliche Schlüsselpositionen. Institutionen, Semantiken, Praktiken, hg. von Andreas Fahrmeir, Berlin, Boston 2017 (HZ, Beih. 70), S. 33–53.