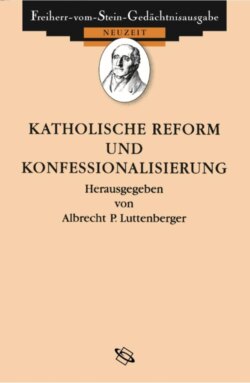Читать книгу Katholische Reform und Konfessionalisierung - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINLEITUNG
ОглавлениеDer Versuch, in Grundzügen die Entwicklung des Katholizismus im Reich von der Mitte des 15. und bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts unter dem Titel „Katholische Reform und Konfessionalisierung“ zu dokumentieren, bedarf der konzeptionellen Erläuterung und Begründung. Dies gilt zunächst vor allem für die Entscheidung, zur Charakterisierung der katholischen Reformbewegung der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und des 17. Jahrhunderts auf den Begriff „Gegenreformation“ zu verzichten und ihn durch „katholische Konfessionalisierung“ zu ersetzen. Im Selbstverständnis der älteren katholischen Historiographie galt die Beschränkung auf den Begriff „Gegenreformation“ seit je als ungeeignet, ja geradezu irreführend, weil sie auf ein historiographisches Konzept verwies, das die nachtridentinische Reformbewegung als bloße Reaktion auf die lutherische Reformation erklärte, ihre militanten Formen stark betonte, eine spezifische Tendenz zur Politisierung der Religion unterstellte und eine genuin katholische Reformkontinuität nicht anerkennen mochte oder als rückwärts gewandt und reaktionär diskreditierte. Hubert Jedin plädierte deshalb für die Formel „Katholische Reform und Gegenreformation“, um das kirchliche Reformanliegen stärker hervorzuheben, und fand damit weithin Zustimmung.1 Dafür waren vor allem Aspekte der kirchengeschichtlichen Reflexion maßgeblich. Unter dem Eindruck der vielfältigen Außenwirkungen frühneuzeitlicher Kirchlichkeit stellten vor mehr als zwei Jahrzehnten Wolfgang Reinhard und Heinz Schilling als Alternative zur vornehmlich kirchengeschichtlichen Perspektive ein Interpretationskonzept zur Diskussion, das – unter Bezug auf die Rationalisierungstheorie Max Webers, das von Gerhard Oestreich entworfene Konzept der Sozialdisziplinierung, die Systemtheorie Niklas Luhmanns und die Arbeiten Ernst Walter Zeedens über die Konfessionsbildung – die Frage nach der sozialgeschichtlichen Relevanz kirchlicher Reformen ins Zentrum des Interesses rückte und den älteren Ansatz, der die „Rückständigkeit“ der nachtridentinischen römischen Kirche und die „Modernität“ des Protestantismus kontrastierte, obsolet machte.2 Fragt man nämlich nicht ausschließlich nach den theologischen Prämissen und Implikationen der konfessionellen Differenzen und konzentriert stattdessen das Forschungsinteresse vorrangig auf die Frage nach den sozialgeschichtlich bedeutsamen Auswirkungen und Folgen konfessioneller Pluralität, so zeigen sich in der auf den entstandenen Konkurrenzdruck reagierenden Bemühung aller drei Großkonfessionen um Konsolidierung, Expansion und Selbstbehauptung strukturelle Gemeinsamkeiten, die sich in ihrer Bündelung als innovatorische Impulse in der Entwicklung zur Moderne deuten und beschreiben lassen. Solche Parallelen, die für die Formation der Großkonfessionen charakteristisch scheinen, liegen etwa in der Intention, das je eigene dogmatische und theoretische Profil nach außen im Interesse der Abgrenzung zu präzisieren und intern verbindlich zu machen; in dem Bestreben, die Durchsetzung der eigenen Normen durch effektive Kontrollen (Zensur, Visitation etc.) zu sichern; in der Organisation einer sorgfältigen Ausbildung und Überwachung qualifizierter Multiplikatoren (Pfarrer, Lehrer, Beamte etc.), in einer zweckdienlichen und zielbewussten Gestaltung des Bildungswesens zur Vermittlung und Internalisierung konfessionsspezifischer Werte und Anforderungen; in dem Anliegen, die Affekte zu disziplinieren; in der intensiven Entfaltung propagandistischer Aktivitäten; in der Verdichtung der kirchlichen Administration durch Verschriftlichung und Bürokratisierung; in der Strategie, die Gruppenkohärenz durch die Betonung sinnfälliger ritueller Differenzen zu konsolidieren, und nicht zuletzt im Beitrag zur Stärkung frühmoderner Staatlichkeit, die durch ihren gesteigerten Einfluss auf die kirchliche Ordnung, durch die Erschließung der Ressourcen des kirchlichen Vermögens, durch die Sakralisierung der Obrigkeit und durch die konfessionelle Vereinheitlichung des Untertanenverbandes einen beachtlichen Zuwachs an Durchsetzungsvermögen und Macht gewinnen konnte.3 Die sozialgeschichtlich bedeutsame Wirkung, die aus dem Prozess der Konfessionalisierung resultierte, lässt sich demnach als Innovationsschub interpretieren, dem im Kontext der Genese der Moderne – nicht nur im Rahmen der Staatsbildung, sondern auch im Sinne einer Umerziehung zu diszipliniertem sozialem Verhalten – ein hohes Gewicht zugerechnet wird. Die fortschreitende Differenzierung des Konzepts, die unter anderem auch die Berücksichtigung mentalitätsgeschichtlicher Fragen, interkonfessioneller Differenzen und anthropologischer Aspekte mit einschließt,4 könnte diesen Befund weiter unterstreichen, freilich auch zu gewissen Modifikationen oder Akzentverschiebungen zwingen. In jedem Fall erfasst das skizzierte Konzept im Wesentlichen auch jene Sachverhalte, die bislang unter dem Begriff „Gegenreformation“ subsumiert wurden, also die Strategien und Aktivitäten zur Selbstbehauptung und Neupositionierung der römischen Kirche gegenüber den protestantischen Großkonfessionen und Denominationen, einschließlich der Formen militanter Rekatholisierung und aggressiver Repression. Zugleich eröffnet es neue Perspektiven. Es empfiehlt sich deshalb, dem Begriff „Konfessionalisierung“, der sich auf den gesamten Prozess der Katholisierung beziehen lässt und diesen nicht auf eine nur nach außen gerichtete antiprotestantische Offensive verkürzt, den Vorzug zu geben.
Allerdings ist zu beachten, dass die Reichweite des Konfessionalisierungskonzeptes begrenzt bleibt. Die Genese und der Ausbau frühmoderner Staatlichkeit und der postulierte Prozess sozialer Disziplinierung zu selbstreflektierter Lebensführung, Affektkontrolle und Fügsamkeit lassen sich kaum ausschließlich oder primär aus der Konfessionalisierung bzw. aus dem Vollzug konfessioneller Standards erklären. Festzuhalten bleibt vielmehr, dass im Gesamtbild nicht nur diejenigen Bereiche und Sektoren einzurechnen sind, die wie z. B. die späthumanistische Gelehrsamkeit, das staatliche Finanzwesen („Finanzstaat“), die wirtschaftliche Ordnung etc. einer tiefgreifenden konfessionellen Prägung unzugänglich waren, sondern auch die außerkonfessionellen Faktoren und Konzepte, deren Rationalisierungspotential die sich anbahnende Entwicklung zur Moderne nachhaltig beeinflusste.5 Die Konfessionalisierung erweist sich so, im Rahmen eines Faktorenspektrums, als ein – freilich wichtiger – Beitrag zu diesem Prozess. Eine „fundamentale“ Steuerungsfunktion kam ihr in der Vorbereitung der Moderne aber offenbar nicht zu. Über konfessionalisierende Strategien konnte jedenfalls nur ein Teil des allgemeinen Ordnungsbedarfs bewältigt werden, der aus der Vielfalt der Veränderungen seit dem 15. Jahrhundert resultierte und der die Obrigkeiten zu regulierenden Initiativen motivierte. Der Zugewinn der weltlichen Gewalt an institutioneller Kompetenz erklärt sich nur zum Teil aus ihrer intensivierten religionspolitischen Aktivität. Damit ist nicht in Abrede gestellt, dass konfessionelle Homogenisierung kollektive Identität stiften und die innere Kohärenz des politischen Gemeinwesens festigen konnte, dass in der Regel kirchliche und staatliche Initiativen sich – freilich in fallweise unterschiedlichem Grade – wechselseitig stützten und dass davon die obrigkeitliche Autorität im Aufbau frühmoderner Staatlichkeit erheblich profitieren konnte. Das im Übrigen bereits im 15. Jahrhundert erkennbare Interesse weltlicher Obrigkeiten an der Ausweitung der staatlichen Rechte und Ansprüche im Zugriff auf die kirchlichen Ressourcen durch Besteuerung und Umwidmung von Kirchengut, in der Jurisdiktion und in der Einflussnahme auf die personelle Rekrutierung stieß allerdings im katholischen Raum in der institutionellen und rechtlichen Eigenständigkeit der Ecclesia Romana auf eine grundsätzliche Grenze, die ohne konfessionellen Bruch nicht negiert werden konnte. Zudem konnte das Papsttum als potentielles Gegengewicht gegen übermäßigen staatlichen Druck fungieren.
Der aktuelle Forschungsstand vermittelt darüber hinaus den Eindruck, dass die Durchsetzung konfessioneller Normen nicht als ein von oben organisierter Zwangsmechanismus mit Erfolgsgarantie vorzustellen ist, der die Mentalität der Untertanen völlig neu imprägnierte, sondern als ein langfristiger Kommunikationsprozess, der den Betroffenen Raum ließ zur Selektion, zur Modifikation und Resistenz, auch Kompromisse und Abstriche vom offiziellen Konfessionalisierungsprogramm notwendig machte, so dass konfessionsintern mit unterschiedlichen Rezeptionsgraden und Rezeptionsformen zu rechnen ist.6 Von oben betriebene Disziplinierung und kollektive Identitätsbildung verlaufen offenbar nicht synchron. Demnach ist die Wirkung des obrigkeitlichen Disziplinierungspotentials als relative Größe zu werten. Verhaltenswandel durch Einübung von Normen, die als modern gelten, ist als gesamtgesellschaftliches Phänomen wohl nur auf lange Frist nachweisbar und nicht monokausal zu erklären. Der Anteil, der dabei der Konfessionalisierung zukommt, sollte nicht übersehen, aber auch nicht pauschal überschätzt werden.
Zudem ergab sich der Funktionszusammenhang zwischen Staatlichkeit und Religion, der in einem symbiotischen Kooperationsverhältnis zwischen Staat und Kirche wirksam wurde, nicht erst aus der Konfessionalisierung, sondern verweist zurück auf ein vorkonfessionelles, deshalb später konfessionsübergreifendes religiös definiertes Ordnungsverständnis, das dem religiösen Konsens zentrale Bedeutung für die politische Stabilität des Gemeinwesens beimaß und die Obrigkeit zu der Bemühung verpflichtete, die Untertanen zu Rechtgläubigkeit und moralischer Integrität anzuhalten, um im Interesse am Gemeinwohl die Strafe Gottes abzuwenden.7 Im Zuge der kirchlichen Spaltung ließ sich dieser Politikbegriff, der die Religion als gesellschaftlich und politisch zentralen Ordnungsfaktor definierte, bruchlos konfessionell aufladen und entsprechend schärfer profilieren. Dabei blieb allerdings im katholischen Raum der religiös-theologische Kernbereich der Dogmatik, der Liturgie und der Verkündigung dem Zugriff der weltlichen Gewalt grundsätzlich entzogen. Die Definitionskompetenz lag hier eindeutig beim Klerus. Dieses inhaltliche Reservat ließ sich dann im 18. Jahrhundert gegen die modernisierenden Konzepte der Aufklärung ausspielen.
Um die Konfessionalisierung als Prozess sozialer Disziplinierung zu begreifen, mag es hinreichen, sich vornehmlich auf ihre Verfahren zu konzentrieren und die Frage nach theologiegeschichtlichen Entwicklungslinien und individuellen Aktivitäten nur nachrangig zu berücksichtigen oder einem planvollen arbeitsteiligen Procedere der traditionellen Kirchengeschichte anzuvertrauen.8 Es mag auch angehen, dabei die Intentionen der Akteure nicht in den Vordergrund zu rücken, sondern vorrangig die faktischen Konsequenzen ihres Vorgehens und Handelns, die nicht immer beabsichtigt sein müssen, unter Umständen sogar ursprünglichen Zielsetzungen zuwiderlaufen können, zu analysieren und zu beschreiben.9 Aber für ein Gesamtbild konfessioneller Kirchlichkeit und Religiosität bleibt solcher Ansatz notwendigerweise defizitär.10 Denn für die zeitgenössischen Akteure in allen drei Großkonfessionen galt die Zielsetzung als ausgemacht, die Gesellschaft im rechtverstandenen Sinne zu christianisieren, d. h. im Lichte ihrer jeweiligen theologischen Überzeugungen ihren Mitmenschen den Weg zum Seelenheil zu weisen und sie zu einer entsprechenden Lebensgestaltung aufzurufen.11 Gedacht war dabei nicht nur vordergründig an den korrekten äußerlichen Vollzug konfessionsspezifischer Vorschriften, sondern an eine spirituelle Erneuerung in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aus der Logik dieses Initialanliegens und der Divergenz seiner konfessionellen Prägung ergaben sich die Verfahren der Konfessionalisierung, die in der neuen Konstellation religiöser Konkurrenz nicht zuletzt den rechtgläubigen, heilswirksamen Gottesdienst und den Schutz der Gesellschaft vor Irrlehren zu gewährleisten hatten. Die dafür maßgeblichen Kriterien definierte die jeweilige religiös-theologische Option, die sich demnach aus dem Grundmuster der beginnenden Konfessionalisierung als Wirkungsfaktor nicht grundsätzlich ausklammern lässt. Im Übrigen differierten entsprechend den divergierenden theologischen Prämissen die konfessionellen Angebote zur praktischen Lebensbewältigung und die konfessionsspezifischen Ordnungsmuster, die in der Gesellschaft umgesetzt werden sollten. Deshalb behält das Interesse an den Theologumena, die den eingeforderten konfessionellen Normen und Standards zugrunde lagen, und damit die theologie- und kirchengeschichtliche Perspektive für die Beschäftigung mit der Konfessionalisierung neben der Frage nach ihrem Beitrag zur Vormoderne substantielle Bedeutung.
Diese ideell-religiöse Dimension und ihre lebensweltlichen Implikationen meint der im Bandtitel verwendete Begriff „Katholische Reform“, der im Übrigen zugleich die personalen Komponenten, individuelles und kollektives Engagement, Führungsrollen und -ansprüche und spezifische personale Konstellationen im innerkirchlichen Raum mit abdeckt. Er hat zudem den Vorzug, den Blick nicht nur auf die innovatorischen Elemente in der Ausformung des frühneuzeitlichen Katholizismus zu lenken, sondern ihn auch offen zu halten für Alternativen im Möglichkeitsspektrum altkirchlicher Reform, die wie der humanistische Evangelismus später ausgegrenzt wurden, und für diejenigen Elemente der katholischen Konfessionalisierung, die sich nicht als Reaktion auf den durch die protestantische Reformation erzeugten Konkurrenzdruck erklären lassen, sondern zurückverweisen auf spätmittelalterliche Reformbestrebungen und ihre Spiritualität, auf fortwirkende theologische Entwürfe und auf die Beharrungskraft kirchlicher Strukturen. Die katholische Reform schuf keine neue Kirche, wohl aber eine neue – konfessionelle – Kultur, die sich allerdings auf einen ausgeprägten Traditionsbezug stützte.
Diese Kontinuität war verbürgt in der unveränderten Verbindlichkeit des Kirchenrechtes, in den beibehaltenen organisatorischen Strukturen der kirchlichen Hierarchie (im Reich mit den Besonderheiten der Adelskirche), im Fortbestand der alten Orden, im Rückgriff auf die scholastische Theologie, in den nach wie vor anerkannten Verfahren kirchlicher Meinungsbildung und Kontrolle durch Synoden und Visitationen und im Fortleben vertrauter Frömmigkeitsformen, die den lebensweltlichen Bedürfnissen der einfachen Laien entgegenkamen. Dieser restaurativen Prägung korrespondierte ein innovatorisches Potential, das unabhängig von der deutschen Reformation in Italien und Spanien in Konzepten und Bewegungen vorgeformt war, die auf ein aktives christliches Wirken in der Welt in Seelsorge und Sozialfürsorge abzielten bzw. unter dem Einfluss älterer Strömungen wie der Devotio moderna oder der franziskanischen Überlieferung eine erneuerte Spiritualität einforderten. Schon in dieser frühen Phase der Neuorientierung propagierten italienische Katecheten die Maxime, dass fundiertes religiöses Wissen unverzichtbare Voraussetzung einer erfolgreichen Bemühung um das Seelenheil sei. Damit war eine Schlüsselstrategie in die Reformplanung eingeführt, deren Logik die Verantwortlichen überzeugte und die in der Folgezeit vor allem die Jesuiten systematisch weiterentwickelten, um durch Ausbau und Optimierung vor allem des höheren Bildungswesens, zudem durch die Katechese in den Pfarreien die Katholisierung der Gesellschaft voranzutreiben und zugleich die Expansion des Protestantismus abzuwehren. Dieser doppelten Zielsetzung dienten auch, durch die aus vorreformatorischen Wurzeln stammende jesuitische bzw. kapuzinische Spiritualität nachhaltig inspiriert, die Bemühungen um die Vertiefung der Religiosität durch die intensive Förderung bestimmter, bereits im 15. Jahrhundert eingeübter, christozentrischer, eucharistischer und marianischer Frömmigkeitsformen, die zugleich als konfessionsspezifische Abgrenzungsmerkmale wahrgenommen werden sollten. Die beiden Beispiele mögen genügen, um zu illustrieren, wie ursprünglich reformationsunabhängige Impulse zur katholischen Selbsterneuerung unter dem Eindruck der konfessionellen Konkurrenz in das Programm der katholischen Konfessionalisierung mit antiprotestantischer Spitze übersetzt wurden.
Wie die protestantischen Denominationen lässt sich auch die katholische Reform als Antwort auf das zeitgenössische Bedürfnis nach Bewältigung einer komplexer gewordenen Welt deuten. Das Ordnungspotential, das die kirchliche Reform einbringen konnte, lag im Interesse der politischen Obrigkeit an der Versittlichung der Untertanen und an der Stabilisierung des Gemeinwesens. Schon im 15. Jahrhundert drängte das frühe landesherrliche Kirchenregiment auf die Korrektur kirchlicher Fehlentwicklungen und unterstützte vor allem die Ordensreform. Auch später nutzten die katholischen Reformer das Kooperationsangebot weltlicher Regierungen, die ihrerseits ohne ein von kirchlicher Seite getragenes Konzept der Erneuerung und Katholisierung nicht auskamen. Zu beachten ist freilich auch der parallele Trend, der sich zum Teil aus Anregungen des Trienter Konzils ableitete und auf die Stärkung der inneren Strukturen der römischen Kirche, der Pfarreien, der bischöflichen Gewalt und des Papsttums hinauslief. Trotz aller für notwendig gehaltenen Anpassungs- und Konzessionsbereitschaft im Umgang mit den Forderungen staatlicher Instanzen und ihren territorialkirchlichen Ambitionen konnte die römische Kirche ihre geistige und prinzipiell auch ihre rechtliche Eigenständigkeit gegenüber weltlichen Herrschern durchaus bewahren. Jedenfalls war in den altgläubigen Territorien des Reiches an eine völlige Verstaatlichung der Kirche nicht zu denken.
Unter den katholischen Reformkräften spielten die neuen Orden, deren Gründung nicht als Reflex auf die Reformation interpretiert werden kann, und die neuen Frauenkongregationen, die in der Sozialfürsorge und in der Mädchenbildung eingesetzt werden sollten, eine maßgebliche Rolle. Ihnen vor allem verdankte die katholische Reform die Energie, die für eine erfolgversprechende Basisarbeit zur Verwirklichung ihrer pastoralen und erzieherischen Intentionen erforderlich war.
Die etablierten Prälaten- und Bettelorden konnten auf ihre im 15. Jahrhundert, z. B. in der Bursfelder Kongregation oder in der Observanz der Franziskaner und Dominikaner entwickelten Reformstandards aufbauen. Dabei konnten sie von Reformbestrebungen, die außerhalb des Reiches zum Erfolg führten, vielfach profitieren, wenn es galt, ältere Konzepte zu modifizieren und neuen Erfordernissen anzupassen. Daraus konnte sich keine Neuschöpfung ergeben, wohl aber eine bewusste Umorientierung und eine selbstkritische Neubesinnung auf die tradierten ordenseigenen Ideale.
Dieser knappe Abriss zeigt, dass es nicht angeht, die katholische Reform auf ihren Bezug zur Reformation zu verkürzen. Ihre Interpretation setzt die Kenntnis ihrer Traditionsbindung und ihrer vorreformatorischen und vortridentinischen Wurzeln voraus, weil spätmittelalterliche Entwürfe auch in der Phase der Konfessionalisierung noch aktuell blieben. Die altkirchliche Reformdiskussion umgreift einen längeren Zeitraum als die katholische Konfessionalisierung, deren Antrieb und Kern sie bleibt, wenn auch in neuer Profilierung unter veränderten Bedingungen. Sie reicht zurück bis in die Reformbewegungen des 15. Jahrhunderts. Die Substanz ihrer Entwürfe blieb in vielen Belangen langfristig aktuell. Diesem Befund entspricht die Entscheidung, ihre Dokumentation mit Quellen aus der Zeit um 1450 zu beginnen. Damit wird zwar die schwerpunktmäßig konziliar geführte, intensive Reformdiskussion der ersten Jahrhunderthälfte ausgespart, dies scheint aber vor allem aus zwei Gründen vertretbar. Erstens: Wichtige Reformimpulse und -konzeptionen, die in die Zeit um 1400 zurückreichen, lassen sich durch aufschlussreiche, einschlägige Quellen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts instruktiv belegen, sind also in ihrer fortdauernden Wirkung noch konkret genug greifbar. Zweitens: Das Scheitern des Basler Konzils und des Konziliarismus verursachte im Diskurs über die kirchliche Reform einen Paradigmenwechsel. Die bis dahin propagierte Maxime, dass eine durchgreifende Gesamtreform der Kirche beim Papsttum und bei der Kurie ansetzen müsse und dass zu ihrer Planung und Durchführung nur das Generalkonzil befugt sei,12 bot keine Perspektive mehr, der eine überzeugende Realisierungswahrscheinlichkeit zugerechnet werden konnte. Die Aufgabe einer Gesamtreform der Kirche fiel damit eigentlich dem Papsttum zu. Da sich die Päpste aber dieser Aufgabe nicht mit der gebotenen Energie annahmen, verschoben sich Reforminteresse und Reformverantwortung auf die nationale Ebene wie in Spanien oder auf die territoriale bzw. lokale Ebene wie im Reich. Der im päpstlichen Auftrag unternommenen Legation des Kardinals Nikolaus von Kues nach Deutschland 1451 / 1452 fehlte die zusammenfassende Kraft einer systematisch angelegten, zentral verantworteten Operation. So blieben ihre im Einzelnen durchaus bemerkenswerten Reformanstöße letztlich doch nur ephemer.13 Jedenfalls wurden in der Folgezeit neben den Bischöfen die weltlichen Obrigkeiten in verstärktem Maße Ansprech- und Kooperationspartner der innerkirchlichen Reformkräfte, die sich – ohne planmäßige und systematische zentrale Koordination und Steuerung – nur im partikularen Rahmen verwirklichen konnten, dabei aber stets auf kirchenrechtliche Legalität zu achten hatten und sich deshalb der schwer kalkulierbaren, häufig widersprüchlichen Entscheidungsfindung und Spruchpraxis der römischen Kurie kaum entziehen konnten. Dieser Bedingungsrahmen prägte die kirchlichen Reformbemühungen nach 1450 strukturell in signifikanter Weise.
Die zweite zeitliche Grenze der Dokumentation kann in der Mitte des 17. Jahrhunderts angesetzt werden, wenn man davon ausgehen darf, dass um 1650 die Grundlagen für die konfessionelle Durchdringung der Gesellschaft gelegt und im Großen und Ganzen durchgesetzt waren. Dabei ist eingeräumt, dass der Prozess der Katholisierung, was die Internalisierung der propagierten Normen angeht, noch Jahrzehnte in Anspruch nahm und bis weit ins 18. Jahrhundert hineinreichte.14 Die gewählte Terminierung orientiert sich auch an der in der französischen Forschung vorgeschlagenen Periodisierung, die den Zeitraum von 1400 bis 1650 als „Temps des Réformes“ zusammenfasst.15 In dieser übergreifenden Perspektive erscheint die reformatorische Bewegung der zwanziger Jahre als Kulminationspunkt der spätmittelalterlichen Reformbestrebungen und zugleich als zukunftsträchtige, innovatorische Weichenstellung, die die Einheit der universalen Kirche aufbrach und damit jene Konkurrenz zwischen verschiedenen kirchlichen Denominationen auslöste, die den Prozess der Konfessionalisierung stimulierte.16
Da es dem Papsttum gelang, die in Konstanz und Basel vehement geforderte grundlegende Reform der Kurie zu umgehen, verlagerte sich die Reforminitiative auf die „reformatio in membris“. Dass die einschlägigen Basler Dekrete relativ früh auf deutschen Diözesan- und Provinzialsynoden rezipiert wurden, initiierte keine durch die konziliare Kompetenz legitimierte breite Reformbewegung.17 Das Papsttum belastete unterdessen seinerseits die innerkirchlichen Verhältnisse und Beziehungen erheblich durch seine zentralistischen Ambitionen und Ansprüche, durch seine Finanzmanipulationen im kurialen Gebührenwesen, im Ämterverkauf und in der forcierten fiskalischen Instrumentalisierung des Ablasses, durch sein politisches Machtstreben, durch die Duldung sittlich fragwürdiger Verhältnisse an der Kurie und durch seinen massiven Beitrag zur Bürokratisierung und Verrechtlichung der Hierarchie. Aufgrund ihrer komplexen Interessenlage unterließ es die Kurie in der Folgezeit, eine weitgreifende, systematisch und langfristig angelegte Reformoffensive nach unten zu organisieren, und reagierte in Reformangelegenheiten jeweils auf Antrag nur fallweise. So blieb die innerkirchliche Verantwortung für die „reformatio in membris“ weitgehend den Bischöfen und den Orden überlassen.
Für die Bewältigung dieser Aufgabe war der deutsche Episkopat keineswegs optimal disponiert, weil er in Strukturen eingebunden war, die seine geistliche Amtsführung belasteten bzw. einengten. Dieser Sachverhalt verlangt nicht nur im Urteil über die vorreformatorischen Verhältnisse, sondern auch über den Fortgang der nachtridentinischen Reform eingehende Beachtung, weil er den Bedingungsrahmen kirchlichen Handelns durchgehend prägte. Bekanntlich galt im Reich die kirchliche Führung fast ausschließlich als Domäne des Adels, die für Tendenzen zur Verweltlichung stets offen war. Das bestehende Auswahlsystem bot keine verlässliche Gewähr, dass bei einer Bischofserhebung die intellektuelle Befähigung, die pastorale Qualifikation und die persönliche Integrität des Kandidaten maßgeblich waren und nicht simonistische Praktiken oder rein politische Motive und Überlegungen den Ausschlag gaben, die den Status der Bischöfe als Reichsfürsten und weltliche Herrschaftsträger in den Vordergrund rückten. Diese politische Komponente ihres durch die Reichsverfassung strukturierten Amtsprofils war im Übrigen durchweg im Selbstverständnis der Fürstbischöfe fest verankert. Dementsprechend absorbierten die landesherrliche Administration im Hochstiftsterritorium und sonstige politische Aufgaben und Konflikte erhebliche Energien.18
Darüber hinaus sind die innerkirchlichen strukturellen Gegebenheiten zu beachten, die einer systematischen Entfaltung bischöflicher Reformaktivität entgegenstanden oder als Störfaktor wirkten. Zu nennen ist hier vor allem die starke Position der Domkapitel in den Bistumsverfassungen. Durch Wahlabsprachen und Wahlkapitulationen war es den Kapiteln im ausgehenden Mittelalter durchweg gelungen, ihre eigenen namhaften Privilegien zu mehren und ihren Kontroll- und Mitregierungsanspruch abzusichern. Deshalb waren die Kapitulare, die selbst wegen vielfältigen Fehlverhaltens in hohem Grade einer durchgreifenden Reform bedurften, sich aber in der Regel bischöflichen Reforminitiativen verweigerten, jederzeit in der Lage, nicht nur politische, sondern auch pastorale Maßnahmen der Ordinarien zu modifizieren oder zu durchkreuzen und die geistliche Jurisdiktion und Disziplinargewalt des Bischofs und seine Aufsicht über das Pfründenwesen wirksam zu unterminieren, so dass Reformverordnungen ohne Konsens der Kapitel, wenn überhaupt, nur schwer und umwegig durchgesetzt werden konnten. Wenn die Kapitulare zudem noch Rückhalt bei der Kurie fanden, ließ sich die bischöfliche Handlungsfähigkeit umso drastischer einschränken. Dies gilt mutatis mutandis auch für die Amtsführung der Weihbischöfe und der Generalvikare, die als Stellvertreter des Bischofs fungierten.19
Den Aktionsradius der Bischöfe beeinflusste darüber hinaus auch die Verteilung der Kirchenpatronate nachhaltig, die theoretisch nur ein Vorschlagsrecht für die Besetzung einer Pfarrei beinhalteten, das aber faktisch meist als weitreichendes Verfügungsrecht praktiziert wurde. In vielen Diözesen lag nur ein Bruchteil der Patronate in der Hand der Bischöfe.20 Dementsprechend war der unmittelbare bischöfliche Einfluss auf den Personalstand des Pfarrklerus denkbar gering. Unter diesen Umständen war es schwierig, eine angemessene Qualifikation des Pfarrklerus sicherzustellen und eine effektive Kontrolle auszuüben, um Missstände zu beheben.21 Mitunter verhinderten auch politische Rücksichtnahmen, die im weltlichen Interesse des Hochstifts opportun schienen, oder auch einfach aristokratische Solidarität durchgreifende disziplinarische Maßnahmen der Bischöfe, die sich aus der strukturellen Komplexität ihres weltlich-geistlichen Status nicht ohne weiteres zu lösen vermochten. Jedenfalls schwächte das laikale Kirchenpatronat, auch wenn seine Rechte in den deutschen Diözesen unterschiedlich definiert waren und sein prozentualer Anteil nicht überall im gleichen Umfang ins Gewicht fiel, die Bistumsadministration aufs Ganze erheblich.
Völlig außerhalb des bischöflichen Wirkungsbereiches standen gar diejenigen Pfarreien, die aufgrund besonderer, meist päpstlicher Privilegien durch Inkorporation, d. h. durch die Übertragung des Besitzrechtes, ohne Rechtsvorbehalt dem Vermögen eines exemten Klosters eingegliedert waren. In diesen Fällen oblagen die Regelung der Pfarrverhältnisse und die Sicherstellung geordneter Seelsorge dem jeweiligen Abt, Propst oder Prior. Die kirchenrechtliche Legalität der Exemtion suspendierte nicht nur für solche Pfarreien die bischöfliche Jurisdiktion, sondern verwehrte den Ordinarien auch das Recht, solcherart privilegierte Klöster ohne besondere, eigens einzuholende Vollmacht der Kurie zu visitieren und zu reformieren, weil ihnen gegenüber nur ihr Ordensgeneral in Rom bzw. der Papst weisungsberechtigt war.22 So blieb den Bischöfen normalerweise nur die Möglichkeit, auf bestehenden Reformbedarf aufmerksam zu machen, punktuelle Initiativen durch die informelle Einschaltung der zuständigen Ordensoberen anzuregen und die eigenen Reformaktivitäten auf nicht exemte Konvente zu konzentrieren.
Nicht geringe Schwierigkeiten bereitete der bischöflichen Administration auch das komplizierte zeitgenössische Benefizialwesen, weil die bischöfliche Administration kaum über wirksame Handhaben verfügte, wenn der Papst fallweise gegen Geldzahlungen oder unter dem Eindruck fragwürdiger Petitionen von allgemeinen Vorschriften, wie sie z. B. die Synodalstatuten enthielten, entband und Abweichungen und Sonderinteressen legalisierte, die einer einheitlichen Diözesanverwaltung im Wege standen. Päpstliche Provisionen und Verleihungen von Anwartschaften verursachten zudem zahlreiche unerquickliche Konflikte um Pfründen und Einkünfte, die die innerkirchliche Ordnung stark belasten konnten.23
Hinzu kam, dass der Weltklerus in der Tradition überkommener Rechtsvorstellungen die kirchlichen Pfründen vorrangig als Besitzobjekte und erst in zweiter Linie als Amt ansah und dies der Neigung Vorschub leistete, die gewissenhafte Erfüllung der pastoralen und liturgischen Pflichten nicht als ausschlaggebendes Statuskriterium zu betrachten. In dieser verbreiteten Mentalität wurden Pfründen rege getauscht und gewechselt, auch zugunsten einer besseren Stelle eigenmächtig aufgegeben. Diese kaum zu unterbindende Fluktuation erschwerte zweifellos die kontinuierliche Sicherstellung der Seelsorge. Aus der Priorität des benefizialen Denkens erklärt sich auch die Skrupellosigkeit, mit der Weltkleriker kirchliche Pfründen in einer Hand kumulierten. Da in solchen Fällen die Residenzpflicht auf der einen oder anderen Stelle nicht erfüllt werden konnte, mussten nach Einholung einer Dispens Vertreter bestellt werden, die nur einen Teil des Pfründeneinkommens beanspruchen konnten. In der Praxis führte dieses Vertretersystem keineswegs überall und nicht zwangsläufig zur Proletarisierung des niederen Klerus. Erhebungen zur wirtschaftlichen Lage des Weltklerus zeigen für manche Diözesen, dass nicht nur die Pfarrer, sondern auch die Kapläne und Altaristen durchaus auskömmlich versorgt waren, während in anderen Diözesen auch diese Gruppe finanziell deutlich schlechter gestellt war und in manchen Städten ein gewisser Überhang an Bewerbern verkraftet werden musste.24
Über die Lebens- und Amtsführung des vorreformatorischen Weltklerus, der aufgrund seiner agrarischen Bepfründung in der Regel wirtschaftlich eng in das wechselseitige Abhängigkeitssystem und in das Alltagsmilieu seiner meist dörflichen Umgebung eingebunden und dadurch einem erheblichen, den dignitären Anforderungen nicht immer kompatiblen Anpassungsdruck ausgesetzt war, sind zahlreiche Klagen und Beschwerden der Zeitgenossen überliefert, die das Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde als Vertragspartnerschaft auffassten, in der die priesterlichen Amtshandlungen als sachliche Gegenleistungen für Einkünfte und Privilegien verstanden wurden. Im Rückblick ist die Berechtigung dieser Kritik im Einzelnen nur schwer überprüfbar. Mitunter ist ein ausgeprägter Hang zur stereotypen Übertreibung unverkennbar. Nicht selten spielt offenbar das Bedürfnis eine Rolle, aktuelle Reformkonzepte zu legitimieren. Immerhin ist ganz allgemein eine offenbar schwer ausrottbare Disziplinlosigkeit erkennbar, die sich vor allem in der Vernachlässigung von Dienstpflichten, in allerlei Unregelmäßigkeiten und Eigenmächtigkeiten, in einem gewissen Hang zur Gewalttätigkeit, wobei nicht selten auch Trunksucht mit im Spiel war, und in den häufigen Verstößen gegen den Zölibat manifestierte. Dieser negative Befund trifft sicher nur auf Teile des amtierenden Weltklerus zu, für dessen Lebensweise und Verantwortungsbewusstsein sich auch genügend positive Beispiele beibringen lassen.25
Dass der vorreformatorische Pfarrklerus insgesamt allerdings weit von jenem Priesterideal entfernt war, das später auf dem Trienter Konzil formuliert wurde und als Leitlinie der nachtridentinischen Reform fungierte, belegt am deutlichsten sein Bildungsstand. Die Kandidaten erwarben ihre Kenntnisse über die vorgeschriebenen Formen der Sakramentenspendung und die sonstige Liturgie, in der lateinischen Sprache und in den Hauptlehren des christlichen Glaubens, die sie in Erläuterung der Hl. Schrift den Gläubigen zu vermitteln hatten, in Stiftsschulen und/oder im Pfarrhof. Mehr als dieser praxisbezogene Wissensbestand wurde in dem Examen, das vor der Weihe abzulegen war, nicht geprüft. Zwar lässt sich nachweisen, dass um die Wende zum 16. Jahrhundert in manchen – vor allem süddeutschen – Diözesen etwa ein Drittel bzw. fast die Hälfte der Primizianten eine Universität besucht hatte, aber die allermeisten kamen über ein mehr oder weniger intensives Studium der Artes nicht hinaus. Manche studierten Jura, nur ein Bruchteil wählte die Theologie. Es gab durchaus auch Stadtpfarreien, die bereits seit dem frühen 15. Jahrhundert nur mit akademisch gebildeten Priestern, die einen Abschluss vorweisen konnten, besetzt wurden, aber auch hier waren die Theologen in der Minderheit. Anders lagen die Dinge nur bei den Prädikaturen, deren Übernahme in der Regel ein Universitätsstudium voraussetzte. Der Weltklerus in seiner Gesamtheit aber war für eine vertiefende Spiritualisierung der Seelsorge und entsprechende Reformen kaum qualifiziert. Er war zudem offenbar bischöflichen Disziplinierungsmaßnahmen kaum zugänglich, weil er nicht systematisch zu jener asketisch-selbstbeherrschten Lebens- und Verhaltensweise erzogen war, die man von ihm verlangte.26 In seiner Mehrheit war dieser Weltklerus, der im Übrigen ein starkes Qualifikationsgefälle zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie aufwies, wohl durchaus imstande, die Sakramente einigermaßen korrekt zu verwalten und durch Belehrung, Ermahnung und Predigt auf das religiöse Leben der Gemeinden im Sinne einer traditionalen Pflege der Frömmigkeit einzuwirken, er war aber, von einer sehr kleinen Minderheit abgesehen, zweifellos nicht befähigt, die von Luther ausgelöste, theologische Kontroverse um die christliche Wahrheit aus altgläubiger Sicht aktiv zu beeinflussen. Und für die Zeit vor der Reformation spricht viel für die Annahme, dass es im niederen Weltklerus, wenn er denn zur Beseitigung von Missständen und zu Verhaltenskorrekturen aufgerufen wurde, um die Voraussetzungen einer kirchlichen Erneuerung nicht eben günstig bestellt war, weil die Strukturen seiner Verfasstheit, seine vorherrschende Mentalität und die Defizite seiner Ausbildung der Entfaltung reformerischer Aktivität markante Grenzen zogen. Mit den daraus resultierenden Problemen blieb die katholische Reform bis ins 17. Jahrhundert hinein konfrontiert.
Trotzdem und trotz sonstiger struktureller Gegebenheiten, die ihren Handlungsraum einengten, suchten pflichtbewusste Bischöfe in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und im frühen 16. Jahrhundert dem nicht zu übersehenden Reformbedarf in ihren Diözesen gerecht zu werden. Sie unterstützten nicht nur ordensinterne Reforminitiativen in exemten Klöstern, sondern wurden dort, wo sie wie z. B. in Kanoniker- und Kollegiatstiften ihre Jurisdiktion ungehindert geltend machen konnten, von sich aus aktiv und besorgten sich päpstliche Vollmachten, die bestehende Exemtionen suspendierten und Visitationen sowie Reformmaßnahmen ermöglichten.27 Manche von ihnen bemühten sich um die Vereinheitlichung des Gottesdienstes in ihrem Bistum, indem sie den Buchdruck nutzten und liturgische Bücher für den Pfarrklerus publizierten.28 Reforminteressierte Bischöfe befassten sich mit Missständen im Pfründenwesen und kümmerten sich um die Sanierung der Finanzen ihres Hochstifts, um die Verbesserung der Zustände in ihren Domkapiteln und an ihren Domstiften und um die Straffung der geistlichen Gerichtsbarkeit. Der niedere Weltklerus wurde zu standesgemäßem Lebenswandel angehalten, indem ihm das Tragen weltlicher Kleider und diverser Waffen, der Besuch von Gasthäusern und Tanzveranstaltungen, die Beteiligung an Spielen und besonders das Konkubinat verboten wurden. Manche Bischöfe kümmerten sich darüber hinaus um die Korrektheit der Sakramentenspendung und die religiös-sittliche Unterweisung und Erziehung der Gläubigen.29 Die Wirkung dieser Maßnahmen erschöpfte sich freilich oft genug rasch, wenn desinteressierte Nachfolger die Zügel wieder schleifen ließen. Auch nach dem Trienter Konzil erwies es sich als enorm schwierig, über mehrere Bischofsgenerationen hinweg verlässliche Reformkontinuität herzustellen.
In einer ganzen Reihe von Diözesen rezipierten Synoden in den ersten Jahren nach dem Ende des Basler Konzils dessen Reformbeschlüsse. Die Legation des Kardinals Nikolaus von Kues 1451 / 1452 verstärkte vorübergehend diesen Reformimpuls.30 Auch in der Folgezeit bis in das beginnende 16. Jahrhundert wurden in verschiedenen Diözesen immer wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Synoden einberufen. Das Reform- und Innovationspotential dieser Versammlungen blieb allerdings durchweg gering. Abgesehen davon, dass sie dem Bischof Gelegenheit boten, ein „subsidium caritativum“ einzufordern, hatten sie vornehmlich den pastoralen Sinn, ältere Statuten und Vorschriften erneut einzuschärfen und ihre strikte Einhaltung anzumahnen. Im Allgemeinen entschloss man sich, wenn überhaupt, nur zu wenigen Ergänzungen durch neue Verordnungen.31 Die Lösung grundlegender Probleme, die im Interesse an einer veritablen kirchlichen Erneuerung zu klären waren und durchaus wahrgenommen wurden, wurde nicht diskutiert. Die gut gemeinten Mandate blieben weitgehend wirkungslos, zumal die pastorale Praxis nur sehr vereinzelt und höchst unregelmäßig durch Visitationen kontrolliert wurde. Jedenfalls gelang kein durchgreifender Wandel. Diese unverkennbare Tendenz zur Stagnation verdankte sich nicht nur der vor allem strukturell, aber oft genug auch personell bedingten Durchsetzungsschwäche des Episkopats.32 Sie erklärt sich vielmehr in der Hauptsache aus der Schwierigkeit, die hohe Komplexität der kirchlichen Strukturen zu bewältigen und so die Funktionsmängel des kirchlichen Systems zu beheben bzw. das angestaute vielfältige Konfliktpotential auszuräumen.
Unter diesen Umständen gelang es vielfach weltlichen Obrigkeiten, auf kirchlichem Gebiet unter Berufung auf Patronatsrechte, Schutz- und Schirmverhältnisse und ihre landesherrliche Ordnungskompetenz bzw. ihre kommunale Verantwortung zunehmend nachhaltigen Einfluss zu gewinnen.33 Dieser Einfluss beschränkte sich nicht darauf, in innerkirchliche Konflikte schlichtend einzugreifen und die wirtschaftliche Sanierung kirchlicher Einrichtungen in die Wege zu leiten, die Ausübung der geistlichen Jurisdiktion präziser zu regulieren bzw. einzugrenzen und den Klerus zu Abgaben und Steuern zu verpflichten. Er war naturgemäß dort am stärksten ausgeprägt, wo weltliche Fürsten die für ihr Territorium zuständigen Bistümer in unmittelbare Abhängigkeit bringen konnten, wenn auch die vollständige Mediatisierung nur in wenigen Fällen erreicht wurde.34 Hinter den einschlägigen Initiativen verantwortungsbewusster weltlicher Fürsten stand zum einen das religiöse Anliegen, die Untertanen durch die ernste Sorge um ihre Frömmigkeit und Moral auf den wahren Weg zum Seelenheil zu führen, zum anderen die Überzeugung, dass die fürstliche Verantwortung für das Gemeinwohl des Landes die Bemühung um eine gottgefällige Ordnung der kirchlichen Verhältnisse und des religiösen Lebens als Voraussetzung für den Segen Gottes mit einschließe.35 Die Fürsten suchten dieser Aufgabe durch die Kontrolle kirchlicher Einrichtungen, durch Anordnung von Gebeten und Prozessionen, durch den Erlass von Sittenmandaten und Landesordnungen, vor allem aber durch die intensive Förderung der Reform- und Observanzbewegungen in den verschiedenen Orden gerecht zu werden.36 Ihre Reformpolitik sicherten sie, soweit sie nicht durch die Landeshoheit legitimiert werden konnte, in der Regel durch eine enge Kooperation mit der Kurie ab, die ihnen weitgehende Privilegien gewährte.37 Auf dieser Grundlage und unter Ausnutzung regionaler Machtkonstellationen konnten auf territorialer Ebene Ansätze zu einem landesherrlichen Kirchenregiment geschaffen werden, die sich dann im Aufbau neugläubiger Territorialkirchen voll entfalten ließen und die später in der nachtridentinischen katholischen Reform fortentwickelt werden konnten.38
Auch die Stadtmagistrate entfalteten in dem Bestreben, bürgerliches und religiös-kirchliches Leben miteinander in Einklang zu bringen, im 15. Jahrhundert eine rege kirchenpolitische Aktivität. Dabei war es ihnen nicht nur darum zu tun, den kirchlichen Haus- und Grundbesitz einzudämmen und die konfliktträchtigen Spannungen zu bewältigen, die aus der klerikalen Konkurrenz im wirtschaftlichen Bereich und aus dem privilegierten Sonderstatus der Geistlichkeit resultierten.39 Vielmehr suchten sie darüber hinaus im Bewusstsein einer besonderen Verantwortung für die Religiosität ihrer Gemeinde und im Interesse an der Aufrechterhaltung der kommunalen Ordnung – gelegentlich in zäher Konfrontation mit den zuständigen Bischöfen – durch vielfältige Eingriffe in die kirchliche Administration sicherzustellen, dass ihre Stadt Gottes Segen nicht verlor.40 Es lässt sich vielfach zeigen, dass es den Magistraten dabei vor allem um die religiöse und sittliche Läuterung ging, die ihre Gemeinde heilsfähig machen sollte und als Voraussetzung für die helfende Zuwendung Gottes galt.41 Vor allem die engagierte, tatkräftige Unterstützung der monastischen Observanzbewegungen belegt diesen Befund vielfältig.42 Festzuhalten ist freilich auch, dass um die Jahrhundertwende in vielen Städten ein laikales Kirchenregiment bereits seit langem in Übung war, das bewusst oder zumindest faktisch dahin tendierte, sich dem Einfluss geistlicher Instanzen zu entziehen und Pfarrseelsorge und Frömmigkeitspraxis weitgehend in eigener Regie zu organisieren, eine Tendenz, die wenige Jahre später in die Konfrontation mit der Herausforderung der reformatorischen Bewegung mündete und die lokalen Entscheidungen über die Zuständigkeit für den Umbau der tradierten kirchlichen Strukturen, die in der Perspektive der neuen Theologie als Ergebnis gravierender Fehlentwicklungen aufzufassen waren, fraglos stark beeinflusste.
Im Jahrhundert vor der Reformation artikulierte sich die zeitgenössische Sensibilität für Verfallserscheinungen, die einen akuten Reformbedarf signalisierten, im monastischen Raum besonders pointiert, weil hier die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit unmittelbar ins Auge fiel. Allerdings wird man nicht jede klosterkritische Stellungnahme als Dokumentation der realen Verhältnisse lesen dürfen, sondern auch mit rhetorischen Stereotypen und zweckbewussten Verzerrungen rechnen müssen. Bei aller quellenkritischen Vorsicht finden sich dennoch genügend aussagekräftige Belege und Anzeichen für den häufig angeprangerten Niedergang des Mönchtums, der sich auf eine Reihe von Faktoren zurückführen lässt. Zu nennen sind vor allem die Spannung zwischen dem asketischen Selbstheiligungsideal und dem Anpassungsdruck des aristokratischen oder städtischen Umfeldes, die Folgen der Fiskalisierung und Juridifizierung der päpstlich-kurialen Administration, die Lockerung der Dispenspraxis der Kurie gegenüber dem Mönchtum, das Kommendenwesen, das die Führungsstrukturen der betroffenen Konvente zerrüttete, die Eingriffe weltlicher Obrigkeiten aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen, die Auswirkungen der Pestwellen seit dem 14. Jahrhundert auf die Rekrutierungspraxis der Orden und die Ressourcen der Mendikanten und die spätmittelalterliche Agrarkrise, die den grundbesitzenden Orden erhebliche Einkommensverluste bescherte, wenn auch wohl nicht überall die Überlebensfähigkeit massiv gefährdet war.43 Im Einzelfall mögen die genannten Faktoren in unterschiedlicher Kombination und Intensität wirksam geworden sein, für das Gesamtbild lässt sich jedenfalls ihre Relevanz im Bedingungsrahmen des unverkennbaren Niedergangs wohl kaum in Abrede stellen.
Die Reaktion auf die Herausforderung der Krise fiel in den Orden verschieden aus. Während Zisterzienser und Prämonstratenser anders als in Spanien und Nordwesteuropa im Reich erst spät – um 1500 – Reformaktivitäten entfalteten, die sich zudem auf einzelne Konvente beschränkten,44 kamen bereits um 1400 von Kloster Kastl aus und seit 1419 von Kloster Melk aus benediktinische Reformbewegungen in Gang, die ihr Programm durch Visitationen und über bald entstehende Subzentren verbreiteten und mit landesherrlicher Unterstützung zahlreiche Klöster in Österreich und Oberdeutschland erfassten.45 Noch größere Ausstrahlungskraft gewann die 1434 im Kloster Bursfeld eingeführte Reform, weil sie 1439 zum Ausgangspunkt einer effektiv organisierten benediktinischen Reformkongregation wurde, die die genaue Einhaltung der Ordensregeln und administrativen Vorschriften auf jährlichen Generalkapiteln kontrollierte und so ihre Einheitlichkeit und innere Kohärenz auf Dauer sicherstellte.46 Bei den Augustinerchorherren setzten sich im oberdeutschen Raum die von Stift Indersdorf ausgehenden Reformbestrebungen auf dem Freisinger Provinzialkapitel 1475 definitiv durch,47 während in Nord- und Westdeutschland die durch die Spiritualität der frühen Devotio moderna geprägte Windesheimer Kongregation immer mehr an Boden gewann, bis sie um 1500 in ihrem straff geführten Verband etwa 100 Konvente zusammenfasste, die sich der gewissenhaften Erfüllung der Augustinerregel verschrieben hatten.48
In den großen Bettelorden formierten sich in Weiterentwicklung ordensinterner Initiativen seit dem späten 14. bzw. frühen 15. Jahrhundert starke Observanzbewegungen, die strikte Regeltreue einforderten und nach heftigen jahrzehntelangen Auseinandersetzungen mit den Konventualen schließlich die Oberhand behielten. In den einzelnen Orden verlief dieser Prozess unterschiedlich. Die durch italienische, spanische und französische Reformgruppen inspirierte Observanzbewegung der Franziskaner etwa konnte sich im Reich dank der breiten Unterstützung durch weltliche Fürsten, städtische Magistrate und viele Bischöfe zügig ausbreiten, so dass sie in den deutschen Provinzen gegen Ende des 15. Jahrhunderts mehrheitsfähig wurde. Der Preis für diesen Erfolg war eine verstärkte Abhängigkeit von den laikalen Kräften, die die Expansion der Observanz zielstrebig gefördert hatten.49
Auch im Orden der Dominikaner nahm die Reform nach ersten, bereits vor 1400 einsetzenden, nur sporadisch erfolgreichen Initiativen seit dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts im Reich einen starken, zukunftsweisenden Aufschwung. Innerhalb der formal fortbestehenden Provinzverfassung expandierte – trotz z. T. brisanter, lokaler Konflikte mit den Konventualen – die dominikanische Observanz, die bei vielen reforminteressierten weltlichen Fürsten und städtischen Magistraten konstruktiven und zuverlässigen Rückhalt fand, während die meisten Bischöfe sich zunächst offenbar eher abwartend verhielten, so stark, dass sie 1475 den Provinzial stellen und bis zur Reformation die Dominanz der Reformkräfte sichern konnte.50
In den deutschen Provinzen der Augustinereremiten konstituierte sich seit dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts mit Schwerpunkt im sächsischen Raum eine strikt observante Kongregation unter eigenen Vikaren, die schließlich um 1500 etwa 30 Konvente umfasste.51 Wie hier spielten auch im Orden der Karmeliter reformeifrige Ordensgenerale eine maßgebliche Rolle. Seit der Jahrhundertmitte erfasste ihr reformerischer Elan zahlreiche Klöster des Ordens in Deutschland, auf dem Wege der persönlichen Visitation, durch die Einsetzung und Unterstützung reformeifriger Vikare, durch Einflussnahme auf die Zusammensetzung der Konvente, durch eine konsequente Strafpraxis oder durch schriftliche Weisungen und einen intensiven Briefwechsel mit den Provinzialen.52
Der parallele Verlauf der skizzierten Reformbewegungen, die im 15. Jahrhundert wieder einsetzenden Neugründungen von Klöstern der etablierten großen Orden und die Vitalität auch der in Deutschland seltener vertretenen kleineren Ordensgemeinschaften belegen einen bemerkenswerten monastischen Aufschwung als Reaktion auf die Erfahrung der Krise und des Verfalls.53 Gemeinsam war allen Reformbemühungen, die Erfüllung der Gelübde des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit und die Einhaltung der Fasten- und Abstinenzgebote sicherzustellen, zu diesem Zweck die Autorität der Klosterleitung zu festigen, die vita communis und den gemeinsamen Tisch wiederherzustellen, durch exakte Vorschriften zum Tagesablauf die interne Disziplin der Konvente zu stärken, den Umgang mit individuellem Eigentum je nach Ordensregel genau zu fixieren, sexuellen Verfehlungen zu wehren und den Genuss bestimmter Speisen und Getränke exakt zu reglementieren. Etwa vorliegende päpstliche Dispense, die recht großzügig erteilt wurden, verloren ihre Gültigkeit. Gemeingut waren auch das Anliegen, die Liturgie und den Gottesdienst würdig zu gestalten und genau zu ordnen, und die grundsätzliche Tendenz, alle Symptome der Verweltlichung einschließlich der vielfältigen Verstöße gegen die Klausur nach Kräften zu bekämpfen und die Außenbeziehungen der Konvente restriktiv zu regulieren.54 Für den Eintritt ins Kloster und die Priesterweihe wurden Altersgrenzen festgesetzt, die Autonomie der reformierten Klöster musste gegen Interventionen von Seiten der Konventualen gesichert werden.55
Im Einzelnen differierten die Reformkonzeptionen allerdings nicht unerheblich. So spielte bei allen Bettelorden, in besonders pointierter, konfliktträchtiger Weise bei den Franziskanern, vor allem das Armutsgebot im Reformdiskurs eine zentrale Rolle.56 In den Konstitutionen der Windesheimer Kongregation lag ein besonderer Akzent auf dem Postulat körperlicher Arbeit als asketischer Übung, auf der Motivation zur Vertiefung der Religiosität und auf dem Armutsgebot, das auch kollektiv für die Gemeinschaft galt.57 Den benediktinischen Reformern kam es neben der wirtschaftlichen Sanierung ihrer Klöster und der neu eingeschärften Regeltreue vor allem darauf an, den liturgischen Regelvollzug, den Chordienst und die kultischen Zeremonien, die vereinfacht und auf ihre wesentlichen Elemente reduziert wurden, nicht der Routine zu überlassen, sondern mit religiöser Innerlichkeit zu erfüllen. Neben der sorgfältigen Vorbereitung der Novizen auf die Profess legten manche Orden wie etwa die Augustinereremiten und die Dominikaner entsprechend ihrem Gründungsauftrag besonderen Wert auf ein angemessenes Niveau ihrer Ordensstudien, um ihren Nachwuchs zur Predigt und zum liturgischen Dienst intellektuell zu qualifizieren.58 Es galt zudem, die Äbte wieder in die klösterliche Lebensgemeinschaft zu integrieren und die aristokratische Exklusivität mancher Orden aufzulösen, was bis zum Ende des 15. Jahrhunderts in den männlichen Reformkonventen auch gelang. Die strenge Verpflichtung auf die überarbeiteten Statuten und Konstitutionen, bei den Bursfeldern die zusätzliche eidliche Bindung an die Kongregation sollten die erreichten Reformerfolge verstetigen.59
Die angestrebte Verwirklichung des monastischen Ideals, das die Intentionen der Ordensgründung geprägt hatte, erreichten die Reformer, wie die Notwendigkeit, die Statuten immer wieder einzuschärfen, belegt, wohl kaum vollkommen und ohne Abstriche im Einzelnen. Die reformerische Initiative und Wachsamkeit blieben vielmehr kontinuierlich gefragt. Aber aufs Ganze zeitigte die Rückbesinnung auf Konstitutionen und Regeln beachtliche Erfolge in der Regeneration des Ordenswesens, die sich nicht nur in der wirtschaftlichen Sanierung der Reformklöster und in der Disziplinierung ihrer Konvente, sondern auch in der Pflege geistiger Interessen, in der Hebung des Bildungsniveaus und in der Wiederbelebung der Gebetsbruderschaften manifestierte. Im Zuge der Erneuerungsbewegung entfaltete sich zudem ein zukunftsweisender Frömmigkeitsstil, der eine Vertiefung und Verinnerlichung der Religiosität intendierte und deutlich individualisierende Züge trug.60 Diese Tendenz begegnet in ihrer reinsten Form in der Spiritualität des Kartäuserordens, der, selbst nicht durch Missstände belastet, auf die Observanzen in anderen Orden personell und geistig, wenn auch in verschiedenem Grade, einzuwirken vermochte.61
Auch außerhalb der Observanzbewegung fungierte im 15. Jahrhundert das Postulat der Reformatio als Leitkategorie des zeitgenössischen Interesses an der Kirche und ihren Einrichtungen. So basierte die z. B. von Johannes Gerson inspirierte Frömmigkeitstheologie, die sich bewusst von der scholastisch geprägten akademischen Theologie und ihrem theoriegebundenen Wegestreit distanzierte und sich der praktischen Seelsorge zuwandte, auf der Prämisse, dass es vorrangig darauf ankommen müsse, die Gläubigen zu vertiefter Religiosität anzuleiten und dadurch die Voraussetzungen für weitere kirchliche Reformen zu schaffen. Im Zentrum stand dabei das lebhafte, aus der Erfahrung von Einheitsverlust und fortschreitender Differenzierung in vielen Bereichen resultierende Bedürfnis nach Heilsgewissheit, das unter dem Einfluss individueller Sensibilisierung subjektiver Seelenerfahrung zur intensiven Suche nach dem sicheren Zugang zur Gnade Gottes anspornte und dem Problem der Rechtfertigung Priorität verlieh.
Dabei lassen sich zwei Haupttendenzen unterscheiden, deren Gemeinsamkeit in ihrem gedanklichen Ansatz, in der Frage nach dem rechten Heilsweg, lag und die durchaus verschieden akzentuierte Mischformen zuließen. Die eine Richtung fand in der konsequenten spirituellen Verinnerlichung des Bußgedankens und der ihn begleitenden Religiosität, die zur Verbundenheit mit Gott führen und sich unter anderem auch in Demut und Gehorsam, Gefasstheit und Geduld in der Nachfolge Christi ausdrücken sollte, die gesuchte wegweisende Antwort, die dahin tendierte, das Medium der kirchlich institutionalisierten Gnadenvermittlung zurückzudrängen, jedenfalls seine Bedeutung zu mindern und ihm nur noch die Funktion eines stützenden äußeren Rahmens zu belassen.62
Mit dieser frömmigkeitstheologischen Variante hatte die unabhängig von ihr von Geert Groote (1340 – 1384) begründete Devotio moderna, die im Laufe des 15. Jahrhunderts führende Humanisten und Gelehrte, auch eine Reihe von Bischöfen stark beeindruckte, einige Grundzüge gemeinsam. Auch sie lässt sich als Reaktion auf die Krisenerfahrung des 14. Jahrhunderts begreifen, auch sie entwickelte eine gewisse Skepsis gegenüber der theologischen Wissenschaft und räumte der praktischen Herausforderung Priorität ein, die christliche Lebensführung im Alltag durch eine spezifische Frömmigkeit zu erneuern, um der Veräußerlichung und Materialisierung der kirchlichen Praxis entgegenzuwirken. Sie war ursprünglich als Laienbewegung konzipiert, deren einzelne Gruppen dem Beispiel der frühchristlichen Gemeinden folgen, sich von ihrer eigenen Handarbeit ernähren und durch die Überzeugungskraft ihrer religiös-moralischen Integrität mitten in der sich bildenden stadtbürgerlichen Gesellschaft wirken sollten. Einerseits war ihnen aufgetragen, den Gemeinschaftsgedanken im Gemeinbesitz, in der kollektiven Gewissensprüfung und in der gemeinsamen Schriftlesung zu pflegen, andererseits blieb hinreichend Raum zu individueller Gewissenserforschung und Kontemplation über die Hl. Schrift, die der Selbstbesinnung und Selbsterkenntnis des Einzelnen diente.
Der Leitgedanke dieser Spiritualität war im Postulat der demütigen Nachfolge Christi formuliert, dessen Implikationen in täglicher Meditation und intensiver Bibellektüre immer wieder neu zu erschließen waren, um ein wahrhaft tugendhaftes Leben zur Sicherung des Seelenheiles gestalten zu können. Die Überzeugung, durch eine strenge Methodik zur Einübung in die geforderte Demut und in eine gottgefällige Frömmigkeitspraxis diesem Ziel näher kommen zu können, schloss zwar einerseits die Gefahr vordergründiger Werkgerechtigkeit nicht aus, motivierte aber andererseits zu besonderer Anstrengung im Bemühen um eine vertiefte Religiosität, die in der Konzentration auf das Leben und die Passion Christi ihre inspirierende Mitte fand.63
Die Devotio moderna, die sich vor allem aus dem Rückbezug auf die Hl. Schrift und auf die frühchristliche Kirche legitimierte und eine vielfältige Erbauungsliteratur hervorbrachte, prägte nachhaltig die Spiritualität der Windesheimer Kongregation und das Leben in den außerhalb der Niederlande vor allem in Westfalen und Württemberg gegründeten Häusern der Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben. Diese freien Gemeinschaften, die keine feierlichen Gelübde ablegten, wussten ihre Weltentsagung mit gesellschaftlicher Offenheit zu verbinden und suchten sich durch die Organisation religiöser Gesprächskreise und im Bildungswesen durch den Verleih erbaulicher Bücher, durch die Betreuung von Scholaren und durch Unterricht in öffentlichen Schulen, später auch in eigenen Anstalten verdient zu machen. Dabei zeigten sich die Fraterherren durchaus aufgeschlossen für den Versuch, den literarischen Bildungsgedanken der Humanisten in den Dienst einer vertieften christlichen Erziehung zu stellen. Die Devotio moderna konnte so zahlreiche potentielle Multiplikatoren gewinnen und Kontakte zum christlichen Bibelhumanismus herstellen, der in der Entfaltung des vorreformatorischen Evangelismus eine bedeutende Rolle spielte und als dessen Kronzeuge Erasmus von Rotterdam gelten darf.64
Schon früh entwickelte Erasmus (1469 – 1536) eine bleibende Abneigung gegen die in seinen Augen unfruchtbare Scholastik und ein ausgeprägtes Interesse an der Frage, wie antike Kultur und Christentum, humanistische Bildung und Frömmigkeit miteinander in Einklang zu bringen seien. Das Vorbild für diese Synthese fand er bei den Kirchenvätern und in der Patristik. Demgegenüber trat die mittelalterliche Tradition deutlich zurück. Im Gegenzug gewann das Ideal der frühen Kirche, weil sich in ihr das Wesen des Christentums verkörperte, als Leitlinie religiöser Reflexion maßgebliche Bedeutung. Aus den zentralen Aussagen des Neuen Testamentes und aus dem Beispiel der Urkirche leitete Erasmus sein Postulat wahrhaft christlicher Religiosität ab, die sich in der auch von der Devotio moderna angestrebten Imitatio Christi und in der Verwirklichung der in der Bergpredigt zusammengefassten Werte zu bewähren hatte. In diesem Sinne formulierte Erasmus seine „Philosophia Christi“, die mit einem reduzierten Grundbestand dogmatischer Festlegungen auskam, dafür die Caritasidee stark betonte und zur Verinnerlichung der Religiosität anleiten sollte. Ihr spiritualisierter Kirchenbegriff hielt zwar an dem Prinzip fest, dass außerhalb der Kirche das Heil nicht zu erreichen sei, aber Zeremonien und Riten, institutionelle und kirchenrechtliche Regelungen, menschliche, d. h. päpstliche und bischöfliche Vorschriften und Satzungen waren im erasmischen Verständnis für die Wirksamkeit der göttlichen Gnade ohne eigentlichen Belang. Sie konnten aus Nützlichkeitserwägungen oder aus disziplinarischen und pädagogischen Gründen sinnvoll erscheinen, im Vergleich zu den Geboten Christi kam ihnen aber stets nur nachrangige Bedeutung zu. Somit konnte die kirchliche Rechts- und Kultordnung als Ergebnis der historischen Entwicklung durch zeitgemäße Reformen modifiziert werden. Ihre Relativierung richtete sich ebenso wie die Betonung der Bedeutung des Laienelementes gegen die Verrechtlichung und Klerikalisierung der Kirche, die aus dem Geist der „Philosophia Christi“ und des frühen Christentums geläutert und erneuert werden sollte.65
So formte sich aus verschiedenen Ansätzen, auch unter dem Einfluss mystischen Denkens ein neuer Frömmigkeitsbegriff aus, der, ohne die Gnadenmittel der Kirche explizit zu negieren, den Gläubigen eine erhöhte individuelle Eigenverantwortung auf dem Wege zum Seelenheil zuwies. In ihrer prägnantesten Ausprägung, in der Devotio moderna, zielte diese neue Spiritualität auf die moralische Selbsterziehung des Individuums zu einem einfachen, wahrhaft christlichen Leben. Die dazu nötige moraltheologische Reflexion in der Beichtpraxis und die Meditation über die Glaubensinhalte in geistlichen Übungen verlangten ein höheres Niveau religiöser Bildung, als der von kirchlicher Seite als Minimum verlangte Grundstandard religiösen Wissens vermittelte. Die selbstdisziplinierende Verinnerlichung der christlichen Ethik und Heilslehre setzte voraus, dass sich Jugendliche, erwachsene Laien und halbgebildete Kleriker mit der christlichen Verkündigung intensiv und selbständig vertraut machen konnten. Dem trug im Laufe des 15. Jahrhunderts eine umfangreiche volkssprachliche Publikation religiöser Schriften Rechnung, die sich zum einen an kritikfähige, selbständig denkende, zum anderen aber auch an einfache Gläubige wandten. In der Rezeption dieser Traktate, die durch die Lektüre in verschiedener Form zugänglicher Bibeltexte ergänzt werden konnte, verwischte sich – entgegen den Intentionen der Amtskirche – zunehmend die Grenze zwischen Laien und Klerus und gewann das neue, im Grunde antiintellektualistische, die scholastische Schultheologie abwehrende, verinnerlichende Frömmigkeitsverständnis im lesekundigen Publikum zunehmend an Resonanz. Die mit dieser Entwicklung verbundene Aufwertung der Position der Laien, deren Selbstverständnis zunehmend dem individuellen Gewissen maßgebliche Bedeutung beimaß, fand im Rekurs auf die Sozialstruktur und das Bildungsprofil der Urkirche zusätzliche Legitimation.66
Die Alternative zu diesem Plädoyer für die subjektivierende Verinnerlichung der Frömmigkeit verwies im Bedürfnis nach einer verlässlichen Kompensation des notorischen menschlichen Unvermögens, aus eigener Kraft zum Heil zu gelangen, auf die Mittel der Kirche, die geeignet schienen, dem Sünder die Barmherzigkeit Gottes zu vermitteln. Dieser Rekurs auf die Sakramente und das Institut des Ablasses, auf die Verehrung der Eucharistie, auf die Heilskraft der Messe, auf die Meditation über die Passion Christi, auf die exklusive Würde des Priestertums und den Primat des Papstes als Garanten der Rechtgläubigkeit, auf die Marien- und Heiligenverehrung und auf die monastische Lebensform als besonders begnadeten Heilsweg ging mit dem Selbstverständnis und der Tradition der römischen Kirche konform. Er verlangte die entschiedene Intensivierung der geläufigen Formen traditionaler Frömmigkeit und religiöser Praxis. In ihm spiegelt sich zudem der Wiederaufstieg des Papsttums, der den Konziliarismus verdrängte.67
Dieser frömmigkeitstheologischen Variante entsprach die spektakuläre Intensivierung der kirchlich orientierten Frömmigkeit des späten 15. Jahrhunderts, die, in überwältigendem Sündenbewusstsein, in intensivem Verlangen nach Heilsgewissheit und in beängstigender Todes- und Krisenerfahrung motiviert,68 in unbefangenem Gehorsam gegenüber der Hierarchie auf die sakramentalen und rituellen Heilsangebote der Amtskirche baute. Auch hier finden sich Ansätze zur Verinnerlichung der Religiosität, der die kirchlich geförderte Erbauungsliteratur diente. Es dominierten aber die Mittel der vornehmlich sakramental, weniger katechetisch angelegten Seelsorge, die mit großem Eifer massenhaft in Anspruch genommen wurden. Dabei kam ein quantitatives Denken ins Spiel, das auf die Multiplikation der Zeremonien und Rituale, der Benediktionen und Ablässe, der Seelenmessen und Stiftungen, der Prozessionen und Wallfahrten etc. als Gewähr für die Sicherung des Seelenheils bzw. als Mittel zur Abwendung existenzieller Nöte und Bedrohungen vertraute. Dies barg die Gefahr, dass liturgische Handlungen und Symbole magisch aufgefasst und materialisiert wurden. Hinzu kam eine ausgeprägte Anfälligkeit für die Attraktivität des Wunderbaren, das sich in wundertätigen Interventionen Gottes, der Muttergottes oder der Heiligen zum Schutz vor Lebensrisiken zu konkretisieren schien und von dem die Mirakelbücher und die kollektive Erinnerung zeugten.69 Ungeachtet aller Fehlentwicklungen gaben die häufigen kirchlichen Feiertage, die Andachten, Benediktionen und Weihen, die Zeiten des Fastens und der besonderen Gebete, die Bittgänge und Prozessionen, die zugleich die soziopolitische Hierarchie widerspiegelten und so immer wieder reproduzierten, der Lebensführung ein zutiefst kirchliches Gepräge.70 Da die nachtridentinische Reform darauf angelegt war, solche lebensweltliche Prägung, die ihr für die Ausformung einer konfessionell-katholischen Identität unverzichtbar schien, wiederherzustellen bzw. zu festigen, kam sie ohne den kontinuitätsstiftenden, zugleich Missstände korrigierenden Rückgriff auf eine Vielzahl spätmittelalterlicher Frömmigkeitsformen nicht aus. Dementsprechend lassen sich in der Praxis spätmittelalterlicher Religiosität einige charakteristische Schwerpunkte ausmachen, die die spätere katholische Konfessionalisierung beibehielt wie etwa die christozentrische Religiosität mit ihren vielfältigen Formen der Kreuzes-, Passions- und Eucharistiefrömmigkeit71, die Marien- und Heiligenverehrung, die die himmlische Hilfe suchte zur Bewältigung der Wechselfälle des Lebens, und die Hochschätzung der Messe als Medium der Heilsvermittlung72. Dabei war allerdings der bereits zuvor erkannte Reformbedarf stärker bewusst und ließen sich Modifikationen, Umakzentuierungen und Revisionen nicht umgehen, die fehlgeleitete Auswüchse wie die Tendenz zur Materialisierung des Religiösen beseitigten und abergläubisch-magische Deutungen zurückdrängten. Gleiches gilt für das Ablasswesen, das in den Jahrzehnten um 1500 zu finanziell-kommerzieller Rechenhaftigkeit in der Sorge um Gnade und Vergebung verkam,73 für den Reliquienkult, der in der zeitgenössischen Schaufrömmigkeit und Wundergläubigkeit vielfach die Grenze zur Magie überschritt, und für die Bruderschaften, die in der Form der Kultbruderschaften, deren Zahl stetig wuchs, die Hinwendung zur frommen Andacht, z. B. zum Rosenkranzgebet, förderten, die aber, soweit es sich um berufsständische Vereinigungen handelte, mitunter die profane Geselligkeit sehr ausgiebig pflegten und darüber ihre religiöse Bestimmung vernachlässigten.74
Ein zentrales Anliegen der nachtridentinischen Reform antizipierte das im 15. Jahrhundert zunehmende Interesse an der Predigt. Ablesbar ist diese Entwicklung an den Stiftungen von Prädikaturen, die in der Regel nur mit besonders qualifizierten, durch einen akademischen Grad ausgewiesenen Kandidaten besetzt wurden und das bestehende, quantitativ vielerorts reichliche, wenn auch oft nicht gerade anspruchsvolle Predigtangebot der Pfarrer und ihrer Helfer, der Bettelorden und der Stationierer ergänzen und optimieren sollten.75 An diesen Bemühungen um ein besseres Verständnis des christlichen Glaubens beteiligten sich nicht nur Kleriker, sondern auch viele Laien, für deren religiöse Bildung und Praxis ein breites, wenn auch meist nicht originelles Schrifttum im Druck angeboten wurde: mehrere hoch- und niederdeutsche Bibelübersetzungen, deutsche Psalterien, Darstellungen der Passion und des Lebens Jesu, Armenbibeln, deutsche Erläuterungen zu den wichtigsten Glaubenslehren, Biographien der Heiligen in der Abfolge des Kirchenkalenders, Bilderkatechismen, Predigten und Postillen, volkssprachliche Ausgaben des Breviers und sonstige Gebetbücher, Unterweisungen zur Beichte und zur Ehe, Kommunion- und Sterbebüchlein, Erbauungsschriften wie die „Imitatio Christi“ des Thomas von Kempen und deutschsprachige Plenarien, die den Laien die Messtexte des Kirchenjahres mit entsprechenden Erläuterungen an die Hand gaben.76 Diese vielfältige und umfangreiche religiöse Literatur orientierte sich an den Theoremen und am Programm der Reformtheologie des 15. Jahrhunderts, die wie im Übrigen auch die reformatorische Theologie der zentralen Frage nach der Heilsgewissheit verpflichtet war und ein vor allem aus der Hl. Schrift und den Lehren der Kirchenväter abgeleitetes Frömmigkeitsideal als Lösung anbot.77
Dem Zugewinn an religiösem Wissen korrespondierte die Ausweitung der Laienkompetenz in der Kirche. Territorialobrigkeiten und kommunale Magistrate entwickelten ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für die kirchliche Ordnung in ihrem Zuständigkeitsbereich und entfalteten z. B. im Rahmen der Klosterreform vielfältige konstruktive Aktivitäten. Ein erhöhtes religiös-kirchliches Reflexionsniveau sensibilisierte zugleich die sozialen und politischen Führungsschichten in verstärktem Maße für Fehlentwicklungen und Missstände im Klerus, dessen meist vorwiegend benefiziales Amtsverständnis, das oft genug über den Vollzug der rituell-sakramentalen Formalität kaum hinausreichte, den gestiegenen Anforderungen nicht adäquat zu genügen vermochte. Auch dass um 1500 sich die Kritik am niedrigen intellektuellen Niveau der Pfarrer und Mönche erheblich verstärkte und landläufig wurde, erklärt sich zumindest teilweise aus der Definition neuer Maßstäbe, die der anspruchsvolle Bildungsgedanke der Humanisten autorisierte. Selbst eine im traditionalen Sinne korrekte Amtsführung – nicht nur das offenkundige Pflichtversäumnis – konnte unter diesen Umständen als unbefriedigend empfunden werden. Auch am privilegierten Status, am standesbewussten Habitus und an sittlichem Fehlverhalten des Klerus nahmen die Laien verstärkt Anstoß, ohne sich freilich deshalb grundsätzlich von der Kirche zu distanzieren und ohne das Vertrauen auf die Wirksamkeit ihrer Hilfe zum Seelenheil zu verlieren.78
In der kirchenpolitischen Praxis waren territoriale Obrigkeiten und kommunale Magistrate vor der Reformation bereits jahrzehntelang durchweg bestrebt, die rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Privilegien der geistlichen Immunität und die autonome, häufig missbräuchliche Ausübung der kirchlichen Gewalt nach Kräften einzuschränken. Dabei ging es nicht zuletzt auch um Kompetenzkonflikte wie etwa in den Auseinandersetzungen um die Reichweite und Zuständigkeit der geistlichen und weltlichen Jurisdiktion. Im Urteil der Zeitgenossen leistete diese Bemühung einen wesentlichen Beitrag zur überfälligen Reform der Kirche. Dieser Einschätzung lag ein Reformbegriff zugrunde, der den Status des Klerus in der Gesellschaft kritisch reflektierte, stark auf die kirchliche Administration und ihre Korrektheit bezogen war und die Verantwortung laikaler Kräfte ins Spiel brachte. Dieses Reformverständnis fand programmatischen Ausdruck in den Beschwerden der weltlichen Stände über Anmaßungen und Versäumnisse der Geistlichen und in den Gravamina der deutschen Nation gegen den Hl. Stuhl, dem die einfallsreichen Kunstgriffe des kurialen Fiskalismus, der papale Zentralismus, die raffinierten Winkelzüge der römischen Kurtisanen und die zwielichtige, oft widersprüchliche Handhabung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates angelastet wurden.79 Diese kirchenkritischen Kataloge bezeichnen einen markanten Schwerpunkt im Reformbewusstsein um 1500. Dass Luthers Schrift an den Adel deutscher Nation von 1520 über weite Strecken diesem kirchenkritischen Diskussionsstand verpflichtet war, erklärt zu einem guten Teil die lebhafte positive Resonanz, die sie fand.
Die reformatorische Argumentation konnte darüber hinaus auch an die humanistische Kirchenkritik anknüpfen, wenn auch in anderer Akzentuierung. In ihrer Auseinandersetzung mit der Kirchlichkeit ihrer Zeit operierten die Humanisten mit Vorliebe mit ihrem Bildungsbegriff als Maßstab, der eine philologisch geschulte Intellektualität verlangte. In dieser Perspektive erschien der amtierende Klerus mit seinem mittelalterlichen Latein und seinen meist dürftigen Kenntnissen als rückständig und ignorant, seine Amtspraxis als zumindest partiell abergläubisch und irreführend, etwa was den Reliquienkult, die Ablässe, die Schaufrömmigkeit, den Wunderglauben etc. betraf. Spott und Polemik richteten sich vor allem gegen das Mönchtum, dessen asketische Lebensform ihren Nimbus als exklusiver Heilsweg verlor, und gegen die scholastische Theologie, deren Spitzfindigkeiten bloßgestellt wurden. Ein zweiter Maßstab der humanistischen Kirchenkritik ergab sich aus der Italien- und Romerfahrung und aus der Besinnung auf die nationale Identität der Deutschen. Die scharfen Angriffe etwa Ulrichs von Hutten, aber auch anderer Autoren gegen das Papsttum, dessen Machtanspruch energisch bestritten wurde, und gegen die Kurie, der die rücksichtslose Ausbeutung der deutschen Kirche und ein heilloser Sittenverfall vorgeworfen wurden, diskreditierten die Autorität Roms in drastischer Weise. Diese Kritik gewann Legitimation und Überzeugungskraft auch aus dem Vergleich der aktuellen Befunde mit den Erscheinungsformen des frühen Christentums, das als Maßstab der intendierten Reform galt, die oberflächliche Veräußerlichung und rituellen Formalismus, naive Werkheiligkeit und abergläubisch-magische Fehldeutungen überwinden sollte.80 Diese Reform sollte sich als geistige Erneuerung der Kirche durch Verinnerlichung und Spiritualisierung der Religiosität vollziehen, nicht in Antithese und Polarisierung. Sie wurde durchaus systemimmanent konzipiert. Nur im radikalen Extrem wie etwa bei Hutten stand diese Grundlinie in Frage. Tendenziell hat allerdings der Humanismus in manchem den Durchbruch der Reformation erleichtert oder ihm vorgearbeitet, indem er die scholastische Theologie diskreditierte, das philologische Instrumentarium der Bibelexegese verfeinerte, das Reformbewusstsein stärkte und die Autorität der Amtskirche unterminierte.
Neben den referierten Grundtypen kirchenkritischer Argumentation, die sich im zeitgenössischen Diskurs wechselseitig verstärken konnten, ohne freilich in einer zukunftsweisenden Synthese aufzugehen, sind in der Reflexion über das vorreformatorische Reformbewusstsein auch die Gravamina des geistlichen Standes zu berücksichtigen, die sich vor allem gegen Übergriffe weltlicher Obrigkeiten in kirchliche Kompetenzen wandten. Reform musste in dieser Perspektive die libertas ecclesiae sicherstellen und gewährleisten. Dieses Problemverständnis trübte der großen Mehrheit des deutschen Episkopats auf Jahrzehnte hinaus den Blick für das Wesen und die innovatorische Reichweite der religiös-kirchlichen Neuorientierung, die sich in der reformatorischen Bewegung der zwanziger Jahre und in der anschließenden Konsolidierungsphase der Reformation unter dem Einfluss Martin Luthers und seiner Mitstreiter vollzog. Das aus dieser klerikalen Problemanalyse abgeleitete Reforminteresse bezog sich vornehmlich auf die kirchenpolitische Ebene. Dies gilt auch, wie gezeigt, für die Gravamina der deutschen Nation gegen Papsttum und Kurie und für die Gravamina der weltlichen Stände gegen die Geistlichen. Daneben standen Forderungen, die pastorale Belange betrafen und sich aus dem religiösen Anspruch der vorreformatorischen Kirchenfrömmigkeit herleiteten. Eine spirituelle Alternative dazu bot der erasmische Appell zur Besinnung auf das Wesen des Christentums und zur Konzentration auf die zentralen Aussagen des Evangeliums. Aus diesem Überblick ergibt sich der zusammenfassende Befund, dass das Reformbewusstsein, das sich in der vorreformatorischen Gesellschaft artikulierte, segmentiert blieb, weil seine konkreten Ausprägungen sich aus ganz verschiedenen Analysekriterien herleiteten. Die Durchschlagskraft des Reformangebotes, das Martin Luther aus seinem noch ganz spätmittelalterlichen Heilsbedürfnis heraus entwickelte, erklärt sich nicht zuletzt auch aus dem Sachverhalt, dass es geeignet war, die beobachtete Segmentierung der Reformbegriffe in einem in sich schlüssigen theologischen Konzept zu überwinden. In seiner Rechtfertigungslehre, die das die Gläubigen bedrängende Problem der Heilsgewissheit in ein ganz neues Licht rückte und einen Ausweg aus der spätmittelalterlichen Leistungsfrömmigkeit wies, formulierte Luther ein zentrales Theorem, in dessen Logik in Verbindung mit dem zu seiner Begründung postulierten Schriftprinzip die Lehre vom allgemeinen Priestertum und damit die Erschütterung der kirchlichen Hierarchie und Autorität, zudem die einschneidende Reduktion der zeitgenössischen Frömmigkeitspraxis lag. Die Berufung auf das „sola scriptura“ erwies sich darüber hinaus in der mit einem hohen publizistischen Aufwand geführten öffentlichen Kontroverse als enorm erfolgreiche diskursive Strategie, die die Relevanz der kirchlichen Lehrtradition und des Kirchenrechtes für die Entscheidung der aufgeworfenen Wahrheitsfrage und für den Entwurf einer durchgreifenden Reform negierte und nur das „reine Evangelium“ gelten ließ, dessen Überzeugungskraft und Autorität schwerlich zu bezweifeln waren. Aus dieser theologischen Wende ergab sich eine grundlegende Weichenstellung für die weitere kirchlich-reformatorische Entwicklung, die als „systemsprengende“ Phase eines langfristigen, auch die katholische Reform mit einschließenden Prozesses „normativer Zentrierung in Religion und Gesellschaft“ interpretiert81 bzw. als markant profilierter Höhepunkt eines vom späten Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert zu datierenden „Temps des Réformes“ in eine „Kontinuität des Wandels“ eingeordnet worden ist82. Solche Deutungen sind einerseits als Versuche konzipiert, die innovatorische Leistung der reformatorischen Theologie angemessen zu erfassen, sie stützen sich andererseits auf die Beobachtung, dass die Reformation langfristige kulturelle, institutionelle und soziale Wandlungsprozesse und bedeutsame, zukunftsträchtige Entwicklungslinien, die sich bereits im 15. Jahrhundert abzeichneten – wie die Tendenz zur Verinnerlichung der Religiosität, die Ansätze zur Wahrnehmung kirchenpolitischer Verantwortung durch weltliche Obrigkeiten, das Streben nach kommunaler Autonomie in kirchlichen Dingen, die Ausformung stadtbürgerlicher Wertvorstellungen, den humanistischen Evangelismus etc. –, integrierte, sich anverwandelte oder von ihnen profitierte.83 Dagegen wurden solche Reformkonzeptionen, die mit den neuen theologischen Prinzipien unvereinbar waren, im Klärungsprozess der reformatorischen Bewegung ausgefiltert oder marginalisiert. Luthers Ansatz konzentrierte das Verständnis des Christentums auf einige wenige wesentliche Elemente, die die solus/sola-Formeln bezeichnen, und bündelte zugleich im Lichte dieser von Grund auf erneuerten religiösen Sinnstiftung bereits vorhandene Reformbegriffe. Dies gelang, weil seine Theologie ein tragfähiges theoretisches Bezugssystem schuf, das es erlaubte, wichtige, seit dem 15. Jahrhundert aktuelle Reformpostulate, wie sie z. B. in der Gravaminadiskussion, in der aus der spätmittelalterlichen Frömmigkeit erwachsenen Kleruskritik, in der Tradition der Devotio moderna und im humanistischen Diskurs thematisiert waren, in einer schlüssigen Synthese zu fundieren und damit neu zu legitimieren. Dabei zeigte sich rasch, dass die Frage der Reform nicht zuletzt unter dem Einfluss des Schriftprinzipes aus dem kirchenimmanenten vorreformatorischen Reflexionszusammenhang herausgelöst werden konnte. Dieser Einschnitt wurde abgestützt durch die grundsätzliche Kritik am Kirchenrecht als Menschensatzung, die die hohe Komplexität der innerkirchlichen Strukturen des späten Mittelalters drastisch reduzierte. Unter diesen veränderten Vorzeichen erschloss sich ein innovatorisches Potential, das in der vorreformatorischen Kirchenkritik um 1500 bei weitem nicht abzusehen war.
Die aus dem Ablassstreit bis 1520 hervorgegangenen Schriften Luthers, die seine theologische Position und seinen Reformentwurf schrittweise konturierten, fanden zunächst vor allem bei kirchenkritisch eingestellten Humanisten, dann aber auch bei städtischen Predigern, im Bürgertum und in der Ritterschaft starke Resonanz, weil seine Lehre zum einen die lebhafte Sorge der Zeitgenossen um ihr Seelenheil unmittelbar ansprach und zum anderen unter den Vorzeichen sehr verschiedener Reformerwartungen und soziopolitischer Interessen rezipiert werden konnte. Diese Entwicklung machte die Gravaminadiskussion der Reichsstände obsolet. Je stärker sich in der Folgezeit unter dem Einfluss der religiös-theologischen Kontroverse die Vorstellungen von einer wirksamen Kirchenreform mit polarisierender Tendenz differenzierten, desto mehr Raum gewann die Forderung, ein Generalkonzil oder eine Nationalversammlung mit der Glaubenskrise und der damit zusammenhängenden Reformproblematik zu befassen. Da dieser Ausweg unter den gegebenen politischen Umständen vorab nicht gangbar war, konzentrierte sich das religionspolitische Interesse auf den Versuch, die Reformfrage auf territorialer Ebene auf der Basis der Regensburger Beschlüsse von 1524 im altkirchlichen Sinn oder in kommunaler bzw. landesfürstlicher Initiative nach den reformatorischen Prinzipien zu lösen. Als nach dem Frieden von Crépy das Generalkonzil nach Trient einberufen und tatsächlich eröffnet werden konnte, zeigte sich rasch, dass das vom Papst forcierte Postulat dogmatischer Abgrenzung gegenüber dem Protestantismus sich als vorrangige Leitlinie der Beratungen gegenüber dem vor allem von kaiserlicher Seite betonten Gedanken der Reunion durchsetzen würde und dass zudem im altkirchlichen Lager die Aufgabe der innerkirchlichen Reform unterschiedlich gewichtet wurde und differierende Vorstellungen zu ihrer Bewältigung bestanden. Die Verlegung des Konzils nach Bologna machte schließlich alle Hoffnungen auf einen von Trient ausgehenden, durchgreifenden Reformimpuls vorab zunichte. Die kaiserliche Regierung reagierte darauf zunächst mit einem neuen kompromisstheologisch inspirierten Reunionsprojekt und dann nach dessen Scheitern mit dem Erlass des Interims für die protestantischen Reichsstände und der „Formula reformationis“ für die altgläubige Seite, um wenigstens eine partielle Annäherung zwischen den Religionsparteien zu erreichen.84
Die kaiserliche Reformnotel vom Juni 1548 kann als eine Art Bilanz und als vorläufiger Höhepunkt der reichsintern auf altkirchlicher Seite geführten Reformdiskussion gelesen werden. Nach der frühen Phase beunruhigender Irritation, in der es noch unklar schien, ob Luthers Anliegen im Sinne der humanistischen Kirchenkritik bzw. des vorreformatorischen Evangelismus zu interpretieren oder der geläufigen Gravaminadiskussion zuzuordnen war,85 war die Masse derjenigen Reichsstände, die sich nicht den reformatorischen Lehren anschließen wollten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, erst nach und nach religionspolitisch aktiv geworden. Meist beschränkte man sich dabei zunächst im Vertrauen auf die im Wormser Edikt vom Mai 1521 verankerte Strategie der Gewaltanwendung gegen die Häresie auf repressivautoritäre Strafmaßnahmen zur Abwehr und Unterdrückung der reformatorischen Bewegung. Erst allmählich gewann die Einsicht an Boden, dass dies zur Stabilisierung der alten Kirche allein nicht genügte, dass es vielmehr dringend konstruktiver Reformanstrengungen bedurfte, um die Expansion der neuen Lehre einzudämmen. Von zentraler Bedeutung für die Zukunft war dabei die Prämisse, dass die „richtige“ konfessionelle Entscheidung gründliche Kenntnisse der wahren Lehre voraussetze, mithin ein durchgreifender Erfolg der katholischen Reform nur zu erwarten war, wenn Klerus und Laien über einen soliden religiösen Bildungsstand verfügten. Unter den Bedingungen der Glaubensspaltung, d. h. unter dem Druck der Notwendigkeit, zwischen Häresie und Rechtgläubigkeit zu entscheiden, wurde das Wissen um die wahre Lehre zu einem heilsnotwendigen Faktor, von dem das Seelenheil abhing. Es gewann für den Heilsweg einen ganz neuen, hochbedeutsamen Stellenwert. Damit war in Analogie zur Entwicklung im protestantischen Raum ein Kerngedanke der katholischen Konfessionalisierung formuliert, der über die zunächst ins Auge gefasste, im Sinne der spätmittelalterlichen Kritik konzipierte Beseitigung von Mängeln in der Klerusdisziplin und von allerlei sonstigen Missbräuchen weit hinausführte und der später, im Predigtwesen, im Aufbau katholischer Gymnasien, in der Förderung katholischer Universitäten, in den Bemühungen um die Katechese und in den Volksmissionen konkrete Gestalt gewann. Dieser grundlegende konzeptionelle Wandel, der einer auf Dauer richtungsweisenden Weichenstellung zur spirituellen Erneuerung gleichkam, spiegelt sich nicht zuletzt auch in der Entwicklung der altgläubigen Kontroverspublizistik, die sich in den zwanziger Jahren in der Hauptsache darauf konzentrierte, lutherische Lehren zu widerlegen, sie in die Geschichte der Häresie einzuordnen und sie als Anleitung zum Aufruhr und zum Umsturz aller Ordnung zu diskreditieren. Seit den dreißiger Jahren verlor diese Strategie polemischer Abwehr, die der später in Trient festgeschriebenen dogmatischen Abgrenzung den Weg bahnte, allmählich an Bedeutung. Vor allem die humanistisch orientierten Autoren setzten seitdem mehr und mehr darauf, sich auf territorialer Ebene an Reformplanungen zu beteiligen, ein vertieftes Reformverständnis zur Wirkung zu bringen und Klerikern und Laien Bibelübersetzungen, Katechismen und liturgische Erläuterungen an die Hand zu geben, um das nötige religiöse Wissen zu vermitteln und zu vertiefen und so die altkirchliche Glaubenspraxis von innen her zu festigen und widerstandsfähig zu machen.86 Tragfähige Erfolge waren auf diesem literarischen Wege, der zu einer vor allem durch erasmischen Einfluss erneuerten „Verkündigungstheologie“ hinführen sollte, allerdings nur dann zu erwarten, wenn weitere zielbewusste kirchliche Initiativen im Rahmen einer durchgreifenden Reformoffensive hinzutraten. Die bis 1548 vereinzelt veranstalteten Diözesansynoden konnten dem Postulat kirchlicher Erneuerung freilich kaum gerecht werden, weil sie das bereits im 15. und frühen 16. Jahrhundert vergeblich erprobte Verfahren beibehielten und sich meist damit begnügten, bestehende Vorschriften und kirchenrechtliche Bestimmungen in Erinnerung zu rufen und ihre Befolgung erneut einzufordern. Auch aus den wenigen, im gleichen Zeitraum durchgeführten territorialen Visitationen ergaben sich keine tragfähigen Reformimpulse, die über die desillusionierende Bestandsaufnahme hätten hinausführen können. Ihre Befunde konnten immerhin einfließen in das wachsende Reformbewusstsein, das sich an verschiedenen Initiativen studieren lässt.87
Bereits im Mai 1522 wurde unter dem Einfluss der bayerischen Herzöge auf dem Mühldorfer Konvent für die Salzburger Kirchenprovinz ein Programm beschlossen, das eine gründliche Reform des Pfarrklerus, eine Generalvisitation, deren Ergebnisse auf einem Provinzialkonzil zur Fortführung der Reform verarbeitet werden sollten, und die Koordination der Maßnahmen aller deutschen Erzbischöfe zur Unterdrückung der lutherischen Schriften vorsah. Allerdings glaubten die beteiligten Bischöfe schon im Februar 1523, sich nicht vorbehaltlos auf dieses Reformprojekt einlassen zu können. Es blieb denn auch wirkungslos.88
Die bayerischen Herzöge eröffneten sich indes eine im Laufe der Zeit zügig ausgebaute religionspolitische Alternative, indem sie die Kooperation mit der Kurie suchten und von Dr. Johann Eck 1523 / 1524 wichtige Privilegien aushandeln ließen, die ihnen das Recht zu Klostervisitationen und zur Besteuerung des Klerus, Nominationsrechte für eine ansehnliche Zahl von Pfründen und die Befugnis einräumten, durch landsässige bayerische Prälaten gegenüber dem Klerus die Strafgerichtsbarkeit auszuüben.89 Das derart gestärkte, seit dem 15. Jahrhundert angestrebte landesherrliche Kirchenregiment ließ sich künftig im Einvernehmen und in Kooperation mit dem Papsttum zur Durchsetzung kirchlicher Reformen ausgiebig nutzen.
Zugleich unterstützten die Herzöge zusammen mit Erzherzog Ferdinand den Plan des päpstlichen Legaten Campeggio, die regionalen altkirchlichen Kräfte zu gemeinsamer Aktivität zusammenzufassen, statt auf die Durchführung des Wormser Ediktes auf Reichsebene zu bauen. Dabei zeigte sich freilich rasch, dass noch kein Konsens im Reformverständnis bestand. Die Geistlichen versteiften sich nämlich auf die These, dass sich die neue Lehre vornehmlich deshalb so rasch und weitläufig ausbreite, weil die permanente Missachtung der geistlichen Immunität und Jurisdiktion den Status des Klerus in Misskredit gebracht und damit dessen Autorität untergraben habe. Deshalb galt ihnen die Abstellung aller Eingriffe weltlicher Instanzen in kirchliche Rechte als eigentliches Kernstück einer Reform und als unabdingbare Voraussetzung aller Bemühungen um die Verbesserung der Seelsorge und der Klerusdisziplin. Erzherzog Ferdinand und die bayerischen Herzöge weigerten sich freilich, sich in Regensburg auf dieses Konzept einzulassen, verlangten die Beseitigung der kirchlichen Missstände, in denen sie die Ursache für den Erfolg der neuen Lehre sahen, und setzten, unterstützt von Campeggio, durch Druck und Drohungen durch, dass sich der Konvent zur Bekämpfung der evangelischen Bewegung als Einung zusammenschloss und eine vom Legaten konzipierte und kraft päpstlicher Vollmacht autorisierte Reformordnung annahm, die die Mühldorfer Vorlage erweiterte und präzisierte. Dass dabei auch den weltlichen Obrigkeiten religionspolitische Verantwortung und Kompetenz zugesprochen wurde, widersprach dem bischöflichen Reformverständnis diametral. Die Bischöfe unterließen es denn auch, dem als Oktroi empfundenen Regensburger Reformauftrag nachzukommen. Diese Untätigkeit des Episkopats konterkarierte die religionspolitischen Intentionen der bayerischen Herzöge und ihr Interesse an einer durchgreifenden kirchlichen Erneuerung, die sie, wie im Übrigen auch König Ferdinand, zur Stabilisierung der territorialen Verhältnisse für unerlässlich hielten.90 Immerhin bot die Salzburger Provinzialsynode vom Mai 1537 Gelegenheit zur Intensivierung der Reformdiskussion und zur Planung entsprechender Aktivitäten. Ihre Realisierung durchkreuzte freilich der Einspruch des Papstes, der die Initiative des Erzbischofs als einen unzulässigen Vorgriff auf die Entscheidungsfindung des ausgeschriebenen Generalkonzils verwarf und scharf tadelte. Unabhängig davon belasteten die Differenzen im Reformverständnis auch weiterhin die religionspolitische Kommunikation zwischen geistlicher und weltlicher Obrigkeit. Immer wieder stießen die bayerischen und österreichischen Reforminitiativen und Visitationspläne beim Episkopat der Salzburger Provinz, der in ängstlicher Sorge um die libertas ecclesiae durch Resistenz und dilatorische Schachzüge seine Rechte und Kompetenzen gegen weitreichende staatskirchliche Ambitionen glaubte schützen zu müssen, auf Bedenken oder Ablehnung. Es brauchte Jahrzehnte, bis die Bischöfe der Salzburger Kirchenprovinz einsahen, dass ihr Reformbegriff durch die fortgeschrittene Entwicklung seit geraumer Zeit überholt war. Die Erfahrungen, die man seit Mühldorf mit den Ordinarien gemacht hatte, legten es Bayern nahe, die Kirchenreform künftig verstärkt in die eigene Regie zu nehmen, das landesherrliche Kirchenregiment weiter auszubauen und so die Blockade aufzulösen, die die Ordinarien, indem sie die Reformfrage mit ihren Gravamina verknüpften, herbeigeführt hatten.91
Diesen Weg schlug Herzog Johann von Jülich-Kleve unter dem Eindruck der Resonanz, die neugläubige Lehren auch in seinen Territorien fanden, bereits 1532 ein, als er sich entschloss, der Glaubenskrise durch den Erlass einer eigenen Kirchenordnung entgegenzuwirken. Er konnte sich dabei auf ein bereits eingeübtes, stark ausgeprägtes landesherrliches Kirchenregiment stützen, dessen weiteren Ausbau auch sein Nachfolger, Herzog Wilhelm V., zielstrebig betrieb. Zugleich ließ er sich durch ein Problemverständnis leiten, das seine humanistisch gebildeten Räte aus erasmischem Gedankengut entwickelt hatten. Die Ausbreitung der evangelischen Bewegung wurde in dieser Perspektive vorrangig als Quelle des Unfriedens und der Unordnung wahrgenommen. Damit verband sich die Einsicht, dass, um ihr zu wehren, repressive Maßnahmen, auch ein allgemeiner Reformappell an den Klerus und diverse Religionsmandate nicht genügten. Es brauchte vielmehr ein Reformprogramm, das die verschiedenen religiösen Strömungen auf die substantiellen Glaubensinhalte und das Ideal wahrhaft christlicher Frömmigkeit verpflichtete und Friede und Eintracht in Gesellschaft, Territorium und Kirche versprach. Dieses Konzept schloss den offenen Bruch mit der römischen Kirche und jede einseitige Radikalisierung aus, tendierte zum religiösen und theologischen Kompromiss und verlangte eine aufrichtige Bereitschaft zur Unparteilichkeit. Es zielte darauf ab, die klerikale Amtsführung zu optimieren, die religiöse Bildung des Klerus und des Volkes zu heben, das religiöse Leben aus dem Geist des Evangeliums zu erneuern und den religiösen Sinn der Zeremonien und Sakramente verständlich zu machen, um abergläubischen Vorstellungen und Missverständnissen entgegenzuwirken. Die Glaubenslehre wurde auf die wichtigsten Punkte reduziert. Statt sich auf die gravierenden theologischen Streitfragen, deren Entscheidung einem Generalkonzil vorbehalten bleiben sollte, einzulassen, konzentrierte man sich darauf, unter dem Einfluss der erasmischen Interpretation des Evangeliums Klerus und Untertanen zu christlicher Lebensführung im Sinne der Imitatio Christi anzuleiten. Dieses Programm zwang in der Sicht der Düsseldorfer Erasmianer nicht zum Bruch mit der alten Kirche. Sie gingen allerdings davon aus, dass äußere Formen, Bräuche, kanonische Vorschriften und menschliche Satzungen als nicht heilsnotwendig relativiert werden durften. Der damit gewonnene Spielraum konnte genutzt werden, um evangelischen Reformforderungen – z. B. durch Flexibilität in Fragen der geistlichen Jurisdiktion, durch die Freigabe des Laienkelches, durch die Duldung der Priesterehe, durch Konzessionen in der Gestaltung der Messe oder durch die Abschaffung bestimmter Frömmigkeitsformen – entgegenzukommen. Dabei galt allerdings trotz aller Entschlossenheit zur Konsolidierung und Stärkung des landesherrlichen Kirchenregimentes stets der explizite Vorbehalt, dass zu endgültigen, allgemein verbindlichen Festlegungen und Lehrentscheidungen nur ein Generalkonzil befugt sei.92
Auch außerhalb Jülichs steuerte die Reformdiskussion mitunter auf vermittelnde, zum Teil explizit humanistisch-erasmisch beeinflusste Konzeptionen zu.93 Einer ganz anderen Linie folgte die Kölner Provinzialsynode vom März 1536. Ihre Anfang 1538 im Druck erschienenen Statuten über die Aufgaben und Pflichten der Bischöfe und Seelsorger, über die Lebensführung und den Unterhalt des Pfarrklerus, über die Ordnung an Kathedralkirchen und in den Pfarreien, über Predigt und Sakramentsverwaltung, über die Belehrung der Gläubigen über den Sinn kirchlicher Gebote und liturgischer Formen, über die Erneuerung des monastischen Lebens, über das Schulwesen und die geistliche Jurisdiktion, über Visitationen und Synoden intendierten eine gründliche und umfassende Reform, die sich nicht in der korrekten Beobachtung tradierter kirchenrechtlicher Vorschriften erschöpfen sollte, sondern einem neuen Priesterbild und pastoralen Ideal verpflichtet war. Sie fanden zwar in altkirchlichen Kreisen weit über Deutschland hinaus hohe Anerkennung, sie wurden aber weder in der Reichsstadt Köln noch im Hochstift in die Praxis umgesetzt. Verhandlungen mit Jülich über ihre Durchführung gestalteten sich schwierig, weil sich der Herzog von seinen Vorbehalten gegenüber der geistlichen Jurisdiktion nicht abbringen ließ und das kanonische Visitationsrecht des Erzbischofs nicht anerkannte. Die konfliktträchtige Spannung zwischen landesherrlichem Kirchenregiment und erzbischöflicher Amtsautorität belastete auch in Zukunft kirchliche Reformversuche am Niederrhein.94
So war im Ganzen in der Auseinandersetzung altkirchlicher Kräfte mit der Reformfrage im Reich ein weit fortgeschrittener Reflexionsstand erreicht, der freilich noch kaum praktische Wirkung zeigte, u. a. weil Kompetenzkonflikte zwischen weltlichen Fürsten und den zuständigen Ordinarien Misstrauen schufen und eine gemeinsame, tatkräftige Reformpolitik verhinderten, mitunter gegenläufigen Interessen Priorität eingeräumt wurde, und die Ungewissheit, für welches Konzept die kaiserliche Regierung optierte, oder die Scheu, dem geforderten, wiederholt angekündigten Generalkonzil in unbefugter Weise vorzugreifen, die reformerische Aktivität lähmte. Erst die kaiserliche Formula reformationis vom 14. Juni 154895, die detaillierte Vorschriften zur Qualifikation des Klerus und seiner Lebens- und Amtsführung, zum Studien- und Schulwesen, zur Spendung der Sakramente und Benediktionen, zur Durchführung von Visitationen und zur regelmäßigen Veranstaltung von Diözesan- und Provinzialsynoden enthielt und damit zahlreiche Reformbeschlüsse des Trienter Konzils vorwegnahm, schien geeignet, die bislang dezentral und isoliert geführte Reformdiskussion zu koordinieren und auf eine einheitliche Linie auszurichten. Sie bot die Möglichkeit, reformfeindliche Kräfte in den Diözesen zu überspielen, und motivierte die sich seit den dreißiger Jahren allmählich bildenden, kleinen reformkatholischen Kreise zu verstärktem Engagement. Den anfänglich starken Reformimpuls, den diese kaiserliche Initiative auslöste, belegen die mitunter bemerkenswert gründlichen Diskussionen über Detailfragen, die sich aufgrund besonderer Gegebenheiten jeweils für einzelne Diözesen stellten, auf den im Reichsabschied von 1548 geforderten, termingerecht einberufenen Provinzialsynoden der Erzdiözesen Trier, Köln, Mainz und Salzburg und auf den zu ihrer Vorbereitung bzw. zur Umsetzung ihrer Statuten veranstalteten Diözesansynoden. Dabei begnügte man sich nicht mehr damit, bereits vorliegende, ältere Bestimmungen zum Benefizialwesen, zur Disziplin des Klerus und seiner Amtspraxis zu wiederholen, sondern dehnte die Beratungen auf das gesamte Gebiet der pastoralen und religiösen Bildung des Klerus und der Laien aus und legte damit den Schwerpunkt auf die spirituelle Erneuerung der Kirche. Diese weitgreifende Reformplanung sah, wie später auch das Trienter Konzil, zugleich intensive Visitationen auf Diözesanebene vor, die zum Teil bereits unmittelbar im Anschluss an die Synoden durchgeführt wurden und den Reformern eine verlässliche Bestandsaufnahme an die Hand geben sollten. Damit war zwar im Reich ein weit fortgeschrittener Stand der Reformdiskussion erreicht, über den auch die späteren Trienter Beratungen nicht wesentlich hinausführten, aber der anfängliche reformerische Elan blieb ohne weiter reichende Wirkung. Als Haupthindernisse, die den gefassten Reformbeschlüssen in der Praxis entgegenstanden, nannten die rheinischen Erzbischöfe auf dem Augsburger Reichstag 1550 / 1551 den Mangel an qualifizierten Priestern und die Exemtionen zahlreicher kirchlicher Institutionen. Hinzu kamen Konflikte wie z. B. zwischen Köln und Jülich um die Reichweite der geistlichen Jurisdiktion und des bischöflichen Visitationsrechtes, lokale Probleme aufgrund verwickelter Rechtsverhältnisse und Irritationen im Umgang mit den Spezialindulten, die der Kaiser beim Papst zur Erleichterung der Reform erwirkt hatte.96
Die 1552 beendete, zweite Periode des Trienter Konzils brachte keinen nennenswerten Fortschritt in der Reformfrage. Erst als Pius IV. Anfang Dezember 1560 das Konzil erneut nach Trient berief, eröffneten sich neue Chancen für die Erneuerung der Kirche.97 Auch in dieser Konzilsperiode vertraten nicht wenige Bischöfe die Auffassung, dass es genüge, die bestehenden, alten Vorschriften und Bestimmungen zur Geltung zu bringen, um den eingerissenen Missständen abzuhelfen. Allerdings hatten sich die Anhänger dieser konservativen Position mit den viel weiter reichenden, in vielen Punkten übereinstimmenden, wenn auch unterschiedlich akzentuierten Reformforderungen auseinander zu setzen, die im Laufe dieser dritten Sitzungsperiode von italienischer, spanischer, französischer, portugiesischer und kaiserlicher Seite in die Debatte eingebracht wurden. Die entsprechenden Denkschriften wurden zwar nur in Auszügen zur Diskussion gestellt, provozierten aber auch in dieser verkürzten Form heftige Kontroversen. Dass es am Ende trotzdem gelang, neben einigen Dekreten, die die dogmatische Abgrenzung gegenüber dem Protestantismus vervollständigen sollten, einen Katalog wegweisender Reformen zu verabschieden, war in der Hauptsache das Verdienst des Legaten Giovanni Morone, der aus den vorliegenden nationalen Reformdenkschriften eine zunächst 42, dann 36 Artikel umfassende Reformvorlage zusammenstellen ließ und diese mit päpstlichem Konsens im August 1563 den Konzilsvätern zur Vorklärung zustellte. Auf diesem Entwurf basierten im Wesentlichen die Trienter Reformbeschlüsse über die Residenzpflicht, die Qualifikation und die Amtsführung der Bischöfe, denen das pastorale Ideal des guten Hirten als Leitlinie vorgegeben wurde und denen man als Delegaten des Heiligen Stuhles zur Stärkung ihrer Jurisdiktion erweiterte Kompetenzen zugestand, über die Disziplin des Pfarrklerus, seine Verantwortung in der Seelsorge und seine Verpflichtung auf den Zölibat, über die Führung von Pfarrmatrikeln zu Taufen, Ehen und Sterbefällen, einschließlich der Betonung des Pfarrprinzips für den Sakramentenempfang, über die Einrichtung von Priesterseminaren und die Examinierung der Priesterkandidaten zur Sicherung der Qualifikation des klerikalen Nachwuchses, über die Praxis der Sakramentenspendung, über die Reform der Orden, über die regelmäßige Veranstaltung von Diözesan- und Provinzialsynoden und Visitationen und über die Beseitigung von Missständen im Benefizialwesen durch das Verbot der Pfründenkumulation, der Regresse und ähnlicher fragwürdiger Praktiken etc. Unerledigt blieben die Überarbeitung des Index der verbotenen Bücher, der Entwurf eines verbindlichen Katechismus und die Revision des Breviers und des Missales. Diese Aufgaben übertrug das Konzil dem Papst. Gravierender war, dass das Konzil nur in Einzelfragen Kompetenzen der Kurie modifizierte, eine grundlegende Reform ihres Behördensystems aber dem Papst vorbehalten blieb. Als Kardinal Morone am 4. Dezember 1563 in der Trienter Kathedrale das Konzil für beendet erklärte, stand die „reformatio in capite“ noch aus.98
Das Tridentinum vollzog zwar mit der Rückwendung zum Thomismus und zur mittelalterlichen Scholastik eine theologische Weichenstellung, die andere zeitgenössische Richtungen wie etwa die augustinisch inspirierte Theologie und den betont bibelorientierten christlichen Humanismus und seine Irenik ausgrenzte und damit der Gefahr intellektueller Einseitigkeit Vorschub leistete, es schuf aber zugleich, indem es die Trennlinien zum Protestantismus scharf markierte, die Voraussetzungen für die Entwicklung eines klaren Konfessionsbewusstseins, das Selbstgewissheit vermitteln und so stabilisierend wirken konnte. Im Gesamtergebnis seiner Reformberatungen ist die Tendenz zum pragmatischen Kompromiss nicht zu übersehen, die in vielen Punkten eine Einigung erst möglich gemacht hatte. Es handelt sich nicht um ein konzeptionell in sich geschlossenes Reformprogramm, sondern um eine Ansammlung von Dekreten, die in der Regel an bereits bestehende, ältere Vorschriften und Bestimmungen anknüpften, diese in moderater Form weiterentwickelten und erneut bewusst machten. Nur wenige Dekrete enthielten tatsächlich neue Regelungen. Damit hatte das Konzil einen tendenziell konservativen Rahmen geschaffen, zugleich die Aufmerksamkeit auf die Seelsorge und den pastoralen Auftrag der Kirche als oberste Leitlinie gelenkt und der künftigen kirchlichen Praxis und ihren Trägern die Aufgabe gestellt, die intendierte kirchliche Erneuerung konkret zu profilieren und spirituell zu entfalten. Dass diese Chance langfristig erfolgreich genutzt werden konnte, verdankte sich dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte: der Mitwirkung des Papsttums, dem Engagement der Orden, vor allem der Spiritualität der Reformorden, dem Einsatz vorbildlicher Reformbischöfe und der Ausstrahlungskraft der erneuerten Laienfrömmigkeit. Allerdings blieb es trotz der formellen Autorität des Generalkonzils gerade im Reich noch lange schwierig genug, dem tridentinischen Reformauftrag gerecht zu werden.99
In Trient hatte der Konziliarismus seine in Rom lange gefürchtete Aktualität endgültig verloren. Das Papsttum konnte sich deshalb die tridentinischen Reformbeschlüsse ohne ekklesiologische Bedenken zu eigen machen, ihre Realisierung unter Berufung auf die im altkirchlichen Raum dem Generalkonzil zugerechnete Autorität einfordern und so seinen Anspruch und seine Funktion als zentrale geistliche Führungsinstanz im Dienst der Erneuerung verstärkt zur Geltung bringen.100 Pius IV. bestätigte mit der auf den 26. Januar 1564 datierten Bulle „Benedictus Deus“ die Trienter Beschlüsse, publizierte im März 1564 den auf dem Konzil erstellten Index verbotener Schriften, fasste die Glaubensdekrete der Kirchenversammlung in der „Professio fidei Tridentina“ zusammen, die für den Klerus, für Professoren und Doktoren, dann auch für die übrigen Beamten verbindlich gemacht wurde, und stellte so Lehre und Bekenntnis auf eine gefestigte einheitliche Grundlage.101 In der Folgezeit galt es, die Konzilsbeschlüsse in den noch katholischen Gebieten zu publizieren, ein langwieriges Unternehmen, das im Reich nur partielle Erfolge zeitigte.102 Dementsprechend schwierig gestaltete sich der Versuch, in den deutschen Diözesen auf den in Trient vorgesehenen Wegen Reformen in Gang zu bringen. Während in Italien das vorbildliche Wirken des Mailänder Erzbischofs Carlo Borromeo Schule machte und dem Papsttum in Italien vielfältige Möglichkeiten zu Gebote standen, um die Rechtgläubigkeit zu sichern und Missstände abzustellen, war man im Reich auf die konstruktive Kooperationsbereitschaft des Kaisers und der altgläubigen Stände angewiesen. Mit allgemeinen Appellen und päpstlichen Breven, die zur Durchführung der Trienter Beschlüsse mahnten, war freilich beim deutschen Episkopat, der bekanntlich an den Konzilsentscheidungen allenfalls marginal beteiligt war und dessen Vertreter auf dem Augsburger Reichstag 1566 nur die Trienter Glaubensdekrete vorbehaltlos annahmen, nicht allzu viel auszurichten. Nur in der Salzburger Kirchenprovinz, wo der Dominikaner Felician Ninguarda als apostolischer Kommissar unmittelbaren Einfluss gewinnen konnte, kam 1569, wie vom Konzil gefordert, eine Provinzialsynode zur Einleitung von Reformen zustande.103 Deren dogmatische Grundlagen definierte der neue Catechismus Romanus (1566), der das katholische Glaubensgut auf der Basis des Tridentinums formulierte. Die von Pius V. mit der Edition des römischen Breviers (1568) und des römischen Missales (1570) intendierte Liturgiereform fand allerdings nur allmählich und nur teilweise Anklang in deutschen Diözesen.104
Während Pius V. vor allem die kirchliche Erneuerung in Italien förderte, schlug Gregor XIII. andere Wege ein, um die Intentionen des Tridentinums zu verwirklichen. Er setzte unter anderem schwerpunktmäßig auf die Mobilisierung intellektuellen Potentials, indem er die römische Universität und das Kolleg der Jesuiten großzügig förderte, nationale Kollegien zur Klerusausbildung gründete bzw. wie das Collegium Germanicum reorganisierte und finanziell besser ausstattete, um dem Priestermangel z. B. im Reich abzuhelfen und einen zuverlässigen romtreuen Klerus für kirchliche Führungspositionen heranzubilden. Im Zuge dieser päpstlichen Bildungspolitik wurde Rom unter maßgeblicher Mitwirkung der Jesuiten zur zentralen kirchlichen Ausbildungsstätte mit beachtlicher intellektueller Ausstrahlung und Prägekraft. Zudem bündelte Gregor XIII. zu Beginn seines Pontifikates die kuriale Meinungsbildung über die kirchliche Lage im Reich und über geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung und Regeneration der deutschen Kirche, indem er die bereits unter Pius V. 1568 eingerichtete, aber bedeutungslos gebliebene Congregatio Germanica reaktivierte, mit Kennern der deutschen Verhältnisse besetzte und ihr Gutachten zu reformrelevanten Fragen einholte. Zugleich revidierte die Kurie ihre Strategie. Statt wie noch unter Pius V. bevorzugt auf die Unterstützung des Kaisers zu setzen, suchte man nun vor allem die Kooperation mit den katholischen Territorialobrigkeiten, denen der Augsburger Religionsfriede eine Schlüsselkompetenz zugewiesen hatte. Es ging dabei vorab vor allem um die Sicherung und Festigung des Katholizismus in seinem Restbestand. Dies gilt auch für die Entscheidung Gregors XIII., das seit Leo X. ausgebaute päpstliche Gesandtschaftswesen einzusetzen, um den Episkopat und die noch altgläubigen weltlichen Fürsten in engeren Kontakt zu Rom zu bringen und zugleich die intendierten Reformen zu steuern und zu kontrollieren. Am Niederrhein und in Oberdeutschland wurden 1573 mit der Entsendung Kaspar Groppers und Bartolomeo Portias Reformnuntiaturen begründet, die dann seit 1580 in Graz und seit 1584 in Köln ihren festen Sitz hatten.105 Die Nuntien am Kaiserhof, die auch weiterhin vorwiegend mit Problemen der aktuellen Politik befasst blieben, beschränkten sich in der Regel darauf, der Protestantisierung gefährdeter Hochstifte vorzubeugen und auf die kirchlichen Verhältnisse der habsburgischen Erblande im Sinne Roms Einfluss zu nehmen.
Schwierigkeiten bereitete mitunter die religiöse Haltung Maximilians II., der nicht nur einen antiprotestantischen Konfrontationskurs, sondern auch die Publikation des Tridentinums ablehnte,106 zudem neben dem Laienkelch hartnäckig die Duldung der Priesterehe verlangte und zugleich einen namhaften päpstlichen Beitrag zur Türkenabwehr erwartete. Auch mit Rudolf II. taten sich die Nuntien mitunter schwer, weil sich der Kaiser keineswegs darauf festlegen lassen wollte, als Speerspitze der kurialen Politik zu fungieren. Auch die katholischen Reichsstände ließen sich vorab nicht, wie gewünscht, für eine energische antiprotestantische Offensive gewinnen und waren nur mit Mühe zu bewegen, als geschlossene Partei aufzutreten. Sie übten sich in der Sorge um den Bestand des Religionsfriedens lieber in vorsichtiger Zurückhaltung.
Auch in der Amtsführung der Reformnuntien, die sich durchweg redlich abmühten, die Trienter Dekrete zur Annahme und Durchführung zu bringen, Visitationen zu veranstalten und Synoden zu organisieren, die Professio fidei allenthalben durchzusetzen, die Gründung von Priesterseminaren zu betreiben, Missstände in Domkapiteln und Klöstern zu beseitigen, die Klerusdisziplin wiederherzustellen und die materiellen Grundlagen kirchlicher Einrichtungen zu sichern, die Tätigkeit der Reformorden zu unterstützen, die Katholizität der Hochstifte zu schützen, die katholische Publizistik zu fördern, den Büchermarkt zu kontrollieren und Maßnahmen zur Rekatholisierung zu initiieren,107 blieben politische Belastungen, Kompetenzkonflikte mit Bischöfen und enttäuschende Erfahrungen nicht aus. Im Normalfall und im Amtsalltag konnten sich die Nuntien, von Ausnahmesituationen abgesehen, nur auf die Mithilfe einzelner Amtsträger und der Reformorden, besonders auf das dichte, ausgedehnte Kommunikationsnetz der Jesuiten stützen.108 Ihre Erfolgsaussichten blieben abhängig von der jeweiligen politischen Konstellation und von der Kooperationsbereitschaft der Fürstbischöfe und der weltlichen Obrigkeiten, auf deren besonderen Interessen bzw. religionspolitischen Eigenmächtigkeiten, die sich oft genug mit dem Kirchenrecht und den Trienter Dekreten kaum vereinbaren ließen, Rücksicht zu nehmen war. Dabei ergaben sich immer wieder Differenzen, die Kompromisse notwendig machten oder nur halbherzige oder gar inkonsequente Reaktionen der Kurie zu erlauben schienen. Von einer geradlinigen Durchsetzung der tridentinischen Reformpostulate im Rahmen einer durchgreifenden Zentralisierung kann deshalb trotz aller Bemühungen und Interventionen der Nuntien im Einzelnen nicht die Rede sein. In Rom neigte man im Zweifelsfall eher zu vorsichtigem Taktieren und behutsamem Vorgehen. Überhaupt zwangen die besonderen Verhältnisse der Reichskirche als Adelskirche immer wieder zu Abstrichen am Programm von Trient. Die Hauptgründe dafür lagen in der Doppelrolle der Reichsäbte und Fürstbischöfe als weltliche und geistliche Oberhäupter, in der Rekrutierung des Episkopats aus dem Adel und in der starken Stellung der Domkapitel. Die Nuntien reflektierten diese strukturellen Hindernisse durchaus, ohne freilich ein realisierbares Konzept für eine gründliche Abhilfe anbieten zu können.109 Dass der in Trient vorgeschriebene reguläre Weg der Reform, die Veranstaltung von Provinzial- und Diözesansynoden, im Reich nur sehr sporadisch und nur in Einzelfällen mit weiter reichendem Erfolg eingeschlagen wurde, hat das Papsttum schließlich hingenommen, wohl auch weil das Interesse an synodalen Strukturen erlahmte. Schließlich hat man in Rom manche Trienter Dekrete selbst aus dem Auge verloren, andere partiell revidiert.110 Während der Pontifikate der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wandelte sich auch die institutionelle Qualität der Nuntiaturen im Reich. Je mehr man in Rom den Eindruck gewinnen konnte, dass sich die katholische Reform und die territoriale Rekatholisierung selbst zu tragen begannen, traten in den Instruktionen für die Nuntien die Anweisungen zur Reform zurück.111 In Köln konnte Antonio Albergati zu Beginn des Jahrhunderts auf den Vorsitz im Geistlichen Rat verzichten und sich darauf beschränken, nur dort einzugreifen, wo dem Erzbischof nach Lage der Dinge die Hände gebunden waren, in den niederrheinischen Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg, wo seine Jurisdiktion nicht anerkannt wurde, und in den Klöstern der exemten Orden.112 In der Folgezeit begnügten sich die Nuntien allmählich mit der Rolle normaler diplomatischer Geschäftsträger, die ansonsten nur noch routinemäßige Funktionen in der Dispenspraxis, in der geistlichen Jurisdiktion und in der Ausübung päpstlicher Stellenbesetzungsrechte wahrnahmen. Reform und Rekatholisierung lagen fortan vornehmlich in der Initiative und Verantwortung der katholischen Fürsten und des Episkopats, dessen Qualifikation durch die Informativprozesse sichergestellt werden sollte und der über seine Tätigkeit entsprechend den Vorschriften Sixtus’ V. von 1585 bei regelmäßigen Ad-limina-Besuchen bzw. durch die Vorlage von Status-Berichten kontinuierlich Rechenschaft abzulegen hatte. Bis dahin hatten das Papsttum von Pius IV. bis Gregor XV. und seine Nuntien für die Erneuerung der katholischen Kirche im Reich zwar zeitweise eine wichtige, aber keineswegs durchgehend dominante Rolle gespielt. Sie hatten als Akteure neben anderen gewirkt, denen vor Ort auch in Phasen richtungsweisender päpstlicher Aktivität die Hauptlast zufiel. Ob aus den wenig originellen Reformempfehlungen und -vorschriften des Trienter Konzils, die sich überwiegend auf konsensfähige Kompromisse beschränkten, ein überzeugendes Programm zur Katholisierung der Gesellschaft entwickelt und dann in einer erfolgversprechenden Strategie realisiert werden konnte,113 hing von Anfang an unter anderem maßgeblich vom Reformwillen der altgläubigen Fürsten und Bischöfe, ihrer Einsatzbereitschaft und ihrer Durchsetzungskraft ab.