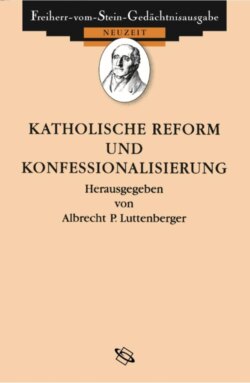Читать книгу Katholische Reform und Konfessionalisierung - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAls am 23. Mai 1566 Kurfürst Daniel von Mainz gegenüber dem päpstlichen Legaten Commendone die Bereitschaft der auf dem Augsburger Reichstag vertretenen katholischen Stände erklärte, die Trienter Dogmendekrete vorbehaltlos anzuerkennen, machte er zugleich deutlich, dass der Durchführung der Reformbeschlüsse in Deutschland erhebliche Hindernisse entgegenstünden und deshalb Abstriche und Modifikationen nicht zu umgehen seien. In der Tat ließen die strukturellen Gegebenheiten der aristokratisierten Reichskirche mit ihrem komplexen Benefizialwesen und ihren zählebigen Missbräuchen eine zügige oder gar umgehende Verwirklichung der Trienter Vorschriften kaum erwarten.114 Zudem hatte der Augsburger Religionsfriede erst vor wenigen Jahren die bikonfessionelle Koexistenz der Reichsstände leidlich geregelt. Aufgrund der realen Machtverteilung und im ureigensten Sicherheitsinteresse fühlte sich der Episkopat gehalten, die Augsburger Ordnung nicht durch eine provokant katholische Konfessionspolitik in Frage zu stellen und die Beziehungen zu protestantischen Nachbarn unnötig zu belasten. Zwar konnten die Bischöfe bei religionspolitischen Initiativen Rückhalt bei altgläubigen weltlichen Landesherren finden, aber auch hier blieben im Streit um kirchenpolitische Kompetenzen und in der Abwehr territorialkirchlicher Ambitionen konfliktträchtige Spannungen nicht aus, die Reformansätze blockieren konnten. Erst nach und nach konnten durch Konkordate und entsprechende Vereinbarungen die Rechte und Zuständigkeiten geistlicher und weltlicher Obrigkeiten einvernehmlich geklärt werden. Zeit brauchte es auch, um den Nachholbedarf der meisten Hochstifte in der Ausformung frühmoderner Staatlichkeit einigermaßen auszugleichen und damit Autorität und Durchsetzungsfähigkeit der Fürstbischöfe nachhaltig zu stärken. Dies musste, wie das Beispiel des Erzstiftes Mainz zeigt, nicht zwangsläufig bedeuten, dass die staatlich-administrative Entwicklung und die kirchliche Reform strikt parallel zueinander liefen und sich wechselseitig „dynamisierten“.115 Es spricht manches dafür, dass dies cum grano salis auch für andere Hochstifte, zumindest für diejenigen mit geringem Territorialbesitz gilt. Jedenfalls standen allenthalben die Stiftsverfassungen einer konsequent protoabsolutistischen Entwicklung entgegen, die denn auch gemeinhin, von Ausnahmen und einigen markanten Ansätzen abgesehen, nicht zum Tragen kam. Allerdings musste, um der Reform zum Erfolg zu verhelfen, die aus dem Mittelalter überkommene Dezentralisation der innerkirchlichen organisatorischen und jurisdiktionellen Funktionen, die auf Domkapitel, Archidiakone etc. verteilt waren oder durch Exemtionen bzw. territoriale Sonderrechte beeinträchtigt wurden, entsprechend der Intention des Konzils, die kirchliche Führungskompetenz beim Bischof zu konzentrieren, überwunden werden. In den ersten Jahrzehnten nach dem Trienter Konzil zögerten freilich noch viele Fürstbischöfe, in dem gegebenen komplexen Handlungs- und Bedingungsrahmen energisch und zielstrebig die Initiative zu ergreifen. Einige waren selbst noch Konkubinarier und zeigten wenig Neigung zu den höheren Weihen. Manche ließen sich durch die Furcht vor innerkirchlichen Widerständen oder vor Konflikten mit weltlichen Fürsten abschrecken, andere verfolgten vorrangig politische, finanzielle oder dynastische Interessen, konzentrierten sich, theologisch unzulänglich gebildet, auf die politischen Probleme ihres Hochstiftes oder waren durch die geistlich-weltliche Doppelfunktion ihres Amtes persönlich, oft genug auch wegen Krankheit und Alter überfordert. Deshalb wurden nicht selten angelaufene Reforminitiativen unterbrochen und um ihre Wirkung gebracht. Im Übrigen war die Intensität der Reformbemühungen durchgehend stark abhängig vom persönlichen Einsatz und Engagement einzelner Bischöfe und sonstiger prominenter Amtsträger. Mittel- und langfristige Erfolge konnten sich nur einstellen, wenn sich Nachfolger fanden, die die bruchlose Kontinuität der Reformarbeit verbürgten. Die gegebenen strukturellen und personalen Verhältnisse machen verständlich, dass es eine jahrzehntelange Inkubationsphase brauchte, in der die katholische Reform, d. h. der Prozess der allmählichen Umorientierung und Umerziehung nach Maßgabe neuer Leitlinien, schrittweise in Gang gebracht werden konnte, um gegen Jahrhundertende, mancherorts erst im frühen 17. Jahrhundert, mit dem erklärten Ziel der Katholisierung der Gesellschaft zum Durchbruch zu kommen.
Die allgemeine Verspätung der katholischen Konfessionalisierung in den deutschen Hochstiften hing nicht zuletzt auch damit zusammen, dass man zunächst, d. h. in einer ersten Phase vor allem der Beseitigung eklatanter Missstände Priorität einräumte und nur selektiv und punktuell Reformen in Angriff nahm. Der Impuls, der von der kaiserlichen Formula reformationis ausgegangen war, verpuffte, von Ausnahmen abgesehen, nach wenigen Jahren weitgehend. Die damals veranstalteten Visitationen bestätigten die Entwicklung der ersten Jahrhunderthälfte, die außerhalb der noch altgläubigen weltlichen Territorien die Wirkungsmöglichkeiten der Ordinarien auf ihr Hochstiftsgebiet beschränkt hatte. Damit war ein neues Stadium der bereits im Spätmittelalter einsetzenden Territorialisierung des Kirchenwesens erreicht, die in der Folgezeit zu vielfältiger Variation der Reformansätze führte. Das lange bevorzugte selektive Verfahren bei der Umsetzung der Trienter Beschlüsse verstärkte diesen Trend, der sich schon daran ablesen lässt, dass die Konzilsdekrete in ihrer Gesamtheit erst sehr spät oder gar nicht in das Diözesanrecht übernommen und in sehr verschiedenem Umfang und auf ganz unterschiedlichen Wegen publik gemacht wurden. Auch der Umstand, dass das Konzil nur in sehr beschränktem Maße neues Recht gesetzt hatte, ließ einen erheblichen Gestaltungsspielraum im Umgang mit überkommenen Strukturen. Zugleich blieb genügend Raum, um auf tradierten Privilegien zu insistieren und diese gegen Neuregelungen juristisch auszuspielen.116
Auch in anderen Punkten hing das konkrete Reformprofil von der nachkonziliaren Entwicklung ab. So hatte das Konzil zwar die Qualifikation für das Bischofsamt definiert, auch die Erwartung kontinuierlicher, dauerhafter Reformbemühungen deutlich gemacht und die pastorale Verantwortung betont, auch die episkopale Jurisdiktion erheblich gestärkt, aber es hatte sich ansonsten auf einen moralischen Tugendkatalog beschränkt und darauf verzichtet, die Aufgaben der Bischöfe konkret zu benennen. Erst in der innerkirchlichen Diskussion der Folgezeit, nicht zuletzt unter dem Eindruck herausragender Vorbilder wie des Mailänder Erzbischofs Carlo Borromeo entfaltete sich das Ideal des Seelsorgebischofs, der die biblische Maxime vom guten Hirten verwirklichen sollte.117 Allerdings gab es auch Bischöfe, die entgegen den tridentinischen Vorschriften die höheren Weihen nicht empfangen hatten, auch gegen das Kumulationsverbot verstießen und sich wie Erzbischof Ferdinand von Köln und die Erzherzöge Leopold und Leopold Wilhelm dennoch nachdrücklich und mit Erfolg für die Reform einsetzten. Umgekehrt konnte ein Seelsorgebischof wie Martin von Schaumberg in Eichstätt es versäumen, Synoden zu veranstalten und Visitationen durchzuführen. Im Übrigen oblag es durchweg dem sekundären Führungspersonal, den Generalvikaren, Weihbischöfen und Offizialen, den kontinuierlichen Fortgang der Reform im Rahmen der Bistumsverwaltung sicherzustellen. Auf diese Weise ließen sich die Schwächen des Reichskirchensystems, dessen Auswahlverfahren keine verlässliche Gewähr für die geistliche Qualifikation der adligen Fürstbischöfe bot, im Interesse an der Reform kompensieren.
In der Übergangszeit bis ins letzte Viertel des 16. Jahrhunderts stand der Episkopat vor allem vor der Aufgabe, den Pfarrklerus, der auf das Konkubinat verzichten, dem Trunk und Spiel entsagen und sich geziemend kleiden sollte, und die Amtsträger in diözesanen Führungspositionen, besonders die Archidiakone durch entsprechende Weisungen und Mandate zu disziplinieren und die konfessionelle Uniformität herzustellen, also evangelische Prediger zu verdrängen, die verbreiteten religiösen Mischformen zu beseitigen und das Konfessionsbewusstsein durch die Einführung der Professio fidei zu schärfen, die „Communio sub una“ und den Empfang der Ostersakramente – mit oder ohne Strafandrohung – durchzusetzen, den Besuch protestantischer Bildungseinrichtungen zu verhindern etc. Zugleich lassen sich erste Versuche beobachten, das kirchliche Leben durch Feiertags- und Fastenordnungen, durch Religions- und Sittenmandate, durch die Einschärfung von Synodalstatuten, durch die Förderung der Katechese, durch pastorale Sendschreiben und Instruktionen, durch die wiederholte Publikation des tridentinischen Ehedekretes in einem positivem Sinn zu beeinflussen. Hinzu kamen der zügig voranschreitende Einsatz der Jesuiten als Lehrer, Katecheten, Prediger etc. und – häufig im Zusammenhang damit – erste Maßnahmen zur Hebung des Bildungswesens, vorrangig auf der Ebene der Universitäten und der Lateinschulen, denen nach dem „reformatorischen Schock“ nunmehr besonderes Augenmerk galt, weil auch unabhängig vom Konzil das bestehende Bildungsdefizit als gefährlichste Schwachstelle der alten Kirche erkannt worden war. Diese ersten Ansätze, die sich durchweg nicht auf brachiale Gewalt stützten, blieben aufs Ganze kurzfristig ohne die intendierte Wirkung, jedenfalls führten sie noch keinen tiefgreifenden Wandel herbei. Sie waren in der Regel nicht Teil eines systematisch konzipierten Programms, sondern erschöpften sich häufig in Einzelmaßnahmen, deren Durchführung nicht konsequent überwacht wurde und die nach einer ersten Initiative oft nicht beharrlich genug weiterverfolgt wurden. Dies erklärt sich keineswegs hauptsächlich aus Nachlässigkeit oder Desinteresse. Vielmehr lässt sich zeigen, dass die Beschränkung auf punktuelle Schritte, der Verzicht auf eine Religionspolitik der polarisierenden Konfrontation und die Konzentration auf unter den gegebenen Umständen erreichbare Ziele als Komponenten einer Strategie zu verstehen sind, die darauf angelegt war, die Reformaktivität an die soziopolitischen Strukturen, Abhängigkeiten und tradierten Ansprüche, die den Operationsraum der Religionspolitik in einem Hochstift prägten und begrenzten, pragmatisch und doch zugleich zielbewusst anzupassen.118 Diese Politik vollzog zwar noch nicht den definitiven Übergang zur Konfessionalisierung im Vollsinne, sie konnte aber Grundlagen schaffen, auf denen die folgende Phase aufbauen konnte. Eine solche Bilanz ergibt sich möglicherweise nicht für alle Hochstifte in der gleichen Eindeutigkeit, sie bezeichnet aber offenbar den Gesamttrend der Inkubationsphase, der in manchen Punkten die Dinge in Bewegung brachte, tradierte, verfestigte Gegebenheiten in Frage stellte, die Notwendigkeit von Veränderungen signalisierte und mögliche Lösungswege aufzeigte. Er war das Ergebnis einer Politik, die überwiegend noch patriarchalisch in der kirchlichen und profanen Fürsorgepflicht der Obrigkeit motiviert war, ohne offene Gewalt mit wohlmeinenden Mandaten und religiöser Unterweisung auszukommen suchte und in obrigkeitlicher Verantwortung Kirchenreform auch als komplementär zur guten Polizei begriff.119 Der dabei praktizierte Führungsstil setzte, wenn es um die Durchführung von Verordnungen ging, noch ganz selbstverständlich auf die eingeübten Formen des Aushandelns, die im Einzelfall Flexibilität erlaubten und Spielraum ließen für die kalkulierte Berücksichtigung gegenläufiger Interessen im Kompromiss. Die daraus resultierende pragmatische Nachsicht milderte den verbal rigorosen Anspruch der vielfach erlassenen Religionsmandate in der lebensweltlichen Praxis.
Dieser Politikstil wandelte sich grundlegend, wenn im Generationswechsel – vor allem um 1600 – Protagonisten einer umfassenden kirchlichen Erneuerung mit weitgespannten Erwartungen, etwa Absolventen des Collegium Germanicum oder der von Jesuiten im Reich geführten Bildungseinrichtungen, maßgeblichen Einfluss auf die kirchliche bzw. politische Führung gewannen und, einem anspruchsvollen religiösen Sendungsbewusstsein verpflichtet, eine rationale Optimierung der Reformanstrengungen anstrebten, die die bestehenden Verhältnisse insgesamt zur Disposition stellte, entschiedene Interventionen in traditionale Besitzstände verlangte, jede hinderliche Mitsprache ausschloss und die Möglichkeiten des juristischen Arsenals voll ausschöpfte.120 Die Erfüllung der dekretierten religiösen Anforderungen verstand sich in dieser Sicht als Ausdruck des Gehorsams, den die Untertanen der weltlichen Obrigkeit, die auch für ihr Seelenheil Verantwortung trug, schuldeten. Deshalb bestanden kaum Bedenken, verstärkt und systematisch auch den weltlichen Beamtenapparat und dessen Machtmittel einzusetzen und mit Drohungen und Strafen massiven Druck auf die Gewissen Andersgläubiger auszuüben, um die fürstbischöfliche Autorität im Vollsinne durchzusetzen. Der Widerstand, der sich gegen dieses neue religionspolitische Muster formierte und der in den betroffenen Städten mit dem religiösen Dissens meist auch gegen die landesherrliche Administration gerichtete kommunale Interessen verband, galt dann als politischer Ungehorsam oder Rebellion und konnte unter Aufbietung der verfügbaren, freilich meist begrenzten weltlichen Machtmittel entsprechend geahndet werden.121 Doch blieben in den Hochstiften, anders als etwa in den österreichischen Erblanden, spektakuläre, militärisch abgestützte Aktionen eher die Ausnahme. Die beharrlichen Bestrebungen zur Rekatholisierung der Stadtmagistrate trafen zwar auf eine zählebige Resistenz, die die bisherige, auskömmliche bikonfessionelle Koexistenz zu schützen suchte. Aber auf Dauer zeitigte der zielstrebige Druck in der Regel doch den gewünschten Erfolg. Gleiches gilt für den ohnehin schwächer ausgeprägten Widerstand auf dem Land, wo das hartnäckige Insistieren auf der Alternative Konversion oder Emigration, wenn auch mitunter erst nach Jahrzehnten, zur Erosion der evangelischen Gemeinden führte.122 Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass der Übergang zur offensiven Konfessionalisierung, die in Kirchenordnungen, Synodalstatuten und Mandaten ein klar definiertes Regelwerk verbindlich vorgab und mit dem Postulat der Rechtgläubigkeit des gesamten Untertanenverbandes bzw. der konfessionellen Uniformität des Territoriums Ernst machte, sich in den Hochstiften mit großen Phasenverschiebungen vollzog, die Inkubationszeit der Reform also aufgrund interner Konstellationen und jeweils besonderer Gegebenheiten unterschiedlich lang andauerte. Im Allgemeinen wird man in der habituellen und intellektuellen Regeneration der kirchlichen Führungsschicht einen entscheidenden Faktor sehen dürfen, der in enger Kooperation mit Rom und den päpstlichen Nuntien, mit benachbarten katholischen Landesherrn und vor allem mit den Reformorden den beschriebenen Strategiewechsel ermöglichte. Dabei spielten die Effektivität des neuen, konfessionalisierten Bildungswesens und die Systematisierung der Kontrolle eine entscheidende Rolle.
Als die ersten Fürstbischöfe sich daran machten, zur Förderung der katholischen Reform ihre obrigkeitlichen Rechte systematisch und in zielbewusster Koordination verschiedener Maßnahmen wahrzunehmen, konnten sie sich das bayerische Modell zum Beispiel nehmen, das als Ergebnis landesherrlicher Initiative, die sich nicht auf genuin geistliche Rechte, allenfalls auf einige einschlägige päpstliche Privilegien stützen konnte, von vorneherein in der Hauptsache auf den Einsatz weltlicher Machtmittel angewiesen war, allerdings vergleichsweise früh auch der Bedeutung des Bildungswesens für die kirchliche Erneuerung Rechnung zu tragen suchte. Mit der Durchführung einer allgemeinen Landesvisitation,123 dem Ausbau der Jesuitenkollegien in Ingolstadt und München, mit seinen Bemühungen um die Gründung eines Priesterseminars, mit der Sicherung der konfessionellen Homogenität des Landes durch die Überwindung der Kelchbewegung, durch die Ausschaltung des evangelischen Adels, durch die konfessionell restriktive Regulierung der Mobilität seiner Untertanen und die Durchsetzung der Professio fidei im Rahmen seiner Kooperation mit den Nuntien Portia und Ninguarda und mit der Gründung des 1570 auf Dauer eingerichteten Geistlichen Rates, der unter anderem Pfarrklerus und Lehrerschaft zu kontrollieren hatte, hatte Herzog Albrecht V. tragfähige Grundlagen für die Entfaltung der katholischen Reform gelegt. Zugleich hatte er unter Berufung auf seine die kirchlichen Verhältnisse einschließende ordnungspolitische Verantwortung der weltlich-staatlichen Obrigkeit einen maßgeblichen Einfluss und weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten im kirchlichen Raum gesichert, die unter seinem Sohn 1583 im Konkordat mit den für Bayern zuständigen, in die Defensive gedrängten Bischöfen der Salzburger Kirchenprovinz im Wesentlichen festgeschrieben werden konnten. Diese territorialkirchliche Tendenz kam dann unter Maximilian I. während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts voll zum Tragen.
In ähnlicher Weise bauten auch Erzherzog Ferdinand und seine Nachfolger in Tirol und den österreichischen Vorlanden, nicht zuletzt im Interesse an der religiösen Einheit als Basis politischer Stabilität, durch vielfältige Religionsmandate, durch die Berufung der Jesuiten nach Innsbruck, durch die Reform des Schulwesens, durch eine wachsame konfessionelle Kontrolle und durch die Förderung barocker Frömmigkeitsformen die landesherrliche Kirchenhoheit zielstrebig aus. Auch hier blieben Spannungen mit den Bischöfen, die sich zudem vor der offenkundig angestrebten Mediatisierung ihrer Hochstifte hüten mussten, nicht aus, so dass Reforminitiativen vorübergehend auch blockiert wurden.124 Anders verlief die Entwicklung in den österreichischen Erblanden, weil Ferdinand I. und Maximilian II. die Hoffnung auf die kirchliche Reunion nicht aufgeben mochten und weil zudem die Türkengefahr zu religionspolitischen Zugeständnisse gegenüber den evangelisch gesinnten Landständen zwang. Es blieb zunächst im Wesentlichen dabei, die staatskirchlichen Rechtsansprüche gegenüber dem Episkopat zu verteidigen und durch die Einrichtung des Klosterrates (1568) abzusichern, der in der Folgezeit manche bischöfliche Reformaktivität durch seine Entscheidungen störte, freilich auch partielle Reformen initiierte. In den Anfängen der katholischen Reform in Niederösterreich fiel die Hauptlast dem Passauer Offizial Melchior Klesl zu, der, gestützt auf die Pastoralinstruktion seines Bischofs, mit einer Mischung von Glaubensverkündigung und geistlichen Sanktionen die Rekatholisierung des Pfarrklerus und der kommunalen Magistrate betrieb und zunächst nur bei den Wiener Jesuiten und einzelnen Vertretern der politischen Elite Unterstützung fand. In Innerösterreich setzte Erzherzog Karl seit 1573 auf die Jesuiten und seit 1580 auf die Kooperation mit dem päpstlichen Nuntius in Graz. Sein Sohn Ferdinand forcierte dann in unerschütterlicher Glaubensüberzeugung und mit unerbittlicher Konsequenz die obrigkeitliche Rekatholisierungspolitik, indem er sie militärisch absicherte, die protestantischen Prediger vertreiben und evangelische Bücher verbrennen ließ, strenge Reformordnungen verpflichtend machte und die Bevölkerung, 1528 dann auch den Adel vor die Wahl stellte, zu konvertieren oder das Land zu verlassen. In Oberösterreich nutzte die Regierung den dortigen Bauernaufstand (1595 – 1597), um in ähnlicher Weise gegen den verbreiteten Protestantismus vorzugehen. Allerdings konnte wie in Niederösterreich auch hier die Phase der aggressiven Gegenreformation, die Tausende in die Emigration trieb, erst unter Ferdinand II. auf dem Höhepunkt seiner Macht in den späten zwanziger Jahren zu einem äußerlichen Abschluss gebracht werden.125
Auch in Jülich-Berg, wo die vermittelnde, erasmisch geprägte Religionspolitik Herzog Wilhelms V. lange nachwirkte, die traditionellen territorialkirchlichen Ambitionen die Beziehungen zu den Kölner Erzbischöfen belasteten und erst Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm in seinem Erbteil die Rekatholisierung offensiv vorantrieb, und in Baden-Baden setzte die aggressive Rekatholisierungspolitik weltlicher Obrigkeiten erst relativ spät ein. Zwar kooperierte man dabei mit den Reformorden und/oder den päpstlichen Nuntien, konnte sich gegebenenfalls auch auf kirchenpolitische Privilegien berufen, aber ausschlaggebend war zunächst einmal die Entschlossenheit der Fürsten, nach dem Vorbild Bayerns auf ihre weltlichen Machtmittel und die Autorität des frühmodernen Staates zu bauen, um in alle möglichen kirchlichen und religiösen Belange mit territorialkirchlichem Ordnungsanspruch hineinzuregieren und die Befolgung der von ihnen erlassenen Verordnungen und Dekrete erfolgreich kontrollieren zu können. Der Erfolg der Konfessionalisierung lag damit zu einem erheblichen Teil in der Verantwortung des weltlichen Beamtenapparates, der den notwendigen autoritären Druck zu gewährleisten hatte, um Verhalten und Religiosität der Untertanen im gewünschten konfessionellen Sinne einheitlich zu regulieren. Diese Politik, die auch offene Gewaltanwendung nicht ausschloss, bezog ihre Legitimation aus dem zeitgenössischen Herrschaftsverständnis, das die weltliche Obrigkeit verpflichtete, durch konfessionelle Uniformität die politische Stabilität des Gemeinwesens zu sichern und im Dienst am Gemeinwohl für die Rechtgläubigkeit des Untertanenverbandes Sorge zu tragen, um Gottes Zorn abzuwenden. Die Konfessionalisierung erschien so als verantwortungsbewusste Ordnungsstrategie, die auch Zwangsmaßnahmen (Ausweisungen, Verhaftungen, Konfiskationen etc.) gegen Andersgläubige rechtfertigte.
Im frühen 17. Jahrhundert befand sich grosso modo der katholische Konfessionsstaat in den Hochstiften und in einigen weltlichen Territorien im zügigen Ausbau bzw. wie in Bayern und im Fürstbistum Würzburg bereits im Stadium der Vollendung.126 Die dahin führende Entwicklung war allerdings in markanten Punkten nicht den in Trient vorgezeichneten Bahnen gefolgt. Im Interesse an der Konsolidierung des Katholizismus im Reich hatte die Kurie in Kauf nehmen müssen, dass das Bestreben führender Dynastien, vor allem der Wittelsbacher, später auch der Habsburger, nachgeborenen Söhnen eine standesgemäße fürstliche Stellung in der Reichskirche zu verschaffen, immer wieder Dispense und Sonderregelungen notwendig machte, die dem tridentinischen Kumulationsverbot widersprachen. Auch in den Domkapiteln blieb der Besitz mehrerer Pfründen üblich. Allerdings verschlossen sich die Kapitulare nicht grundsätzlich den Anliegen der katholischen Reform. Sie zeigten zwar gemeinhin von sich aus wenig Neigung zur Selbstreform, was ihre Lebensführung und die Erfüllung ihrer liturgischen Pflichten betraf, und überwanden erst in einem lang andauernden Wandlungsprozess ihren Hang zu religiöser Indifferenz, aber sie ließen sich in den meisten Hochstiften, wenn auch mitunter erst nach längerem, zähem Widerstand, durch die Professio fidei auf die Glaubensdekrete von Trient verpflichten. Sie beugten sich damit dem Zwang zur Konfessionalisierung, der aus der Präzisierung der katholischen Dogmatik resultierte. Dementsprechend gingen die Domkapitel in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts schrittweise dazu über, in den Wahlkapitulationen Maßnahmen zur Verbesserung der Seelsorge, zur Disziplinierung des niederen Klerus und zur Vereinheitlichung der Liturgie anzumahnen. Sie bevorzugten aber unter dem Einfluss des Späthumanismus und im politischen und wirtschaftlichen Interesse ihrer Hochstifte lange ein gemäßigtes Vorgehen gegen Andersgläubige, das vorrangig auf die Überzeugungskraft religiöser Unterweisung baute. Erst seit dem frühen 17. Jahrhundert tendierten auch die Domkapitel zu einer schärferen Gangart. Sie widersetzten sich allerdings in der Regel hartnäckig allen Reformforderungen, deren Realisierung sie, wie die Einrichtung eines Priesterseminars, finanziell belastete, sie stärker der bischöflichen Jurisdiktion unterwarf oder ihren Status als Mitregent des Hochstiftes zu untergraben drohte. Nach ihrem Selbstverständnis fungierten die Domkapitel neben den Fürstbischöfen vornehmlich als Garanten der Integrität, der Stabilität und der Prosperität ihrer Hochstifte und als Treuhänder der Interessen des Adels, der ihnen und dem Stift verbunden war. Die Reform durfte durch die einseitige Stärkung der bischöflichen Gewalt und des römischen Einflusses das System der überkommenen Privilegien und der traditionalen Bindungen nicht gefährden. Diese zäh verteidigte Maxime wirkte als wehrhafte Schranke, die die Entfaltung der tridentinischen Impulse abschwächte, verzögerte und kanalisierte.127
Auch in anderer Hinsicht fanden die Intentionen der Konzilsväter im Reich keine ungebrochene Resonanz. So wurde etwa die Vorschrift, auf regelmäßigen Provinzial- und Diözesansynoden die Trienter Dekrete zu publizieren und zur Anerkennung zu bringen, die überfällige Reform in Gang zu setzen und später ihre weitere Entwicklung kontinuierlich zu überwachen, nur ansatzweise und in verschiedener Form verwirklicht. Nur der Erzbischof von Salzburg berief 1569, 1573 und 1576 Provinzialsynoden ein, die unter dem Einfluss des päpstlichen Kommissars Felician Ninguarda das Tridentinum rezipierten und deren Beschlüsse die Grundlage für die Reformen in den Suffraganbistümern des Erzstiftes abgaben.128 In den meisten Bistümern wurden nur sporadisch Diözesansynoden veranstaltet, auf denen in der Regel nur Teile der Trienter Reformdekrete mit unterschiedlicher Folgewirkung publiziert wurden. Wo lange keine Synode mehr stattfand, behalf man sich mit dem wiederholten Neudruck der letzten Synodalstatuten. Nur in wenigen Bistümern wurde seit dem frühen 17. Jahrhundert die Reform verstärkt durch Synoden getragen. In manchen Hochstiften blieb das Synodalwesen für die Reform gänzlich bedeutungslos. So wurde die Reform vorwiegend nach anderen Konzepten, d. h. vor allem unter Einsatz bzw. Mitwirkung der territorialstaatlichen Administration und in vielfach eigenständiger, „untridentinischer“ Weise vorangebracht.129
Eine Alternative bot sich zunächst in der Möglichkeit, aufgrund bischöflicher Amtsgewalt durch Mandate einzelne Reformen anzuordnen oder in einer regelrechten Kirchenordnung ein umfassendes Reformkonzept programmatisch zusammenzufassen und verbindlich zu machen. Dieses Verfahren bedurfte freilich, um eine dauerhafte Wirkung entfalten zu können, einer effektiven institutionellen Absicherung. Diese Funktion konnte wie im bayerischen Modell ein besonderes Regierungsorgan übernehmen, der Geistliche Rat oder Kirchenrat, der einschlägige Reformmaßnahmen zu planen, zu koordinieren und zu überwachen hatte und dem die Leitung der kirchlichen Verwaltung übertragen war. In den Hochstiften konnte dieses Aufgabengebiet aber auch in die Verantwortung der Generalvikare in Zusammenarbeit mit den Weihbischöfen und Offizialen als geistlichen Beamten fallen, die nicht bepfründet waren, sondern durch ein Gehalt versorgt wurden und gegenüber dem Bischof weisungsgebunden waren. In ihrem Amtsauftrag und in ihrem Amtsethos gewann – anders als im überkommenen Benefizialwesen – die Erfüllung der Dienstpflicht Priorität. In der Praxis der katholischen Konfessionalisierung erwiesen sich diese durchweg hoch qualifizierten Fachbeamten, besonders die Generalvikare und Weihbischöfe, auch wenn sie mancherorts Domkapitulare sein mussten, als eine leistungsfähige, von den weltlichen Hochstiftsbeamten unterstützte Funktionselite zur Durchsetzung der Reform in bischöflicher Regie. Ihre im Vergleich zu ihren spätmittelalterlichen Amtsvorgängern erheblich erweiterten Kompetenzen setzten sie in Stand, potentielle Gegenkräfte, z. B. Archidiakone, widerspenstige Patronatsherrn, Inhaber spezieller Privilegien wirksam auszuschalten bzw. zu neutralisieren. Ihr Einsatz ermöglichte die Zentralisierung und Bürokratisierung der kirchlichen Führung und Entscheidungsgewalt im bischöflichen Ordinariat und bot damit eine attraktive Alternative zur Synode als Instrument geistlicher Leitung.130 Sie trugen erheblich dazu bei, dass seit der Mitte des 17. Jahrhunderts vornehmlich der Episkopat als Träger der Reform fungierte und die Konkurrenz katholischer weltlicher Obrigkeiten eindämmen konnte.
Ein durchschlagender Erfolg der katholischen Reform setzte wirksame Kontrollen voraus. Die Konzilsväter hatten deshalb die Durchführung jährlicher, jedenfalls regelmäßiger Visitationen empfohlen. In den ersten Jahrzehnten nach dem Konzil beschränkte sich die Visitationstätigkeit durchweg auf einmalige, allenfalls in großem zeitlichem Abstand wiederholte Aktionen, die vor allem als Bestandsaufnahmen fungierten und Aufschluss geben sollten über den konfessionellen Entwicklungsstand und die Verbreitung von Missständen im Klerus und in den Gemeinden. Erst seit der Jahrhundertwende lässt sich eine Intensivierung der Recherchen in dichterer Folge beobachten, die sich nun stärker auf solche Fragen konzentrierten, die für die Gestaltung des kirchlichen Lebens im katholischen Sinne bedeutsam waren. Offenbar bestand der Eindruck, dass der katholische Konfessionsstand konsolidiert sei und nunmehr kultisch und pastoral ausgebaut und mit dem Ziel fortschreitender Spiritualisierung weiterentwickelt werden müsse.131 Dabei konnten die Visitationen sehr unterschiedlich organisiert sein. Neben der Generalvisitation, die alle Pfarreien aufsuchte, gab es die Option, stationsweise zu visitieren, d. h. die Pfarrer und Vertreter mehrerer Pfarreien an einen bestimmten Ort zu berufen, oder die Befragung an einem zentralen kirchlichen Amtssitz durchzuführen.132 In den Diözesen, in denen die Dekanatsverfassung wieder funktionsfähig gemacht wurde, übertrug man den Dekanen die Aufgabe kontinuierlicher Kontrolle in ihren Amtsbezirken.133 Gelegentlich wurden mit ähnlichen Aufträgen geistliche Kommissare als Beauftragte des Generalvikars eingesetzt. Darüber hinaus konnten auch die Sendgerichte, wo sie noch im Brauch waren, durch ihre Sittenzucht über Kleriker und Volk als Organe der Disziplinierung fungieren, die die alltägliche Lebenspraxis ins Visier nahmen. Auch weltliche Beamte wurden regelmäßig in das kirchliche System der Kontrolle eingeschaltet. Aufs Ganze lässt sich seit dem frühen 17. Jahrhundert im Visitationswesen eine fortschreitende Bürokratisierung beobachten, die mit der Einführung der Pfarrregister und der Beichtzettel auch die Ebene der Pfarreien erfasste und die für die Intensivierung der Reform und für die Ausformung der Konfessionskirche wohl unerlässlich war, auch wenn sie nicht ohne weiteres sicherstellen konnte, dass die Visitationsrezesse, die die Behebung der festgestellten Mängel verfügten, auch tatsächlich befolgt wurden.134 Dieses Defizit erklärt sich wohl kaum allein aus der notorischen Schwäche der geistlichen Hochstifte in der staatlichen Exekutive. Zu fragen ist auch nach der Reformbereitschaft und -fähigkeit des Pfarrklerus und der Gemeinden.
Nach wie vor war die Lebenswelt vor allem des ländlichen Klerus durch die diversen Implikationen seiner agrarischen Bepfründung nachhaltig geprägt. Noch immer war das vorreformatorische benefiziale Denken vorherrschend und die Vorstellung von einer Vertragspartnerschaft zwischen Pfarrer und Gemeinde lebendig.135 Beide Varianten im Verständnis des priesterlichen Amtes waren einer mittelalterlich geprägten, rechtlichen Denkweise verpflichtet, die in der Verteidigung traditionaler, „wohlerworbener“ Rechte geschult war.136 Ihr stand das in Trient entworfene, theologisch begründete Priesterideal diametral entgegen, das die Priorität der pastoralen Pflichten in Sakramentenspendung, Liturgie und Predigt betonte und die besondere, sakramentale Bedeutung der Weihe klarstellte, tiefe persönliche Frömmigkeit, vorbildliche Selbstdisziplin und asketisch-abstinente Lebensführung verlangte, die Verantwortung für die religiöse Praxis und die Sittlichkeit der Gläubigen mit einschloss und einen neuen charismatischen Habitus einforderte, der den Pfarrer aus seiner profanen sozialen Umgebung als Repräsentanten und Diener des Heiligen heraushob, um sein Sozialprestige und seine Autorität als Hirte der ihm anvertrauten Seelen zu stärken und so die bereitwillige Rezeption der propagierten Normen in der Gemeinde zu fördern. Zudem wurden ein ehrfürchtiger, glaubwürdiger Vollzug der Kulthandlungen und eine Lebensführung erwartet, die der postulierten Würde des Amtes entsprach.137 Die Erfüllung dieses Anforderungsprofils, das auch eine korrekte kirchliche Verwaltung umfasste, setzte eine entsprechende Optimierung der klerikalen Qualifikation voraus. Die Ausbildung der künftigen Priester, die unter den Bedingungen der konfessionellen Konkurrenz ein erheblich höheres intellektuelles Niveau als früher anstreben und zugleich eine grundlegende Umerziehung leisten musste, nicht zuletzt was die geforderte asketische Lebensweise anging, wurde damit zu einem Angelpunkt der Reform. Man hat dies in Trient und auf späteren Synoden durchaus klar erkannt, versäumte aber, ein genaues Studienprogramm auszuarbeiten und verbindlich zu machen. Es blieb also ein erheblicher Gestaltungsraum. Es ist bekanntlich nicht gelungen, umgehend, wie vom Konzil vorgesehen, ein flächendeckendes Netz von Knabenkonvikten aufzubauen, die zur Priesterausbildung hinführen sollten. Die dazu geplante Seminarabgabe, das sogenannte Seminaristicum, ließ sich gegen den Widerstand der meisten Domkapitel, auch des niederen Klerus nicht durchsetzen. Manche gelungenen Gründungen waren wegen zu geringer Stiftungsfonds langfristig nicht lebensfähig.138 Den Beitrag der übrigen zur Behebung des seit Mitte des 16. Jahrhunderts allenthalben akuten Priestermangels, der auf Jahrzehnte hinaus gegenüber dem amtierenden Pfarrklerus zur Nachsicht und zu erheblichen Abstrichen vom tridentinischen Ideal zwang, wird man nicht überschätzen dürfen. Es handelte sich meist um kleine, mitunter auf bischöfliche Kosten finanzierte Anstalten mit nur wenigen jährlichen Absolventen.139 Im Übrigen scheint es zumindest auf dem Land noch lange üblich gewesen zu sein, dass künftige Priester die erforderlichen Kenntnisse bei einem amtierenden Pfarrer erwarben. Dass auf diesem Wege der in der pastoralen Literatur, in Synodalstatuten und in bischöflichen Dienstanweisungen formulierte, weit anspruchsvollere Bildungskanon, den die Reformer als neuen Standard und Maßstab definierten, nur bruchstückhaft und unzulänglich vermittelt werden konnte, wird nicht überraschen, zumal die Effektivität des Prüfungswesens, die das Konzil gewährleistet sehen wollte, allenthalben noch lange zu wünschen übrig ließ. Zudem behinderte das Institut des Patronatsrechtes nach wie vor eine reformorientierte bischöfliche Personalpolitik.140 Unter diesen Umständen erwies sich die Verschärfung der Weihevorschriften als ein nur notdürftiger Behelf. In der Einsicht in die Notwendigkeit, die religiöse Bildung im Klerus und bei den Laien zu heben, setzte die katholische Konfessionalisierung nach dem erfolgreichen protestantischen Vorbild verstärkt auf den Buchdruck. Der Catechismus Romanus, die Katechismen des Jesuiten Canisius und neue Agenden dienten der Vereinheitlichung der Lehre und der kultischen Praxis. Neue Breviere, pastorale Anleitungen, homiletische Literatur, sonstige Handreichungen für die Pfarrer und katholische Erbauungsschriften sollten helfen, die Seelsorge und das religiöse Leben im Geiste der Reform zu spiritualisieren. Der römische Index und eine systematischere und strengere Zensur setzten die Maßstäbe einer rechtgläubigen Lektüre und förderten die konfessionelle Abgrenzung. Richtungweisende Bedeutung aber kam den Bildungseinrichtungen der Jesuiten zu, ihren Gymnasien und Kollegien, die durch ein eigens eingerichtetes theologisches Lektorat oder einen an die reguläre Schulzeit anschließenden theologisch-philosophischen Aufbaukurs zumindest die Grundlagen der katholischen Theologie, Dogmatik, Pastoral und Ethik vermittelten. Bei weitem nicht alle Priesterkandidaten absolvierten um 1600 danach noch ein reguläres Theologiestudium an einer Universität unter jesuitischer Leitung. Auch die erste Generation des Pfarrklerus, der durch eine bessere Ausbildung von der Reform erfasst wurde, genügte noch nicht den neuen Anforderungen in vorbildlicher Weise. Noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts konstatierten Visitatoren bemerkenswerte Defizite in der Amts- und Lebensführung mancher Pfarrer, zugleich aber auch deutliche Fortschritte der Reform.141 Dieses ambivalente Bild variierte in einzelnen Aspekten von Region zu Region, von Diözese zu Diözese, je nachdem, wann und in welchem Maße die Bündelung der Reformen, die Verschärfung der disziplinierenden Kontrolle und die Optimierung der geistlichen Unterweisung und Ausbildung, die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und die Entwicklung des Prüfungswesens auf breiter Front wirksam wurden. Generell wird man wohl nur sagen können, dass der Formierungsprozess, der den Pfarrklerus disziplinieren und ihm seine pastorale Berufung nachhaltig bewusst machen sollte, im frühen 17. Jahrhundert zwar bereits in vollem Gang war, wenn auch erst ein sehr inhomogenes Stadium erreicht war, dass er aber nur allmählich und langfristig zur Verinnerlichung des neuen Amtsverständnisses und zu dem spirituellen Ideal, das den Reformern vorschwebte, hinzuführen vermochte. Im Zuge der skizzierten Entwicklung präzisierte sich jedenfalls seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, das noch Ausläufer des erasmischen Evangelismus, religiöse Mischformen und fließende Übergänge kannte, allmählich das Konfessionsbewusstsein des katholischen Pfarrklerus auf der Grundlage der Trienter Dogmatik,142 wurden die Fälle krassen Fehlverhaltens seltener und ging das offene, eheähnliche Konkubinat zurück. Zugleich gewann der Typ des loyalen, verantwortungsbewussten geistlichen Fachbeamten, der, selbstdiszipliniert, gut qualifiziert und wirtschaftlich angemessen versorgt, sich die Seelsorge und die pfarrliche Administration auf der Grundlage bischöflich-obrigkeitlicher Ordnungen und Anleitungen zur Lebensaufgabe machen sollte, in einer jahrzehntelangen Übergangsphase nach und nach konkretere Kontur.143
Allerdings verdankten sich die Ergebnisse und der Erfolg der katholischen Reform keineswegs ausschließlich der Diözesan- und Klerusreform. Vielmehr verdienen die Orden als potentielle Träger einer neuen katholischen Spiritualität und Multiplikatoren des Erneuerungselans besondere Beachtung. Das Konzil hatte sich nur zu den weiblichen Ordensgemeinschaften, was die Profess, die Klausur, die Sakramentspraxis, die Verwaltung des Klosterbesitzes und die bischöfliche Oberaufsicht betraf, konkreter geäußert. Ansonsten blieb es bei bloßen Rahmenrichtlinien.144 Die Festlegung konkreter Regelungen im Einzelnen fiel in die Verantwortung der Ordensgenerale bzw. der Ordenskapitel. Damit war ein erheblicher Spielraum für eine je ordensspezifische Entwicklung der monastischen Reform gegeben. Die Verlaufsformen und die Ergebnisse der Ordensreform orientierten sich denn auch nicht an einem im strengen Sinne „tridentinischen“ Muster.145 Vielmehr ergab sich eine bemerkenswerte Variation der Reformbestrebungen, die durch die jeweilige Ordensstruktur und -tradition, durch die territoriale Kirchenpolitik, durch die päpstliche Ordensgesetzgebung, durch besondere spirituelle Einflüsse und kontingente personale Konstellationen je verschieden reguliert bzw. geprägt wurden und sich nicht synchron entfalteten.
Die Reformbewegung des 15. Jahrhunderts hatte zwar fraglos beachtliche Erfolge vorweisen können, sie hatte aber, als sie von der reformatorischen Bewegung überrollt wurde, das Ziel einer grundlegenden, dauerhaft tragfähigen Erneuerung des Ordenswesens in allen seinen Zweigen noch längst nicht erreicht. Es gab noch Anlass genug für begründete Kritik an Klöstern und Religiosen. Diesen Rechtfertigungsdruck verstärkten die Reformatoren erheblich, indem sie den Sinn der klösterlichen Lebensform grundsätzlich in Frage stellten und damit das monastische Selbstverständnis und Pflichtbewusstsein untergruben. Damit und durch die zum Teil verheerenden Auswirkungen des Bauernkrieges war die Widerstandskraft der Orden offen herausgefordert.146 Dort, wo kein reformatorischer Einfluss unmittelbar wirksam wurde, konnten sich die meisten Klöster zwar halten, gerieten aber aus Mangel an Nachwuchs in eine schwere Krise,147 die weitere Verfallserscheinungen nach sich zog. Sie verbanden sich vielerorts mit einem existenzgefährdenden wirtschaftlichen Niedergang.148 Zwar gab es noch immer auch monastisch intakte Konvente, aber der anstehende Reformbedarf war augenfällig.149
Die bestehenden Defizite veranlassten seit den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts weltliche und geistliche Obrigkeiten zur Intervention, die tendenziell auf eine empfindliche Einschränkung der klösterlichen Autonomie hinauslief. Die weltlichen Fürsten setzten dabei die Praxis ihres vorreformatorischen Kirchenregimentes fort und bauten sie administrativ weiter aus.150 Die Bischöfe konnten sich auf ihre durch das Konzil erweiterten Kompetenzen berufen und zielstrebig ihre landesherrlich-geistliche Doppelkompetenz nutzen, um nicht nur ihren kirchlichen Führungsanspruch durchzusetzen, sondern auch ihre Landeshoheit über die Klöster zu festigen und auszubauen und im Fall der Prälatenabteien deren grund- und gerichtsherrlichen Einflussbereich in ihre Herrschaftsordnung zu integrieren. Schon um ihre Steuerkraft wiederherzustellen und auf Dauer zu sichern, legten weltliche und geistliche Fürsten großen Wert auf die Sanierung und Konsolidierung ihrer landsässigen Klöster. Allerdings scheuten sich katholische Regierungen auch nicht, heruntergekommene Klöster aufzuheben und ihren Besitz für die Zwecke der Reform, etwa zur Finanzierung einer Bildungseinrichtung, eines Jesuitenkollegs etc. zu verwenden und in den Dienst der Katholisierung und der angestrebten Optimierung der Seelsorge zu stellen.151 Auch von den fortbestehenden Konventen wurde erwartet, dass sie sich in den Prozess der Katholisierung der Gesellschaft einfügten, das obrigkeitliche Programm der religiös-kirchlichen Vereinheitlichung akzeptierten und sich dem „Prinzip des reformerischen Utilitarismus“ beugten, der ihnen neue Aufgaben in der Seelsorge, im Schulwesen, in der Bekehrung Andersgläubiger etc. zuwies, das Ideal der Weltabkehr nicht mehr vorbehaltlos als alleinige Legitimation ihrer Existenz gelten lassen mochte und dazu zwang, die Position der alten Orden in der vornehmlich auf die Seelsorge ausgerichteten nachtridentinischen Kirche neu zu definieren.152 Dies bedeutete zugleich, dass die Klöster in die „Territorialisierung alles Kirchlichen“153 mit einbezogen wurden, die das politisch-etatistische Interesse an herrschaftlicher Verdichtung und Stabilisierung mit den religiös-kirchlichen Reformintentionen verquickte.
Der Durchbruch der Reform, der sich seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert abzuzeichnen begann, gelang freilich erst dann, als die landesherrliche bzw. bischöfliche Initiative auf die Kooperationsbereitschaft fähiger Äbte traf, die sich – zum Teil unter dem Einfluss ordensinterner Reformforderungen – energisch für die monastische Erneuerung einsetzten und deren Ideal persönlich glaubwürdig verbürgten, und die jesuitische Inspiration von einer neuen, in den Instituten der Societas Jesu ausgebildeten Novizengeneration in die Konvente vermittelt wurde und das Reforminteresse in einem gewandelten monastischen Selbstverständnis verankerte.154 Hinzu kamen die ordensinternen Reformdiskussionen, die seit dem Konzil auf Provinzial- und Generalkapiteln geführt wurden und die Überarbeitung der Statuten beeinflussten,155 und vor allem die nunmehr häufigeren und systematischeren Visitationen und Kontrollen, die von den Ordenszentralen oder auf Provinzebene organisiert wurden und eine kontinuierliche Verstetigung der monastischen Erneuerung sicherstellen sollten.156 Darüber hinaus stützte die päpstliche Ordensgesetzgebung den Prozess der Regeneration, in dem auch ausländische Ordensbrüder – phasenweise in größerer Zahl, allerdings mit sehr unterschiedlichem Erfolg – eingesetzt wurden.157 Bedeutsam wurden auch ordensinterne Initiativen wie die bereits im frühen 16. Jahrhundert in Spanien einsetzenden Bemühungen um eine strengere Observanz, die im Franziskanerorden zur Ausformung der neuen, auch im Reich mit Erfolg eingesetzten Reformzweige der Rekollekten und der Reformaten führten.158 Beachtung verdient schließlich das gestärkte Verantwortungsbewusstsein der Provinziale, die ihrer Kontroll- und Aufsichtspflicht zuverlässiger nachkamen, und der Generale, die in ihren Hirtenbriefen immer wieder die konsequente Regeltreue einforderten.159 So ergab sich aus der Koinzidenz verschiedener Einflüsse und Faktoren ein effizienter Wirkungszusammenhang, der den Entwurf der monastischen Erneuerung auf die neuen Anforderungen ausrichtete. Zwar ist unverkennbar, dass sich die nachtridentinische Reformdebatte über weite Strecken an den Konzeptionen und Intentionen der spätmittelalterlichen Observanzbewegung orientierte,160 zugleich aber ist nicht zu übersehen, dass die Konvente trotz aller Vorbehalte und obrigkeitlich verordneter Disziplinierung und trotz aller Sorge um ihre innere Autonomie sich dem weltzugewandten Programm der Katholisierung der Gesellschaft nicht entziehen konnten.
Zunächst galt es freilich, die bereits spätmittelalterliche Forderung nach sorgfältiger Regeltreue zu erfüllen. Die benefizialen Strukturen wurden aufgelöst, das Armutsideal wurde wieder ernst genommen, das Privateigentum abgeschafft, die Vita communis samt ihren räumlichen Voraussetzungen wiederhergestellt und das Stillschweigen beobachtet. Chorgebet und Liturgie, die nach römischem Muster allmählich vereinheitlicht wurde, rückten ins Zentrum eines neuen monastischen Pflichtbewusstseins, das die Askese, die durch das Fasten-, Abstinenz- und Keuschheitsgebot gefordert war, wieder als heilsbedeutsamen Auftrag im Dienste Gottes verstand. Die Konvente lernten Distanz zu halten zu ihrer weltlichen Umgebung. Im Zuge der Reform wurden zudem die Disziplinargewalt und spirituelle Leitungsbefugnis des Abtes erheblich gestärkt, um durch regelmäßige klosterinterne Verhaltenskontrolle die Durchsetzung des neuen Anforderungsprofils zu sichern, die nach außen die Überzeugungskraft des durch die humanistische und die reformatorische Kritik diskreditierten monastischen Ideals rehabilitieren konnte.161 Besondere Aufmerksamkeit galt dem Noviziat, das auf die klösterliche Lebensweise gründlich vorbereiten sollte.162 Wenn etwa die Mendikanten nun regelmäßig Christenlehre und Katechese in ihren Kirchen anboten, sich um eine sorgfältigere Ausbildung ihrer Beichtväter und Prediger bemühten, häufig Sakramentsprozessionen veranstalteten, Sakramentsbruderschaften und sonstige Gebetsgemeinschaften gründeten, bei der alltäglichen Seelsorge aushalfen und vermehrt Pfarreien übernahmen, zu abendlichen Rosenkranzandachten und sonstigen Gebetsstunden einluden, die Tradition ihrer Marien- und Heiligenverehrung und ihrer Passionsfrömmigkeit intensivierten und karitative Aufgaben in der Krankenpflege, in der Armenfürsorge und in der Sterbebetreuung engagiert erfüllten,163 so entsprachen sie damit den Erwartungen, die, über die spätmittelalterliche Observanz hinausführend, eine erneuerte Pastoral zur Katholisierung der Gesellschaft postulierten. Dies schloss die missionarische Sendung zur Bekehrung Andersgläubiger mit ein.164 Dementsprechend wurde die Reorganisation der ordenseigenen Studien schwerpunktmäßig auf die Bedürfnisse der praktischen Seelsorge ausgerichtet.165 Der Prozess dieser Neuorientierung, „der konservativen Erneuerung“166, die zwar weiterhin die Heilsbedeutung der Vita contemplativa betonte und so dem monastischen Selbstbewusstsein inneren Halt gab, zugleich aber unter dem starken Einfluss der jesuitischen Inspiration neue, nach außen gerichtete Perspektiven der Bewährung eröffnete, vollzog sich bei den einzelnen Orden nicht ohne Verzögerungen, Vorbehalte, Schwankungen und Rückschläge, auch nicht ohne Konflikte etwa mit Bischöfen, die den in der Seelsorge tätigen Mönchen und ihrem Autonomiestreben misstrauten.167 Auch blieben die Konvente trotz zunächst erfolgreicher Reform stets latent anfällig für Fehlentwicklungen und Regelverstöße, wenn auch skandalträchtige Missstände kaum noch zu verzeichnen waren.168 Aber in der Gesamtbilanz lässt sich konstatieren, dass bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts die Regeneration des Ordenswesens in Deutschland, die alten Frauenorden mit eingeschlossen,169 im Wesentlichen gelungen war. Es mag sein, dass damit erst das Stadium einer „nebentridentinischen Lebensweise“170 erreicht war, aber immerhin war die Grundlage gelegt für den kräftigen Aufschwung, der nach der partiellen Destabilisierung durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges die Ordenslandschaft im Reich erfasste.
Eine besonders prominente Rolle spielten in der katholischen Reform die neuen Orden. Die Kapuziner etwa fanden nach der Gründung ihres Innsbrucker Konventes 1593 rasche Verbreitung in deutschen Städten und Territorien.171 Reformbewusste Obrigkeiten trauten den Kapuzinern zu, dass es ihnen gelang, ein katholisches Konfessionsbewusstsein zu wecken und lebendig zu erhalten und in zielstrebiger Überzeugungsarbeit – notfalls unter dem Schutz des obrigkeitlichen Drohpotentials – unter Andersgläubigen erfolgreich zu missionieren.172 In der Tat leisteten sie vor allem durch ihre Predigten, durch die Betreuung von Bruderschaften, durch die Förderung von Frömmigkeitsformen, die sich schwerpunktmäßig auf die Eucharistie, die Passion Christi und die Marienverehrung bezogen, durch ihr Engagement in der Katechese für Jugendliche und Erwachsene und durch ihre Tätigkeit als Beichtväter, wo es Not tat, auch in der regulären Pfarrseelsorge einen bedeutenden Beitrag zur Vermittlung der Normen des nachtridentinischen Katholizismus.173 Zudem gelang es ihnen offenbar langfristig, durch die Propagierung kirchlicher Sakramentalien die verbreiteten Praktiken der Alltagsmagie zurückzudrängen.174 Ihr pastoraler Erfolg erklärt sich zu einem erheblichen Teil auch aus der Überzeugungskraft ihres Armutsideals und ihrer Spiritualität, aus ihrer Aufgeschlossenheit für die alltäglichen Sorgen und Nöte der Gläubigen und aus ihrer karitativen Selbstlosigkeit in der Pflege Pest- und Seuchenkranker, in der Armenfürsorge, in der Betreuung Gefangener etc.175 Die Kapuziner unterhielten zwar keine eigenen Gymnasien und gründeten allenfalls einzelne Elementarschulen,176 sie erwiesen sich aber in vielfältiger Weise als effiziente Funktionsträger der Katholisierung, die mit einem vergleichsweise minimalen Aufwand – mitunter auch in der Diplomatie katholischer Herrscher177 – eingesetzt werden konnten.
Wie die Gründung des Kapuzinerordens hatte auch die Entstehung der Gesellschaft Jesu nichts mit dem Trienter Konzil zu tun. Ihre Anfänge lagen vielmehr in einer spirituellen Zelle, die unter der Leitung Ignatius’ von Loyola Gleichgesinnte im Engagement für eine erneuerte Seelsorge und für die Mission unter Nicht-Christen zusammenführte. Der 1540 von Papst Paul III. approbierte neue Orden unterschied sich vom überkommenen Mönchtum in einer Reihe markanter Punkte, die ihn als bewusste Neuschöpfung auswiesen. Er verzichtete etwa auf einen eigenen Habit, auf das klösterliche Stunden- und Chorgebet, auf besondere Vorschriften über Fasten und Bußen, auf regelmäßige (Schuld-)Kapitel, auf das Gebot des Stillschweigens, auf Tonsur und Klausur, auch auf die vor allem bei den Bettelmönchen häufige Übernahme höherer kirchlicher Würden, weil all dies für die Erfüllung der gewählten Aufgabe nicht notwendig bzw. eher hinderlich als förderlich schien.178 Diese Befreiung von Bindungen der monastischen Tradition erhöhte nicht nur die räumliche Mobilität der Ordensmitglieder, sondern sie erlaubte ihnen auch eine flexible Zeiteinteilung je nach den akuten Erfordernissen ihrer Tätigkeitsfelder. Ihre Arbeitskraft ließ sich so zielstrebig und rationell nach klaren Prioritäten und überterritorial organisieren. Dass dies strikt nach den Leitlinien ihres Ordens geschah, hatte ihr Pflichtbewusstsein sicherzustellen, das sich im konstruktiven Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu bewähren hatte.179
Mit ihrem vierten Gelübde versprachen die Jesuiten, jeder päpstlichen Entscheidung über ihren missionarischen, pastoralen und karitativen Einsatz widerspruchslos zu gehorchen.180 Damit und mit seiner straff zentralistischen Organisation, die dem General weitreichende Kompetenzen einräumte, richtete sich der Orden von Anfang an konsequent auf Rom als Steuerungszentrum aus. Die damit verbundene Überzeugung von der besonderen Nähe der römischen Kirche zu Christus verlieh dem Papsttum erhöhtes Gewicht und stärkte den von ihm intendierten Romzentralismus nachhaltig. Daraus resultierte ein beträchtliches Vereinheitlichungspotential, das unter aktiver Mitwirkung der Jesuiten etwa in der allmählichen, wenn auch nicht vollständigen Durchsetzung der römischen Liturgie, in der kirchenpolitischen Kooperation der Jesuiten mit den päpstlichen Nuntien, im Interesse an einer intensiven, reibungslosen Kommunikation zwischen der Kurie und der deutschen Kirche oder in der erfolgreichen Bemühung zur Entfaltung kam, Rom zum maßgeblichen Zentrum katholischer Intellektualität zu machen und dort Multiplikatoren zur Homogenisierung des Klerus auszubilden.181
Die pastorale Grundidee der Jesuiten, die im Übrigen theologisch für den Thomismus und die in Spanien erneuerte Scholastik optierten und ansonsten der praktischen Theologie große Bedeutung beimaßen, resultierte aus dem Postulat der Nachfolge Christi und seiner Jünger. Diese Christozentrik teilte Ignatius mit der Devotio moderna, die sein Denken auch in anderen Punkten stark beeinflusste. Dies gilt etwa für die Tendenz zur Individualisierung der Frömmigkeit, für die Parallele zum Stoizismus in der Forderung nach Selbsterkenntnis, Selbststeuerung und Selbstüberwindung des Menschen und für den Appell, die Lebensführung durch die vernünftige Kanalisierung der Affekte zu ordnen und damit Raum zu schaffen für die Erfüllung des göttlichen Willens, die die Erkenntnis Gottes und das Wissen um die eigene Leistungsfähigkeit voraussetzt.182 Aber während die Devotio moderna eine individualisierend-kontemplative Verinnerlichung der Religiosität bevorzugte, die kirchlichen Heilsmittel eher zurücktreten ließ und damit vorkonfessionell blieb, verknüpfte Ignatius die Orientierung am Leben Jesu mit einem Konzept der aktiven Pastoral, das die konfessionell geprägten Angebote der römischen Kirche konsequent integrierte, in den Methoden aber bemerkenswert offen und anpassungsfähig gehalten war. Dies erlaubte eine schichtspezifisch differenzierte Seelsorge, die den Gläubigen zur Selbstentsagung, zur regelmäßigen Gewissenserforschung und zur Selbstreform in häufiger Beichte anleitete und davon überzeugen sollte, dass eine christliche Existenz nur innerhalb der römischen Kirche möglich sei. Die Merkmale dieser Kirchlichkeit, deren Definition zunächst einmal das Glaubensgut auf der Basis der dogmatischen Beschlüsse des Trienter Konzils sichern sollte, ließen sich freilich unter den im Reich gegebenen Bedingungen leicht in Kategorien militanter Abgrenzung gegenüber Andersgläubigen ummünzen. Dies setzte allerdings erst ein, nachdem die Jesuiten nach ersten individuellen Kontakten in Köln, Wien, Ingolstadt und Dillingen Fuß gefasst hatten, das tatsächliche Ausmaß der reformatorischen Entwicklung zu überschauen begannen und sich gehalten fühlten, sich auf die zeitübliche scharfe konfessionelle Polemik einzulassen. Damit verband sich die feste Entschlossenheit zur Verteidigung ihres Glaubens gegen die „Häresie“.183 Dies bedeutet nicht, dass man die ursprüngliche Konzeption aufgegeben hätte, die vorrangig auf die Festigung und Vertiefung katholischer Religiosität abzielte, deren Überzeugungskraft Andersgläubige gewinnen sollte.184
Dies entsprach dem Selbstverständnis der Societas als Orden der Seelsorge, die als Dienst am Mitmenschen aufgefasst wurde. Zwar fanden sich die Jesuiten stets bereit zur Aushilfe in Pfarreien und zur speziellen pastoralen und karitativen Betreuung von Armen, Kranken, Gefangenen, Soldaten und sozialen Randgruppen,185 ihr Beitrag zur Katholisierung der Gesellschaft konzentrierte sich aber mit der Zeit schwerpunktmäßig auf die Predigt und die religiöse Publizistik, auf ihre Tätigkeit in Universitäten und Gymnasien, auf die Katechese, auch im Rahmen von Volksmissionen, und auf die Beichte, die als Instrument individueller Seelenführung eingesetzt wurde und die Gläubigen dazu anleiten sollte, in kritischer Selbsterkenntnis und in einem geschärften moralischen Bewusstsein sich selbst zu wandeln. Dies setzte eine entschiedene Identifikation mit der katholischen Lehre voraus, die durch systematische Unterweisung und durch die eindrucksvolle, anschauliche Kultivierung des Heiligen in der feierlich gestalteten Liturgie, bei Prozessionen, auf Wallfahrten, in besonderen Andachtsformen der Eucharistiefrömmigkeit und der Marien- und Heiligenverehrung vermittelt werden sollte. So sollte sich ein katholisches Bewusstsein formen, das nicht zuletzt im häufigen Empfang der Eucharistie Ausdruck finden konnte.186 Der Kampf gegen landkundige kirchliche Missstände und Fehlentwicklungen diente nicht der unbestreitbar dringend notwendigen institutionellen Reform als Selbstzweck, sondern zielte letztlich darauf ab, die Voraussetzungen für die Selbstreform des Einzelnen zu optimieren.187 Dabei bauten die Jesuiten auf die Vorbildlichkeit klerikaler, auch laikaler Lebensführung und die Effizienz eines konfessionell geprägten Bildungssystems.188
Im ursprünglichen Programm der ignatianischen Gemeinschaft war kein allgemeines pädagogisches Engagement ihrer Mitglieder vorgesehen. Seit den ersten Kolleggründungen in Goa, Gandia, Messina und Rom erkannte der Orden sehr rasch die hohe Bedeutung der Bildungsvermittlung für die kirchliche Erneuerung. Durch den Aufbau zahlreicher Gymnasien, die seinen Kollegien angegliedert waren, durch die Übernahme der Artistenfakultät und der theologischen Lehrstühle an katholischen Universitäten und durch die Mitwirkung an der Neugründung von Hochschulen, die sich auf diese beiden Fakultäten beschränkten, wurde er zum Hauptträger des katholischen höheren Bildungswesens in der Frühen Neuzeit. Er gewann damit prägenden intellektuellen Einfluss auf den Klerus und auf die katholischen Oberschichten, die als Multiplikatoren wirken und das Profil der jesuitischen Spiritualität als Leitmuster in die Gesellschaft hineintragen konnten.189 Ihr Gymnasialunterricht basierte zwar in der Hauptsache auf den pädagogischen Prinzipien des Humanismus und legte dementsprechend hohen Wert auf die Kenntnis der alten Sprachen und der antiken Literatur. Das Kernanliegen aber war die Vermittlung einer ganzheitlichen religiösen Bildung. Der an mittleren Kollegien realisierbare philosophisch-theologische Pastoralkurs zur Vorbereitung auf die Seelsorge war vorrangig praxisbezogen konzipiert. Der dreijährige philosophische Kurs, der von den Jesuiten in den von ihnen geleiteten Artistenfakultäten eingeführt wurde, geriet zum weitgehend zweckgebundenen Propädeutikum für das anschließende Theologiestudium. Die Theologie blieb Leitwissenschaft, die die maßgeblichen Normen für die kulturellen Studien setzte. So hatte das jesuitische Bildungssystem gegenüber dem Trienter Seminarkonzept, das eng auf eine priesterliche Berufsqualifikation angelegt und mit den allgemeinen Bildungseinrichtungen nicht vernetzt war, den Vorzug, auch für Laien attraktiv zu sein und zugleich zur Ausbildung des Pfarrernachwuchses beizutragen und damit den Mangel an Priesterseminaren bzw. die meist geringe Leistungsfähigkeit der wenigen gelungenen Gründungen zumindest teilweise zu kompensieren. Seine konfessionelle Engführung beschränkte allerdings langfristig seine Möglichkeiten zu wissenschaftlicher Weiterentwicklung,190 was schließlich dazu führte, dass das scholastisch gestützte jesuitische Lehrsystem den modernisierenden Ansprüchen der Aufklärung inhaltlich nicht standzuhalten vermochte.
In der Phase der katholischen Reform bewährte sich die pädagogische Konzeption der Jesuiten freilich als Erfolgsmodell. In den Gymnasien schufen die Einrichtung von Klassen unter der Leitung eines verantwortlichen Klassenlehrers, die Organisation der Schüler und Studenten als beaufsichtigte Lebensgemeinschaft, die strenge Schulordnung, die turnusmäßigen Prüfungen und die wachsame Sittenzucht der Jesuiten ein Disziplinierungspotential, dessen hohe Effektivität durchaus den Wünschen der Eltern und den Interessen des Landesherrn entsprach. Die sorgfältig bedachte religiöse Erziehung zu regelmäßigem Sakramentenempfang, zur Gewissenserforschung und zum Gebet lenkte die Persönlichkeitsentwicklung in die Bahnen katholischer Konfessionalität. Das von den Jesuiten allenthalben eingeführte Schultheater propagierte die Muster dieser Frömmigkeit und die Grundzüge des konfessionalisierten Weltbildes in der lokalen Gesellschaft und demonstrierte damit zugleich das hohe kulturelle Potential der katholischen Elite, das zuschauende Mitbürger und Andersgläubige beeindrucken und zum Konsens bewegen sollte. Daneben stimulierten Disputationen, Wettbewerbe, Prämien gezielt die Leistungsbereitschaft der Schüler und Studenten. Dem allem lag ein ganzheitliches Bildungskonzept zugrunde, das die Förderung und Entfaltung intellektueller Fähigkeiten mit der Internalisierung konfessionsspezifischer Werte und Normen verband.191
Die daraus resultierenden lebensprägenden Impulse kamen wohl am stärksten in den Marianischen Kongregationen zur Wirkung, in denen sich Schüler und Studenten, später auch Gruppen von Erwachsenen unter jesuitischer Leitung zusammenfanden, um durch die Mithilfe in der Katechese und bei der Gestaltung feierlicher Gottesdienste und Prozessionen, durch die Übernahme karitativer Aufgaben in der Kranken- und Gefangenenbetreuung, durch ihre Selbstdisziplin und durch ihr gemeinsames Bekenntnis, das sich in ihrer öffentlichen Frömmigkeitspraxis artikulierte, an der Katholisierung der Gesellschaft mitzuwirken.192 In den Kongregationen der Schüler und Studenten formierte sich eine Art „Jugendbewegung“, die zum Protestantismus und zu vorkonfessionellen, mitunter eher indifferenten Positionen entschieden auf Distanz ging, dabei auch den Generationenkonflikt mit andersdenkenden Eltern und Verwandten nicht scheute, sich durch einen missionarischen Elan beflügeln ließ und in dem weltweit agierenden, universalen, durch das Medium der jesuitischen Spiritualität vermittelten Katholizismus ihre eigene Identität fand.193 Die Marianer bildeten so eine konfessionelle Elite, die das Anforderungsprofil des jesuitischen Programms als Orientierungsmuster an ihre familiäre, berufliche und soziale Umgebung weitergab.
Dabei spielten das persönliche Beispiel der Jesuiten, ihre konsequente Ordensdisziplin und ihre Einsatzbereitschaft offenbar eine nicht unwichtige Rolle. Ihre Dienste in Schule und Kirche boten sie unentgeltlich an. Ihre Ausbildung, die ein zwei- bis dreijähriges Philosophie- und ein vierjähriges Theologiestudium umfasste, unterlag strengen Maßstäben. Ihre intellektuelle und pastorale Qualifikation fand vielerorts von Anfang an hohe Anerkennung. Sie konnten in verschiedenen Funktionen Verwendung finden.194 Zwar blieben Widerstände gegen ihre Ansiedlung, Vorbehalte gegenüber ihren Methoden, Kritik an ihrem selbstbewussten Auftreten, Spannungen zu anderen Orden etc. nicht aus,195 aber es gelang der Societas nicht nur bereits recht früh, reforminteressierte Kreise im Reich von ihrer Integrität und ihrer Leistungsfähigkeit zu überzeugen, sondern auch, dieses Ansehen langfristig zu verteidigen. Vor allem weltliche Fürsten erkannten bereits Jahre vor dem Ende des Trienter Konzils die Chance, die in der Kooperation mit den Jesuiten für die Realisierung ihrer eigenen religionspolitischen Intentionen liegen konnte. Der Orden war exemt. Damit bot sich die Möglichkeit, ihn mit päpstlicher Approbation zur Einleitung und Durchführung zielbewusster Maßnahmen einzusetzen, um dem konstatierten Reformbedarf abzuhelfen, ohne auf eine konstruktive Mitwirkung der als unzuverlässig und reformresistent abqualifizierten Bischöfe angewiesen zu sein.196 Auf diesem Wege konnte die kirchliche Erneuerung in Gang gesetzt und zugleich die landesherrliche Autorität mit dem Anspruch weitreichender religionspolitischer Kompetenz und Verantwortung, den die Jesuiten durchaus akzeptierten, als maßgeblicher Faktor zur Geltung gebracht werden. Im Vertrauen auf die Rechtgläubigkeit, Einsatzbereitschaft und Loyalität des Ordens beließ die weltliche Obrigkeit den Jesuiten den Freiraum, den sie beanspruchten, um ihr pastorales Konzept und ihr Bildungsprogramm nach ihren Vorstellungen zu realisieren und ihrer selbstgestellten Aufgabe gerecht zu werden. Dies schien vertretbar, weil die von den Jesuiten intendierte Katholisierung der Gesellschaft dem politischen Interesse an der Stabilisierung des Gemeinwesens unter verstärkter fürstlicher Herrschaft korrespondierte. Dabei fungierten die Kollegien der Jesuiten als Zellen konfessioneller Kirchlichkeit, die die weltliche Regierung durch flankierende Maßnahmen, vor allem durch Religionsmandate und die Intensivierung der Polizeigesetzgebung, schützte und landesweit zur verbindlichen Norm erhob. Zudem folgte der Orden im Einklang mit seinem missionarischen Selbstverständnis stets bereitwillig dem Aufruf zur Rekatholisierung gemischtkonfessioneller oder protestantischer Gebiete, die in landesherrlicher Sicht die religiöse Überzeugung, aber auch das Interesse an der herrschaftskonsolidierenden konfessionellen Homogenität der Untertanenschaft gebot.197 Auch hier fanden beide Seiten zu zielbewusster Kooperation. Die Bekehrungsversuche der Patres stützten sich oft genug auf die Protektion der Landesherrschaft und ihren militärischen Schutz.198 Diese enge Zusammenarbeit mit der weltlichen Obrigkeit barg für den Orden allerdings die Gefahr, entgegen den Intentionen seiner Gründung von der Politik über Gebühr vereinnahmt und zu profanen Zwecken instrumentalisiert zu werden.199 Seine Oberen legten zwar, wie die selbstbewusst und umsichtig geführten, oft zähen Verhandlungen um die Dotation der Kollegien zeigen,200 großen Wert auf ökonomische Unabhängigkeit und warnten ihre Untergebenen davor, sich in das rein politische Geschäft verstricken zu lassen. Aber die Neigung, das Prinzip der Opportunität gelten zu lassen, wenn dies ihrem religiösen Anliegen gemäß der Devise „Omnia ad maiorem Dei gloriam“ förderlich schien,201 bewog manche Jesuiten, auch rein politische Ambitionen zu unterstützen, zumal die Stärkung fürstlicher Herrschaft im frühabsolutistischen Sinn durchaus in der Logik des im Orden gemeinhin vertretenen Gesellschafts- und Politikbegriffs lag, der auf eine straffe – monarchische – Zentralisierung politischer Autorität und Kompetenz hinzielte. Aufs Ganze allerdings scheint nicht zweifelhaft, dass der religiös-pastorale Auftrag zur Vertiefung und Ausbreitung des katholischen Glaubens für den Orden seine Priorität behielt.202 Eben diese zentrale Motivation der Societas veranlasste auch reformbewusste Fürstbischöfe, die Kooperation mit den Jesuiten zu suchen, die als externe Kraft durch innerterritoriale Traditionen, Bindungen und Rücksichten nicht belastet waren und deshalb ohne Abstriche und ohne Kompromisse ausschließlich in den Dienst der kirchlichen Erneuerung gestellt werden konnten. Auf diesem Wege hofften die geistlichen Fürsten, die Hindernisse und Hemmnisse umgehen zu können, die in den tradierten Strukturen ihrer Hochstifte, in den Kompetenzansprüchen der Domkapitel und Archidiakone, in den Immunitäten und autonomen Rechten sonstiger kirchlicher Einrichtungen und Institutionen vorgegeben waren und die, wenn das interne Ordnungsgefüge nicht kollabieren sollte, nicht abrupt gebrochen werden, sondern allenfalls längerfristig und schrittweise abgebaut werden konnten.203 In den meisten Fällen, von Ausnahmen wie Würzburg abgesehen, blieben die Instrumente frühmoderner Staatlichkeit in den Hochstiften zu schwach, um durchschlagende Erfolge zu erzielen, oder konnten erst spät oder nur partiell eingesetzt werden. Unter diesen Umständen fiel den Reformorden, nicht zuletzt den Jesuiten, neben den leitenden Diözesanbeamten, den Weihbischöfen, Generalvikaren und Offizialen die Protagonistenrolle zu. Es kam dann darauf an, über die Bildungseinrichtungen der Societas und über ihr Engagement in der Seelsorge diese Trägergruppe zu verbreitern und den Klerus, das städtische Bürgertum und das weltliche Beamtentum für das Programm der Katholisierung zu gewinnen. Dabei traten die Jesuiten für die Akzeptanz bzw. Verwirklichung neuer Normen, Leitbilder und Verhaltensmuster ein, die sich zumindest in einem formalen Sinne als Vorgriff auf die spätneuzeitliche Modernisierung deuten lassen.204
Den männlichen Reformorden korrespondierte zunächst vor allem im romanischen Raum eine religiöse Frauenbewegung, deren Anfänge ebenfalls vor dem Konzil von Trient lagen und deren Spiritualität letztlich in der Devotio moderna und im vorreformatorischen Evangelismus wurzelte. Auch sie orientierte sich nicht mehr am tradierten monastischen Ideal der Weltferne, sondern am Postulat der Barmherzigkeit, das dem karitativen und religiösen Dienst in der Gesellschaft Priorität zuwies. Die an ihr beteiligten Frauengruppen begnügten sich zunächst ähnlich wie die Beginen in den Niederlanden und am Niederrhein mit einfachen Organisationsformen, die sich darauf beschränkten, die Kooperation alleinstehender Frauen mit oder ohne gemeinschaftliche Lebensführung zu koordinieren. Um sich auf Dauer halten zu können, bedurften diese religiösen „Arbeitsgemeinschaften“ freilich der Anerkennung und Protektion im Reformklerus.205 Dabei stellte sich nach Trient vor allem das Problem, dass ihr Verzicht auf die Klausur, der sich aus ihrer Option für das Apostolat in der Welt notwendig ergab, in diametralem Widerspruch zu den verschärften Klausurbestimmungen des Konzils stand. Die Bewältigung dieser Spannung zwang zu Konzessionen und Kompromissen, die der konziliaren Beschlusslage formal genügten, aber um den Preis einer fortschreitenden Institutionalisierung ausgehandelt werden mussten, die den Erneuerungsimpuls der Frauengemeinschaften verstärkter Kontrolle und damit dem allgemeinen nachtridentinischen Trend zur Klerikalisierung unterwarf. Unter Umständen konnten dabei die ursprünglichen weltzugewandten Ansätze unter starkem Anpassungsdruck verloren gehen.206 Aber ansonsten spielte im Selbstverständnis der meisten neuen weiblichen Orden das Vorbild der Societas Jesu eine maßgebliche Rolle.207 Dies belegt nicht nur die Gestaltung ihrer Satzungen und Regeln, sondern vor allem ihr dezidierter Wille zur aktiven Mitwirkung an der Katholisierung der Gesellschaft. Dementsprechend widmeten sich diese Frauenorden wie etwa die Ursulinen, die Englischen Fräulein oder die Welschnonnen neben der Frauenseelsorge und der Krankenbetreuung vor allem der Kinderlehre, der Katechese und der Mädchenbildung in unentgeltlichem Unterricht. Dies geschah durchaus in der erklärten Absicht, in ihren Schulen die künftigen Ehefrauen auf ihre Aufgabe, in der Kindererziehung und in der Gesindeaufsicht das katholische Glaubensgut zu vermitteln und zu katholischer Lebensführung anzuleiten, intensiv vorzubereiten.208 In ähnlicher Motivation fühlten sich auch die jesuitisch inspirierten Semireligiosen, die in Anlehnung an Einrichtungen der Societas und mit deren Unterstützung eigene Gruppen bildeten, zur Katechese und zur Lehrtätigkeit in Mädchenschulen als Form des weiblichen Apostolates in der Welt berufen.209
Das vor allem jesuitisch geprägte Schulwesen formte eine klerikale und laikale Elite, die an der Katholisierung der Gesellschaft aktiv mitwirken sollte. Sie war auf ein Frömmigkeitsideal verpflichtet, das in alle sozialen Schichten vermittelt werden sollte, um eine spezifisch katholische Lebenshaltung zur maßgeblichen Norm zu machen. Die Trienter Dekrete boten dazu kaum konkrete, praxisbezogene Anleitungen. Sie gaben allerdings in den Beschlüssen über die Rechtfertigung, die Transsubstantiation in der Eucharistie, die Sakramente, die Heiligen- und Reliquienverehrung, den Opfercharakter der Messe, das Fegefeuer und die Verkündigung verbindliche Leitlinien vor, die für die Entwicklung der religiösen Praxis richtungsweisend wurden.210 Auf dieser Basis entwarfen und propagierten die Reformkräfte in den folgenden Jahrzehnten ein Grundmuster katholischer Religiosität, das sich in seiner unverkennbar antiprotestantischen Ausrichtung keineswegs erschöpfte. Vielmehr kam es den Reformern zunächst einmal ganz allgemein darauf an, den erhabenen Bezirk des Heiligen gegen alles Weltliche abzugrenzen und gegen jede Profanierung zu schützen. Sie legten deshalb unter anderem besonderen Wert darauf, dass das Kircheninnere und der Friedhof würdig gestaltet wurden, dass die Exklusivität der lateinischen Kultsprache und die dignitäre Distanz zwischen dem geweihten Priester und den Laien gewahrt blieben, dass die Sonntags- und Feiertagsruhe eingehalten und die populären Feste, die sich um kirchliche Ereignisse rankten, möglichst weitgehend eingeschränkt wurden.211 Des Weiteren galt es, in Anknüpfung an spätmittelalterliche Ansätze und in Reaktion auf die reformatorische Theologie die Glaubenspraxis auf Christus zu zentrieren. Darin gründete die nunmehr geläuterte, zugleich intensivierte Passions- und Eucharistiefrömmigkeit, die in vielfältigen Formen Ausdruck fand.212 Daneben dominierte der bereits im Spätmittelalter beliebte, nun nachdrücklich geförderte Marienkult die Heiligenverehrung, die ansonsten nicht nur traditionellen Bahnen folgte und dabei dem verbreiteten Wunderglauben Raum ließ, sondern auch auf neue Vorbilder, z. B. auf die ersten kanonisierten Mitglieder der Reformorden hingelenkt werden konnte. Die Bejahung der Verdienstlichkeit der guten Werke intendierte zudem ein tätiges Christentum, das sich im aktiven kirchlich-religiösen und karitativen Engagement zu bewähren hatte.213 Häufige Beichte in der neuen Form der Seelenführung und regelmäßige Gewissenserforschung sollten die Individuen zu bewusster, eigenverantwortlicher Lebensführung nach katholischen Normen und Werten anleiten. Trotz der unverkennbar restaurativen Züge dieser Erneuerungsbestrebungen, die in vielem die spätmittelalterliche Frömmigkeit neu belebten, ist der Wille nicht zu übersehen, die traditionale Glaubenspraxis umzusteuern und zugleich zu zentrieren auf die als wesentlich geltenden Lehraussagen, auf die Ehrfurcht vor dem Heiligen, auf die Heilsbedeutung der sakralen Vollzüge und des Gebetslebens und auf die moralischen Anforderungen an eine christliche Lebensführung.214 Im Zuge der Reform verschmolzen die spätmittelalterlichen Bezüge unter dem Einfluss neuer Leitlinien zu einem erneuerten Grundmuster katholischer Religiosität, das nicht zuletzt auch romanischen Einflüssen offen stand und in der konsequenten Abgrenzung gegenüber reformatorischen Lehren ein tragfähiges katholisches Selbstbewusstsein zu stimulieren vermochte. Dieses Selbstverständnis fand in Akten der „demonstratio catholica“ (z. B. bei Prozessionen, Wallfahrten etc.) und in den zunehmend beliebten Formen gesteigerter Solennität Gelegenheit, sich individuell bzw. kollektiv zu artikulieren und sich seiner selbst zu vergewissern.
Die Bemühungen, Pfarrklerus und Laien mit hohem spirituellem Anspruch zu tiefgreifender Umorientierung im äußeren Habitus, in der inneren Einstellung zum Heiligen, in der alltäglichen religiösen Praxis und im Umgang mit dem Heilsangebot der Kirche zu führen, setzten in einer frühen Phase zunächst vor allem auf Verbot und Gebot der weltlichen und geistlichen Obrigkeit, die auf diesem Wege z. B. den Zölibat, das Trienter Ehedekret, die Sonntagsheiligung, die österliche Beicht- und Kommunionpflicht, die Fasten- und Abstinenzvorschriften etc. durchzusetzen suchte.215 Die Effektivität dieses Verfahrens blieb in der Regel denkbar gering. Gleiches gilt für die Anstrengungen, durch Mandat und Edikt die seit der Reformation ausgebildeten religiösen Mischformen zurückzudrängen und die Hinwendung zum Protestantismus zu unterbinden.216 Das bloße Machtwort der Obrigkeit genügte nicht. Ein durchgreifender Erfolg setzte eine mittel- und längerfristig konzipierte Strategie voraus, die kontinuierliche Stetigkeit mit entschiedenem Nachdruck verband. Dabei bildete sich, von territorialen Varianten abgesehen, allmählich ein spezifisches Handlungsmuster heraus, das zum einen darauf zielte, den konfessionellen Dissens, wenn die missionarische Belehrung in Vortrag und Gespräch misslang, durch verstärkten Druck zu eliminieren. Dies bedeutete, dass protestantische Prediger vertrieben, neugläubige Untertanen wirtschaftlich benachteiligt und geschädigt, durch die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses oder des Bürgerrechts abgeschreckt, durch vorübergehende Verhaftungen eingeschüchtert, durch Dragonaden belastet und notfalls ausgewiesen wurden.217 Zum anderen war intendiert, die konfessionelle Konformität und Korrektheit der kirchlichen Praxis sicherzustellen durch immer detailliertere Kirchen- und Polizeiordnungen und die konsequentere Überwachung ihrer Einhaltung, durch Visitationen und Sendgerichte, durch das Brautexamen und die Vergabe von Beicht- und Kommunionzetteln, durch den im Vergleich zum Spätmittelalter verstärkten Pfarrzwang und die Einführung der freilich noch lange unvollständig, ungenau und unzulänglich verwalteten Tauf-, Ehe- und Sterberegister, durch die Aufsicht über die kirchliche Güterverwaltung und die Regulierung des kirchlichen Finanzwesens etc.218 Besondere Anstrengungen erforderte die Durchsetzung des Trienter Dekretes „Tametsi“, die die Eheschließung und die voreheliche Sexualität der kirchlichen Kontrolle unterwerfen sollte. So wurde schrittweise ein einigermaßen funktionsfähiger Kontrollapparat aufgebaut, der im Einzelnen sehr verschieden strukturiert sein konnte und dessen Bürokratisierungsgrad stark variierte, der aber überall dem gleichen Zweck diente, nämlich an sinnfälligen Kriterien ablesbare konfessionelle Homogenität herzustellen, indem die obrigkeitliche Autorität möglichst wirksam zur Geltung gebracht wurde. Freilich profitierte davon die frühmoderne Staatlichkeit in geistlichen Territorien, die aufgrund ihrer inneren Verfasstheit politisch dauerhaft schwach blieben und kommunale bzw. aristokratische Autonomien allenfalls punktuell und partiell einschränken konnten, trotz der Symbiose mit der sukzessive wieder aufgewerteten kirchlich-bischöflichen Gewalt und den wieder gekräftigten Strukturen der Anstaltskirche zweifellos sehr viel weniger als in potenteren weltlichen Territorien wie etwa Bayern,219 deren Konfessionspolitik die religiöse Legitimation des fürstlichen, frühabsolutistischen Machtanspruches stützte.
Das disziplinierende Instrumentarium der Unterdrückung, Regulierung und Kontrolle leistete zwar, auch wenn es erst auf mittlere Sicht erkennbare Wirkung zeigte, einen erheblichen Beitrag zur konfessionellen Uniformierung. Dies betraf aber vorab nur die Außenseite der Gesellschaft. Ihre für die Heilsfähigkeit entscheidende spirituelle Katholisierung, das eigentliche Anliegen der Reformer also, war damit noch längst nicht im Vollsinne gewährleistet. Dazu bedurfte es intensiver erzieherischer Impulse, die dazu anhielten und anleiteten, das projektierte Frömmigkeitsideal und das ihm entsprechende Anforderungsprofil zu internalisieren. Die Durchsetzung einer straffen Organisation unter klerikaler Leitung z. B. bei Prozessionen und Wallfahrten gelang zweifellos rascher, wo der religiöse Sinn dieser neuen Disziplinierung, nämlich die religiöse Bedeutung der Ehrfurcht vor dem Heiligen überzeugend einsichtig gemacht werden konnte.220 Diese zentrale „didaktische“ Aufgabe wurde denn auch in Reformkreisen bereits in den dreißiger Jahren erkannt. Nicht nur die Jesuiten gewannen die Überzeugung, dass nur eine katholische Bildungsoffensive, die vor allem die Eliten als potentielle Multiplikatoren ansprechen und erfassen sollte, dem fortschreitenden Niedergang und der Ausbreitung des Protestantismus erfolgversprechend entgegenwirken könne.221 Neben dieser in der Tat zukunftsträchtigen Weichenstellung sollte eine breitenwirksame Volkskatechese die Basis schaffen für eine vertiefte Rezeption der katholischen Glaubenslehre. Allerdings ließ sich dieses Konzept nicht ohne Abstriche realisieren. Auf die konstruktive Kooperationsbereitschaft des Pfarrklerus war lange Zeit kein Verlass. Den Laien, besonders der ländlichen Bevölkerung war die Notwendigkeit, sich religiöses Wissen anzueignen, lange Zeit kaum oder allenfalls partiell zu vermitteln. Die Christenlehrbruderschaften, aus pastoralen Motiven von den Jesuiten und vom Episkopat systematisch gefördert, gewannen im Reich erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an Boden. Über Jahrzehnte hin konnte offenbar nur ein Teil der Bevölkerung, wohl überwiegend in den Städten, über die Katechese mit dem katholischen Glaubensgut vertraut gemacht werden.222 Inwieweit daneben die vor allem von Kapuzinern und Jesuiten veranstalteten Volksmissionen die Religiosität der Adressaten dauerhaft beeinflussen konnten, bleibt schwer abzuschätzen. Manche Vermittlungsformen wie etwa die frömmigkeitspädagogische Erbauungsliteratur, die in einem effektiv organisierten, auf Konformität bedachten katholischen Verlags- und Druckereiwesen produziert und vertrieben wurde,223 erreichten von vorneherein nur die gebildeten bzw. zumindest lesefähigen Schichten. Die Option führender katholischer Dynastien für bestimmte Frömmigkeitsformen, die ihren Führungsanspruch sakralisieren und so die Überzeugungskraft der absolutistischen Theorie unterstreichen sollten, beeindruckte zunächst vor allem die nähere Umgebung des Herrschers, die Hofgesellschaft, dann das residenzstädtische Bürgertum und erst in der Folge weitere Kreise.224 Zu den Modalitäten religiöser Umerziehung sind darüber hinaus auch die architektonische, liturgische und theatralische Inszenierung des Heiligen, die sonntägliche Predigt, das gelebte Vorbild des Klerus, das fromme Gemeinschaftserlebnis bei Prozessionen und Wallfahrten, die öffentliche Demonstration der konfessionellen Zugehörigkeit, das Beispiel dörflicher und städtischer Honoratioren etc. zu zählen. In ihrer Koinzidenz und Vielfalt wirkten auch solche Faktoren, sich gegenseitig ergänzend, bestätigend und verstärkend, auf lange Sicht auf eine markante konfessionsspezifische Formierung hin, wenn auch nicht ohne Verzögerungen, die teilweise bis in die Jahrzehnte um 1700 spürbar blieben. Durch kontinuierliche, diversifizierte Einwirkung, der auf laikaler Seite die traditionale Praxis des imitativen Lernens korrespondierte, gelang es allmählich, dem Sakramentsangebot der Kirche wieder breiteren Anklang zu verschaffen, die Formen katholischer Frömmigkeit in der Obhut eines reformierten, der Seelsorge vorrangig verpflichteten Pfarrklerus in regelmäßiger Folge zu reproduzieren und in die Planung des alltäglichen Lebens zu integrieren, im Rhythmus des Kirchenjahres und seines brauchtumsgesättigten Festkalenders den Zeitverlauf konfessionell zu strukturieren,225 durch Gebetsempfehlungen zur Heiligung des Tagesablaufs anzuleiten, kurz eine katholische Lebenswelt zu kreieren und ein entsprechendes konfessionelles Selbstbewusstsein zu stiften, das sich mit den zentralen Glaubenslehren der Kirche identifizierte und das sich in der Distanz zum Protestantismus, in einer eigenen frommen Bildlichkeit, in der Sakralisierung des Lebensraums etc. manifestierte.226
Diese Entwicklung vollzog sich in den Städten und auf dem flachen Land ganz offensichtlich mit einer deutlichen Phasenverschiebung. Wo es Jesuitenkollegien gab, früh schon marianische Kongregationen ihre Glaubensüberzeugung in die Gesellschaft tragen konnten und eine, wenn auch mitunter kleine, jesuitisch inspirierte Bildungsschicht in der Mühe um die Reform als hilfreicher Kooperationspartner fungierte,227 konnten sich die Impulse zur Katholisierung der Gemeinde bereits in den Jahrzehnten um 1600 entfalten. Dabei spielte das erneuerte, zunächst vornehmlich städtische Bruderschaftswesen, das sich unter dem Einfluss der Reformer aus seiner zunftbürgerlichen Tradition und spätmittelalterlichen Prägung löste, sich in reinen Gebetsgemeinschaften mit festgelegten Verpflichtungen zu regelmäßigen religiösen Übungen organisierte und klerikaler Leitung und Aufsicht unterstellt wurde, als Träger und Multiplikator der neuen Frömmigkeit eine wichtige Rolle. Die Devotionsbruderschaften entwickelten sich wie die jesuitischen Kongregationen zu einem wertvollen Instrument der Seelsorge, das zur Popularisierung der in der Reform propagierten Frömmigkeitsformen und der reformkatholischen Werte genutzt werden konnte. Sie fanden seit der Mitte des 17. Jahrhunderts verstärkte Resonanz, ohne freilich, wie das Kölner Beispiel zeigt, die zunftorientierten Laienbruderschaften spätmittelalterlicher Prägung völlig verdrängen zu können. In den Dorfpfarreien konnten die neuen Devotionsfraternitäten neben den Resten des traditionalen Bruderschaftswesens erst nach und nach Fuß fassen.228 Die Vermittlung des neuen Frömmigkeitsideals und seiner Spiritualität blieb dort vor allem dem Pfarrklerus überlassen.229 Seine Bemühungen hatten dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, dass die bäuerliche Religiosität sehr stark durch die lebensweltlichen Bedingungen der Agrarwirtschaft und durch die Strukturen der dörflichen Gesellschaft geprägt war. Das aus der existenziellen Abhängigkeit von der Natur resultierende Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, nach himmlischer Hilfe in den nicht selten ruinösen Wechselfällen des Lebens und das Interesse an der Funktionsfähigkeit der Dorfgemeinschaft, das sich gegen allzu rigide Eingriffe in die eingeübten Kommunikationsstrukturen z. B. der lokalen Festkultur sperrte, beeinflussten neben dem Heilsgedanken die Frömmigkeitspraxis der bäuerlichen Bevölkerung nachhaltig.230 Ins Gewicht fielen mitunter auch regionale Besonderheiten in der Sozialstruktur und im Herkommen. Unter diesen Umständen war die volle Durchsetzung des Ideals katholischer Lebensführung und Frömmigkeitspraxis nach dem Programm der Marianer kaum zu erwarten. Es konnte nur darum zu tun sein, eine für die Attraktivität des Kultes empfängliche Mentalität, die sich allen Formen theoretischer Belehrung nach Art der Katechese wenig zugänglich zeigte,231 durch die allmähliche Einübung des frommen Vollzugs schrittweise den Anforderungen der neuen Spiritualität zu öffnen und nach und nach die konfessionellen Normen in den Standard des dörflichen Verhaltenskodex einzuschreiben. Dies setzte voraus, dass Geistlichkeit und Laien zu zweckdienlichen Formen der Interaktion und Kommunikation fanden, um notfalls polarisierende Differenzen im Kompromiss begleichen zu können.232 Dies verlangte vom Klerus mitunter pragmatische Zugeständnisse und konnte den Prozess der Internalisierung konfessioneller Normen nicht unerheblich verlängern.233 Die kommunikative Partizipation der Laien konnte diesen Prozess freilich auch beschleunigen, wenn die Gemeinden schon früh eine reformaktive Rolle übernahmen.234 Konfessionalisierung stellt sich demnach keineswegs als einseitig von Obrigkeits wegen oktroyierter Disziplinierungsprozess dar. Ihr Beitrag zur Entwicklung frühmoderner Staatlichkeit bedarf also einer vorsichtigen und differenzierten Gewichtung.235
Dies gilt auch für ihre Bedeutung für die Eskalation der Hexenverfolgungen im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, die im Einflussbereich aller drei Großkonfessionen zu beobachten ist. Im Grundzug suchten die katholischen Reformer die Anfälligkeit der Bevölkerung für magische Vorstellungen und Praktiken den eigenen konfessionellen Normen zu unterwerfen und so unter Kontrolle zu bringen, und waren zugleich im Gegenzug bereit, die Deutung katholischer Benediktionen als Heilmittel pragmatisch und stillschweigend zu dulden und sich darauf zu beschränken, magische Elemente kirchlich einzuhegen. Dies erlaubte einen modus vivendi, der den Kontakt der Kirche zur Volkstümlichkeit wahrte und langfristig zur „Verchristlichung“ der weißen Magie, soweit sie zu Schutz und Hilfe eingesetzt wurde, tendierte.236 Zugleich aber war auch im Reformklerus nicht nur die Neigung zum Exorzismus, sondern auch der Glaube an die Möglichkeit des Teufelspaktes, der als Absage an Gott aufgefasst und der Häresie gleichgestellt wurde, weit verbreitet. Manche Protagonisten der Reform propagierten die Hexenvernichtung als Reinigung der Gesellschaft von den Elementen des Bösen in pointierter Form. In einigen geistlichen Territorien führte dies phasenweise zu exzessiven Verfolgungswellen. Seit der Jahrhundertwende mehrten sich allerdings auch die dezidierten Gegenstimmen aus dem katholischen Lager, die vor allem die fragwürdigen Inquisitionsmethoden kritisierten. Demnach konnte die Konfessionalisierung unter bestimmten Umständen als verstärkender Faktor wirksam werden und die Hexenhysterie verschärfen. Sie fungierte allerdings nur als ein Element in einem komplexen Wirkungszusammenhang mit vielfältigen regionalen und lokalen Besonderheiten. Besonders auffällig ist die Korrelation zwischen rigorosen Hexenkampagnen und Subsistenzkrisen, die durch klimatische Veränderungen bedingt waren und auf der Ebene der sozialen Beziehungen einen Mentalitätswandel verursacht haben könnten.237 Dessen ungeachtet bleibt die Theoriebildung zur Geschichte der Hexenverfolgungen schwierig. Jedenfalls lassen sie sich nicht primär aus konfessionellen Prämissen erklären.
In der abschließenden Bilanz ergibt sich unter Bezug auf die Konfessionalisierungsthese und empirisch gestützte Befunde ein differenziertes Bild, das eine isolierte Gewichtung potentiell zukunftsweisender Implikationen der katholischen Reform nicht zulässt. Abgesehen davon, dass sowohl im zeitlichen Ablauf als auch in der Intensität der Rezeption ein erhebliches Gefälle zwischen der städtischen Bildungsschicht und der ländlichen Gesellschaft, zwischen den Eliten und dem einfachen, kaum alphabetisierten Kirchenvolk bestand und deshalb für etwaige „modernisierende“ Einflüsse unterschiedliche Konjunkturen anzunehmen sind, dass es sich also um einen sehr ungleichmäßigen Prozess mit sektoral variierenden Reichweiten handelt, erscheint es weder zwingend noch sinnvoll, das sozialgeschichtliche Interesse an der katholischen Konfessionalisierung auf ihren Zukunftsbezug zu verkürzen und ihre langfristig relevanten, vielfach umwegig und subtil produzierten, zum Teil nicht intendierten Wirkungen, die sich bislang nur teilweise eindeutig nachweisen lassen, zu stark zu betonen. Ihre konkrete historische Bedeutung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Frühen Neuzeit beschränkt sich nicht auf ihre innovatorischen Leistungen und Funktionen, so förderlich etwa ihr Beitrag zur Entwicklung frühmoderner Staatlichkeit auch gewesen sein mag, sondern verdankt sich zumindest ebenso ihren restaurativen, retardierenden Tendenzen. Ihre Prägekraft, die sich nicht einseitig aus obrigkeitlicher Kontrolle und Disziplinierung, sondern in erheblichem Maße auch aus der Resonanz engagierter Überzeugungsarbeit und aus kontinuierlicher, langfristiger innerkirchlicher und lebenspraktischer Gewöhnung erklärt, blieb in der lebensweltlichen Realität ambivalent. Sie verharrte im Vorfeld der Moderne. Die Impulse der Erneuerung, die neuen Leitbilder zur Lebensführung und die zahlreichen amtlichen Vorschriften wurden im Kontext überkommener sozialer Verhaltensmuster gefiltert und adaptiert. Sie verschränkten sich zudem mit traditionalen Vorgaben. Der Entwurf der Reform profitierte zu einem nicht geringen Teil von spätmittelalterlichen, vorreformatorischen Konzepten. Die neue konfessionelle Kultur und der ihr zugeordnete Habitus katholischer Kirchlichkeit waren das in einem jahrzehntelangen Umerziehungs- und Lernprozess zustande gekommene Ergebnis traditionsverpflichteter Rückbesinnung und in der Konkurrenz zur Reformation vollzogener Neuorientierung zugleich. Spezifische Positionen und Einrichtungen der römischen Kirche wurden weiterhin akzeptiert bzw. in dosierter Form modifiziert oder nach neuen Anforderungen, soweit ohne Glaubwürdigkeitsverlust möglich, umgebaut. So blieben Traditionsstränge wirksam, die kirchenrechtliche und theologische Fixierungen präsent hielten und zugleich neuen Ansätzen genügend Raum zu dynamischer, freilich bei weitem nicht immer konfliktfreier Entfaltung ließen. Diese Zusammenhänge erschließen sich nicht zuletzt in einer im engeren Sinne kirchengeschichtlichen Perspektive, die ihrerseits der sozialgeschichtlichen Erweiterung bedarf, wenn die evolutionäre Ambivalenz der katholischen Konfessionalisierung als einer „konservativen Reform“ verständlich werden soll.238 Dieser doppelte Zugang erscheint vor allem dann unverzichtbar, wenn man die katholische Konfessionalisierung als Ausformung einer spezifischen konfessionellen Kultur begreift.