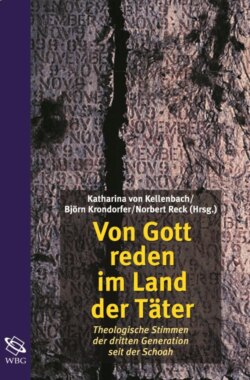Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verführungen. Versuch einer Positionierung im Geflecht der Diskurse
ОглавлениеIch sprach weiter oben vom „Missbrauch“ der Gottesrede in der NS-Zeit. Beim Aufschreiben wurde mir bewusst, dass ich damit unreflektiert einen Begriff verwandte, der einem bestimmten Diskurs der Nachkriegszeit angehört. Der Begriff des Missbrauchs transportiert in diesem Kontext nichts weniger als die Vorstellung, man könne erstens zwischen Gebrauch und Missbrauch klar unterscheiden, zweitens über den rechten Gebrauch des Wortes „Gott“ verfügen und drittens die NS-Zeit als Zeit des ideologischen Missbrauchs von Theologie eindeutig von der Zeit davor und danach abheben. Die Verwendung des Begriffs bedeutet also die Teilnahme an einem Diskurs, der den Nationalsozialismus als Zeitinsel begreift, die klar von ihren Vorgänger- und Nachfolgegesellschaften geschieden ist. Zu den gängigen Tropen dieses Diskurses gehören u.a. die Vorstellung der „Gleichschaltung“ der gesamten Gesellschaft durch „die Nazis“ sowie der Mythos von der „Stunde Null“ am Beginn der Nachkriegszeit. Beide Tropen zielen auf Schuldabwehr: Sie stilisieren die NS-Diktatur als eine Zeit, in der niemand etwas gegen die Verbrechen tun konnte, und die Nachkriegszeit als neue Periode, die von allen personellen, ideologischen und emotionalen Kontinuitäten frei war. Eine „periodenübergreifende Betrachtung des ganzen neuzeitlichen Geschichtsraums …, in dem sich der Nationalsozialismus abgespielt hat“, mit einem Blick auf Kontinuitäten und Diskontinuitäten, Handlungsspielräume und Verantwortungsebenen, wie sie Martin Broszat gefordert hat (1987, 172), gilt dieser Betrachtungsweise gerade nicht als wünschenswert.
Innerhalb dieses Diskurses ist es stattdessen üblich geworden, mit möglichst starken moralischen Begriffen seiner Empörung über die Schrecken der NS-Herrschaft Ausdruck zu verleihen, denn noch die rigoroseste Rhetorik dient der Isolierung der Zeit des „braunen Spuks“ von den „unschuldigen“ Perioden davor und danach. Während dieser Zeit des „Rückfalls in die Barbarei“ konnte dementsprechend von niemandem verlangt werden, mehr zu tun, als unauffällig mitzulaufen oder bestenfalls in die „innere Emigration“ zu gehen. Alle waren unglückliche, hilflose Opfer der „Schreckensherrschaft“. In der Nachkriegszeit versorgte dieser Diskurs seine Teilnehmer ausreichend mit den – auch international erwarteten – Bekenntnissen der Distanzierung von den Gräueln der „Gewaltherrschaft“ und ermöglichte zugleich ein jahrzehntelanges Schweigen darüber, „daß ein großer Teil der Wir-Gruppe der Deutschen sich zur Zeit des Nationalsozialismus ganz offenbar normativen Grundüberzeugungen verpflichtet fühlte, die unter anderem beinhalteten, daß es notwendig und gut sei zu töten“ (Welzer 1997, 11). Die Benennung der Träger dieser Grundüberzeugungen und die Analyse ihrer Quellen waren alles andere als erwünscht.
Wenn also der Begriff des „Missbrauchs“ ebenfalls zum Vokabular jener wohlfeilen moralischen Empörung gehört, die eher einem Opfer- und Unschuldsdiskurs folgt, kann ich ihn nicht weiter verwenden. Interessant an diesem terminologischen Beinahe-Fehlgriff finde ich, dass er zeigt, wie leicht das eigene Denken durch die ungenügend reflektierte Wahl gängiger Begriffe auf Gleise geraten kann, die den eigenen kritischen Interessen eigentlich zuwiderlaufen. Der Raum, in dem ich mich befinde, ist mehrfach vorstrukturiert von solchen Diskursen. Es ist nicht leicht und wohl auch nicht durchgängig möglich zu durchschauen, was eigenes und was ererbtes Denken ist. Eine Hilfe wäre die Anwesenheit anderer, dissidenter Diskurse, wie sie von deutschen Kolleginnen und Kollegen, die im Ausland leben, als befreiend erfahren wird.6 Dies ist in Deutschland selbst kaum der Fall. Die deutsche Gesellschaft besteht bis heute in ihrer großen, diskursbestimmenden Mehrheit aus Menschen, die im Nationalsozialismus erzogen wurden, und aus deren Kindern. Wer zur NS-Zeit eine von der Mehrheit abweichende Sozialisation hatte, hat das Land beizeiten verlassen oder die NS-Zeit nicht überlebt. Die Übriggebliebenen machen im Wesentlichen das heutige Deutschland aus.
Zu meiner Verortung gehört deshalb auch der Satz, dass ich mich durchaus als Kind des Nationalsozialismus verstehen muss. Ich erfahre mich als verstrickt in dieselbe Geschichte, die ich mich anschicke zu analysieren (vgl. Welzer 21 f, 1997). Das ist keine gute Basis für nüchtern-wissenschaftliches Arbeiten. Ich bin verführbar durch Unschuldswünsche im Hinblick auf meine Familie, durch aggressive Ressentiments gegenüber bürgerlicher Theologie und durch (vermeintlich befreiende) Idealisierung dissidenter Perspektiven. Ich halte es für möglich, dass meine Theologieproduktion vor allem das Ziel hat, die Schrecken von Auschwitz zu bannen.7 Den einzigen Weg zur – wenigstens ansatzweisen – Distanzierung von diesen Verführungen sehe ich darin, so gut wie möglich Rechenschaft über sie abzulegen.
So wenig ich also unbeteiligt und neutral sein kann, wenn vom Holocaust die Rede ist, so wenig gilt das auch für die beiden anderen Eckpunkte meines Gedankendreiecks: die Schuldgeschichte und die Rede von Gott.
Die nahezu paranoiden Zustände, die die Frage der Schuld bis in die jüngste Generation hinein erzeugt, will ich hier nur kurz damit andeuten, dass mir mehrmals 15-Jährige, die ich durch die Dachauer KZ-Gedenkstätte führte, mit großem Ernst erklärten, zur NS-Zeit noch nicht geboren gewesen zu sein und also deshalb keinerlei Schuld an den Verbrechen zu haben. Tatsächlich hatte ich ihnen mit keiner Silbe so etwas nahe gelegt, doch zeigte die Vehemenz, mit der mir dieses „Argument“ unterbreitet wurde, dass die Sprechenden nicht lediglich gelassen die zeitliche Distanz zu den besprochenen Ereignissen feststellen wollten, sondern dass die (phantasierten) Schuldvorwürfe, gegen die sie glaubten, sich verwahren zu müssen, in ihnen selbst höchst präsent waren in Form von Schuldgefühlen, die ursprünglich nicht ihre eigenen waren (vgl. Krondorfer 1995, 47ff). Die Ursprünge dürften wohl in der Schuldabwehr der tatsächlich Beteiligten, der ersten Generation, liegen und von dort aus weiter vererbt worden sein (vgl. Müller-Hohagen 1988).
Ausdruck dessen ist auch die Reaktion eines Lesers auf einen Aufsatz von mir über die katholische Theologie seit Auschwitz. Der Leser, ein katholischer Christ, schrieb mir, dass er wütend gewesen sei über meinen Artikel, nicht so sehr über meine Darstellung der Theologie, sondern (wie ich ihn interpretiere) über meinen zentralen Bezugspunkt der jüdischen Opfer, der für die Sichtweisen der deutschen Beteiligten keinen Raum lasse:
Wut empfinde ich darüber, daß wir, die wir Zeitzeugen sind – ich erlebte die Nazi-Zeit und den 2. Weltkrieg immerhin bis zum 14. Lebensjahr – nicht in die Reflexion, auch die der Theologie, Eingang finden. Am Beispiel Goldhagen […] kommt für mich eine moralisierende Generation zu Wort, auf die wir nur mit Wut reagieren können. Denn die Fragen, die eine solche Aufarbeitung stellt, sind berechtigt. Diese Fragen habe ich auch. Nur die Antworten …
Der entscheidende Kritikpunkt besteht zweifellos im „Moralisieren“, das hier der dritten Generation vorgehalten wird. Den Wunsch nach Einbeziehung der Zeitzeugen der deutsch-nichtjüdischen Seite kann ich mir in diesem Kontext nur als Wunsch nach Aufnahme rechtfertigender und Schuld relativierender Einlassungen denken. „Ihr seid nicht dabei gewesen!“, so würde ich diese Haltung für mich entschlüsseln, „ihr wisst nicht, wie schwer es war; wieso glaubt ihr, uns schuldig sprechen zu dürfen?!“ Bezeichnend ist, dass auch in diesem Fall, in meinem nachlesbaren Text (1996), nirgends Schuldvorwürfe gemacht wurden. Offenbar spielt das aber keine Rolle; das Reizwort Auschwitz und die Bezugnahme auf jüdische Zeitzeuginnen scheinen zu genügen, gereizte Stellungnahmen zu provozieren.
Diese Stellungnahmen gehören zum bereits angesprochenen Diskurs, der – quer durch die Generationen – an seiner Außenseite fast durchgehend die Unschuld der deutschen Mehrheit thematisiert, sich aber im Inneren an der Frage der Schuld, die nicht so leicht abzutun ist, abarbeitet. Ich bezeichne ihn deshalb als einen Un-/Schuldsdiskurs.
In diesem Geflecht der Abwehr und der Vorwürfe zu denken und zu schreiben ist nicht einfach, zumal das Argument, man dürfe nicht mit der billigen Klugheit der Nachgeborenen über die früheren Generationen richten, seine Wirkung auf mich nicht verfehlt. Daraus aber zu folgern, dass Nachgeborene sich grundsätzlich kein Urteil zu den Taten und Nicht-Taten der Vorangegangenen erlauben dürften, dass sie nur verstehend nachvollziehen dürften, was geschehen ist, halte ich nicht für statthaft. Dies käme einem Einklagen der Teilnahme der dritten Generation am Un-/Schuldsdiskurs gleich und sabotierte die Entwicklung der Mitglieder dieser Generation zu moralischen Subjekten. Denn allein durch das ungehinderte Nachdenken darüber, was Recht und was Unrecht war und ist (was etwas ganz anderes ist als „Moralisieren“), kann sich ein moralisches Urteilsvermögen bilden, das vor gegenwärtiger und zukünftiger Gewalt nicht in Hilflosigkeit erstarrt wie die Mehrheit dieser Gesellschaft gegenüber dem Rechtsextremismus.
Ich verspüre durchaus Ängste, an die Schuldgeschichte der Christen und Christinnen in diesem Land zu rühren, bin unsicher, ob es nicht anmaßend ist, ob ich überhaupt das „Recht“ dazu habe („Du hast die Pflicht!“ rief daraufhin ein jüdischer Freund). Die familienbiographischen und sozialisationsgeschichtlichen Wurzeln dieser Ängste kann ich immerhin ausfindig machen, und sie erinnern mich daran, dass ich ebenfalls nicht frei von diesem Un-/Schuldsdiskurs an mein Thema gehe.
Von meinem dritten Eckpunkt, Gott, sagt schon Paul Tillichs berühmte Definition, dass davon nicht objektiv bzw. objektivierend gesprochen werden kann. Wenn Gott das ist, „was uns unbedingt angeht“ (Tillich 1975, 9), was in meinem Leben höchste Priorität hat und vollkommene Hingabe verlangt, dann sage ich damit sehr viel über mich, wenn ich davon spreche. Ich bin unmittelbar beteiligt, ich spreche über grundlegende Optionen in meinem Leben, und das gilt sogar unabhängig davon, ob ich Gott ablehne oder Gott „mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft“ (Dtn 6, 5) lieben will. Ich kann nicht neutral sein. Ich kann nicht beziehungslos, unter Ausblendung meiner Subjektivität, von Gott sprechen. Gott kommt „nie als … ‚Gegenstand‘ innerhalb der menschlichen Erkenntnis zu stehen“ (Rahner/Vorgrimler 1986, 164).
Dieser Gedanke berührt die klassisch-theologische Lehre von der Analogie (IV. Laterankonzil 1215, vgl. DH 806), wonach, frei formuliert, die menschliche Rede über Gott mehr Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit des Menschen zeitigt als mit der Wirklichkeit Gottes. Im Anschluss daran könnte man auch, etwas religionskritischer im Ton, formulieren, dass die Aussagen der Menschen über Gott nur dann ihre Wahrheit behalten, wenn die Menschen und ihre Perspektive in diesen Aussagesätzen gegenwärtig bleiben. Wo der Beziehungscharakter der Aussagen zugunsten eines Objektivismus zurücktritt, wo also Gott als objektiver Gegenstand behauptet und der subjektive Charakter der Wahrheit geleugnet wird, tritt ein Moment der Lüge in die Aussage ein. Konkreter gewendet: Der Übergang von dem Satz „Ich glaube, dass Gott … ist“ zum Satz „Gott ist …“ markiert den Übergang von einer Wahrheit (die im Zeugnis besteht) zur haltlosen Unwahrheit. Objektivistische Aussagen über Gott verbergen ihre Subjekt- und Situationsabhängigkeit, suggerieren also überzeitlich gültige Wahrheit, indem sie ihre Zeitgebundenheit und Interessenlage verschweigen. Hier ist der Punkt, wo Gottesrede in Ideologieproduktion umschlägt.
Daraus ergeben sich für mich zwei Konsequenzen. Zum einen stelle ich an diesem Punkt ein weiteres Mal fest, dass ich mich hier nicht als nüchtern beobachtender Autor, sondern nur als ganz und gar Beteiligter verhalten kann – auch dann, wenn es darum geht, die Gottesrede eines anderen zu untersuchen. Zum anderen aber scheint mir die Feststellung, dass Sätze über Gott grundsätzlich Zeugnischarakter haben, dass diese Sätze also die Anwesenheit des sprechenden Subjekts im selben Satz erfordern, von wesentlich weiter reichender Bedeutung zu sein: Der ausgesprochene Verdacht, dass Subjektverbergung mit ideologischen Formen der Gottesrede in Zusammenhang stehe, könnte und soll hier ein zentrales Element für eine entsprechende Hermeneutik abgeben, mit deren Hilfe die Theologie in der NS-Zeit (und darüber hinaus!) zu dechiffrieren ist. Der Blick ist also einerseits darauf zu richten, welche Rolle das sprechende Subjekt bzw. seine Verbergung bei der Gottesrede spielt, und andererseits, welche Funktion sich daraus möglicherweise für die Etablierung von Un-/Schuldsdiskursen ergibt.