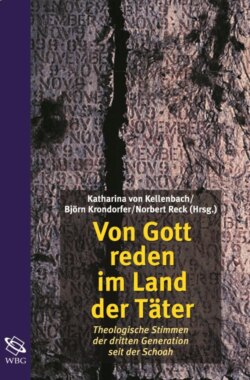Читать книгу Von Gott reden im Land der Täter - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Vox temporis – vox Dei“: Michael Schmaus
ОглавлениеSchmaus’ Eintreten für den Nationalsozialismus wird am klarsten greifbar in einer Rede, die er als junger Dogmatik-Professor am 11. Juli 1933 im Audimax der Universität Münster für Angehörige aller Fakultäten hielt und die als Broschüre 1934 (in der Schriftenreihe Reich und Kirche, mit kirchlicher Druckerlaubnis) bereits in zweiter Auflage erschien. Sie wirkte entschieden dabei mit, die im katholischen Kirchenvolk 1933 noch reichlich vorhandenen Bedenken gegenüber der Regierung Hitlers zu zerstreuen; sie sprach von der „selbstverständliche[n] Forderung“, sich „rückhaltlos in den neuen Staat einzuordnen“ (Schmaus 1934, 3), damit „der Bau des Reiches gelingt, der in Angriff genommen ist, des Reiches, das sein wird eine Opfergemeinschaft von unerschütterlich in Gott gegründeten, aus dem deutschen Volkstum genährten, demütig auf Gott vertrauenden, ihrer Verantwortung bewußten, von Christus geformten deutschen Menschen.“ (46)
Außer den Kirchengeschichtlern Hermann Greive (1969) und Georg Denzler (1996) haben sich, soweit ich sehe, zünftige Theologen kaum je mit dieser Publikation auseinander gesetzt.8 Man schweigt über sie und verweist lieber auf Schmaus’ wissenschaftliche Leistungen, auf seine „Weltoffenheit“, seine „irenische Art“ und seinen Anstand. Ich vermute, dass gerade diese Ehrenerklärungen indirekte Stellungnahmen zu Schmaus’ Parteinahme für den Nationalsozialismus sind, die natürlich immer im Raum steht und ein doppeltes Bedürfnis nach Rechtfertigung erzeugt: Man muss Schmaus und man muss sich selbst rechtfertigen als Schüler, Anhänger oder Laudator. Dies geschieht durch die Teilnahme an einer Variante des erwähnten Un-/Schuldsdiskurses. Sie beruht auf der Annahme, ein freundlicher, zivilisierter Mensch könne doch niemals (direkt oder indirekt) der „barbarischen“ Herrschaft des Nazismus zugearbeitet haben. Im Hintergrund steht das Klischee, die Nationalsozialisten und ihre Unterstützer seien allesamt rohe, ungebildete Unholde gewesen. Wer sich mit Schlips und gestärktem Hemdkragen von den pöbelnden, gewalttätigen SA-Horden deutlich genug unterschied, konnte mit „diesen Verbrechern“ doch nichts zu tun haben, der musste doch ein „Ehrenmann“ sein! Mit anderen Worten: Im Tropus vom nazistischen „Rückfall in die Barbarei“ ist die Unschuldshypothese des Bildungsbürgertums enthalten. Oder genauer gesagt: Der Sinn der Rede von der Barbarei ist der Aufweis der bürgerlichen Unschuld. Nebenbei verstellt sie völlig den Charakter des Nationalsozialismus, der mit guten Gründen als ganz und gar moderne und seriös daherkommende „Verbindung einer wissenschaftlich-medizinischen Utopie mit einer politischen Programmatik“ (Welzer 1997, 96) beschrieben werden kann.
Deshalb braucht an dieser Stelle überhaupt nicht bestritten zu werden, dass Schmaus ein weltgewandter, freundlicher Mensch war. Schmaus sollte keineswegs als einem Buhmann, sondern als einem exemplarischen Theologen begegnet werden, als einem, der womöglich nur etwas mutiger war als die meisten seiner Kollegen und offener aussprach, was er dachte.
Deshalb interessieren mich hier weniger seine vielfältigen und auch später wiederholten Feinderklärungen – gegen Liberalismus (Schmaus 1934, 8), Sozialismus und Marxismus (11), Individualismus (13), Fremde, Presse, Literatur, Theater, Kunst, Kino (21) und natürlich gegen das jüdische Volk (33f) –, sondern allein die Formen, die die Rede von Gott bei Schmaus in den wechselnden Kontexten (der Jahre 1933, 1938, 1945/46 und 1949) annahm.
Nach einem zeitdiagnostischen Kapitel und einem weiteren zur nationalsozialistischen Weltanschauung beginnt Schmaus seine theologische Reflexion in seiner Rede vom Juli 1933 zunächst kirchlich-korporativ: Der erste Gedanke gilt nicht Gott und seinem Handeln, sondern dem Katholizismus und seiner „Geistigkeit“. Programmatisch findet sich hier der Satz:
Katholisch bedeutet Bindung an das Gegebene, an das Objektive, Ehrfurcht vor dem Gewordenen, Gewachsenen, vor allen naturhaften Ordnungen, und zwar aus religiösen Motiven. (Schmaus 1934, 23)
Die Bindung, die den katholischen Glauben ausmache, bezieht sich also nicht allein auf die „naturhaften Ordnungen“ (wie man schöpfungstheologisch und auf dem Hintergrund der Verhältnisbestimmungen von Natur und Gnade vielleicht noch erwarten könnte), sondern auf eine wesentlich weiter greifende Synthese aus Natur, geschichtlich Gewordenem und einfach Gegenständlichem – auf das schlechthin „Objektive“. Gott selbst kommt an dieser Stelle nur äußerst vermittelt vor, schimmert von fern vielleicht hinter dem Begriff der „Ehrfurcht“ und wird zunächst indirekt – und wie ein Anhängsel – eingeführt mit der Wendung von den „religiösen Motiven“. Aus solchen Motiven also binde sich der Katholik ans „Gegebene“, d.h. das Gegebene, Objektive muss für ihn Ausdruck des Gottgegebenen sein.
Auf dieser Linie sieht nun Schmaus in der objektiven Welt und ihren geschichtlichen Entwicklungen handfeste Manifestationen Gottes. Bereits im Vorwort der Broschüre macht er sich den Wahlspruch „Vox temporis – vox Dei“ (Schmaus 1934, 4) zu eigen, der ja ebenfalls die göttliche Ursächlichkeit des Objektiven, ja des Zeitgeistes, zum Ausdruck bringt. Im weiteren Argumentationsgang wird das entfaltet und auf die konkrete Situation des Jahres 1933 bezogen:
Da im Hintergrunde der Geschichte der göttliche Wille steht, können wir aus der Geschichte ohne Furcht uns zu täuschen ablesen, daß Gott dem deutschen Volke eine der größten Aufgaben zudachte. (Schmaus 1934, 30)
Der Gedanke des Thomas von Aquin, dass die menschliche Freiheit und Erkenntnisfähigkeit von Gott geschenkt sind und deshalb Gottes Gnade auch nicht entgegenstehen („Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie“ – S.th. I, 1, 8 ad 2; I–II, 99, 2 ad 1), erfährt bei Schmaus mithin eine (neuscholastisch vorgeformte) Verengung und schließlich sogar eine „Inkulturation“ ins Völkische: „Die Gnade unterdrückt keine Natur, auch nicht die völkische, sondern setzt sie voraus und erhöht sie, führt sie auf göttliche Gipfel empor.“ (Schmaus 1934, 36) Damit ist der theologische Rahmen abgesteckt, in dem sich Schmaus’ weitere Überlegungen bewegen. Die Herrschaft des Nationalsozialismus wird der „Natur“ zugeschlagen und auf diesem Wege zur Voraussetzung und Grundlage des göttlichen Gnadenhandelns erklärt. Umgekehrt wird zugleich Gott als objektiver Garant alles Objektiven eingeführt.
Gott kann dabei zwar auch als „ein lebendiges Du“ (34) apostrophiert werden, aber dies scheint eher ein Echo auf die wachsende Popularität des frühen Personalismus zu sein, denn für Schmaus’ Form der Gottesrede hat dies keine weiteren Konsequenzen. Ein Ich, das eine persönliche Gotteserfahrung zu bezeugen hätte, kommt nirgends vor. Im Mittelpunkt des Interesses befindet sich Gott als „die höchste, die unverrückbare und unantastbare Wirklichkeit“ (34), die hinter allem Gegebenen steht und unsere Bindung daran fordert. Schmaus interessiert nicht, was er als „irgendeine phantastische Konstruktion“ (28) und „Gemächte menschlichen Denkens oder Wollens“ (34) charakterisiert, sondern allein die „klare Offenbarungslehre.“ (28) Die menschliche Subjektivität muss hinter der objektiven Lehre und der Objektivität Gottes zurückstehen. So lassen sich dann auch Sätze formulieren, die Gott auch hinter spezielleren Projekten des Nationalsozialismus am Werk sehen:
Gott spann und knüpfte die Fäden, deren Geflecht wir Volk heißen. Die Liebe, die der Gläubige zu seinem Volk hat, ist dadurch hinausgehoben über alles Schwanken individueller Neigungen und Gesinnungen. Sie ist verwurzelt im rauschenden Blut und tragenden Boden, die beide Gottes Werk sind, sie ist so letzten Endes verankert im unerschütterlichen göttlichen Urgestein. Eine Folge der Liebe zum Volk ist die gerechte Sorge für die Reinerhaltung des Blutes, dieser Grundlage für die geistige Struktur eines Volkes. (Schmaus 1934, 29)
Schmaus’ Botschaft ist also in ihrem Kern ein theologisch entwickeltes Plädoyer für das Misstrauen gegenüber allem Subjektiv-Individuellen und für die gehorsame Unterwerfung unter das Objektive, das sich in den Größen Natur, Volk, Gemeinschaft, Staat und Ordnung manifestiert.
Besondere Kontur gewinnt dieses Plädoyer angesichts der Ambivalenzkonflikte, in denen sich viele Katholiken zu Beginn der NS-Zeit weiterhin sehen. Schmaus spricht diese Konflikte an, obwohl sie ganz offensichtlich nicht (mehr) die seinen sind. Er argumentiert aus der Warte dessen, der bereits zu klarer Parteinahme für den neuen Staat gefunden hat. Zweifel, ob im Zuge des Nationalsozialismus nicht doch eine Renaissance germanischen Götterglaubens zu erwarten sei, zerstreut Schmaus mit dem Hinweis auf gegenteilige Versicherungen „im amtlichen Schrifttum der Partei“ (Schmaus 1934, 38); Befürchtungen, die Rechte der Kirche könnten von den Nationalsozialisten doch angetastet werden, gelten für ihn als überholt, seit „das Reichskonkordat die Einheit und Harmonie zwischen Kirche und Staat in feierlicher Weise vor der Welt verkündet und garantiert hat.“ (39) Was aber war zu halten von den dennoch massiv erfolgenden Übergriffen gegen katholische Verbände, Arbeitervereine, Jugendorganisationen und deren Presseorgane? Handelte es sich hierbei nicht um offene Repression? Schmaus weiß davon und gesteht zu, dass „mancher … die Einengung katholischer Organisationen drückend empfinden“ (40) mochte. Sein Rat geht in Richtung einer „Objektivierung des Selbst“ (Welzer 1997, 105): Man dürfe nicht auf „blindem Eigenwillen“ bestehen, nicht die eigenen Organisationen „vergötzen“ und Ressentiments pflegen. Sorgfaltige Prüfung ergebe, dass es doch besser sei, wenn der katholische Geist nicht in eigenen Organisationen „gefangen“ bleibe, sondern die Gesellschaft erfülle. Es könne sogar „zum Segen sein, wenn die katholischen Organisationen zu einer straffen Zusammenfassung gezwungen werden, zu einer starken Betonung des Grundsätzlichen“ (Schmaus 1934, 41). Die empfohlene Objektivierung zielt also darauf, von den persönlichen Empfindungen und Verletztheiten, auch von den konkreten Einschränkungen zu abstrahieren und „das Ganze“ zu betrachten. Wehmut und Resignation seien zwar „menschlich begreiflich“, aber gerade das menschlich Begreifliche ist abzulegen zugunsten einer objektiven Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Schicksal und Vorsehung sind die Kategorien, unter denen die neuen Verhältnisse gedeutet werden:
Menschlich begreiflich mag sein, daß heute mancher Katholik wehmütig vor den Grabhügeln steht, welche sich über Organisationen wölben, die ihm in Jahrzehnten seines Lebens teuer geworden sind, in deren schützenden Mauern er den Katholizismus und sein eigenes religiöses Leben geborgen wähnte. Dem Katholiken ziemt es nicht, resigniert den Blick zurückzuwenden in die Vergangenheit und zu trauern über die Toten, die ins Grab sanken, weil die Zeit ihres Lebens vorüber war. Der Katholik traut der göttlichen Vorsehung, daß nichts stürzt, bevor seine Zeit gekommen ist und bevor es reif ist, von der Geschichte weggeholt zu werden aus dem Reiche der Lebendigen. Nur blinder Eigenwille kann hadern mit dem Schicksal alles Seienden, das lautet: Kommen, werden, wachsen, vergehen. Mag es für eine irdische Größe einen noch so blütenreichen Frühling, einen noch so fruchtschweren Herbst geben, es kommt unaufhaltsam der Winter. Der Katholik muß Wesentliches und Unwesentliches unterscheiden lernen, zeitgebundene Form und ewigen Gehalt. (Schmaus 1934, 39)
Knapp zusammenfassen lässt sich Schmaus’ Position demnach mit der Formel, dass er eintritt für die Verbindung eines entschiedenen Objektivismus in der Gottesrede mit einer entsprechenden Objektivierung des Selbst.
In den folgenden Jahren der NS-Zeit nimmt Schmaus nicht mehr explizit Stellung zu politischen Fragen (jedenfalls sind keine Belege bekannt), aber jener Ton, der die Objektivierung des Selbst empfiehlt, setzt sich auch in Schmaus’ Dogmatik von 1938 in klarer Schärfe fort:
Der Gott der Vorsehung, von dem Christus spricht, ist nicht der „liebe Gott“, der nach Art eines gutmütigen irdischen Vaters die Wünsche und Launen seiner Kinder nach mehr oder weniger heftigem Drängen erfüllt. Er ist der Vater, aber zugleich der Herr. Er ist beides in einem. Er ist der Vater, der seine Kinder zur Herrlichkeit fuhren und sie daher von dem Bösen, das sich seiner Absicht widersetzt, in Schmerzen und Plagen befreien will. Er ist der Herr, der die Menschen die steilen und rauhen Wege gehen heißt, die zur Größe fuhren, eben aus Vatergüte. Seine Absicht geht nicht darauf, ihnen ein behagliches irdisches Dasein, sondern ihnen die Vollendung zu verschaffen. (Schmaus 1938, 85)
Weiterhin geht es also um den Weg zur Größe, um das Beschreiten von „steilen und rauhen Wegen“, wie nun Ambivalenzkonflikte metaphorisiert werden. Das Projekt der Selbstobjektivierung gipfelt hier theologisch in der Vorstellung, dass es Gottes Güte sei, die den Menschen mit Schmerzen und Plagen heimsuche. Dies wird schließlich „aufgefangen“ durch eine sehr herrschaftliche Charakterisierung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Der zum Abstrahieren von sich selbst aufgerufene Mensch ist derselbe, der berufen sei zu einer „Herrscherstellung im All“ (Schmaus 1938, 168), er sei „der Bevollmächtigte Gottes auf der Erde“ (168); zu seinen Eigenschaften zählen – parallel zu den „Zügen Gottes“ – „Erhabenheit, Weltüberlegenheit, Macht, der selbstmächtige Wille“ (165).
„Hingeordnet“ bleibt der so attribuierte Einzelne aber auf das Volk, das Gottes Willen entstammt und ebenfalls Unterordnung, also Objektivierung, verlangt:
Das Volk ist eine aus göttlichem Schöpfergedanken und -willen geborene Tochter Gottes voll gottgeschaffener Kraft und Lebendigkeit. Wie von den Einzelwesen, so hat Gott auch von jeder Gemeinschaft die ihr entsprechende ewige Idee, von jeder also eine andere. Je reicher Gottes Idee ist, deren Verwirklichung ein Volk bedeutet, um so höher steht dieses im Rang. (Schmaus 1938, 202)
Wenn sich Schmaus nach 1934 auch politischer Stellungnahmen enthalten haben mag, bleibt doch die Kompatibilität seiner Theologie mit dem Herrenmenschentum der Nationalsozialisten offensichtlich: Mit dieser Theologie im Tornister wird man im nahenden Zweiten Weltkrieg nicht zögern voranzuschreiten. Der darin behauptete Gott, so fürchte ich, ist keiner, der der Ausrottung von jüdischen Gemeinden Einhalt geböte. Er ist der Gott der Täter.
Mit dem Kriegsende ändern sich die Vorzeichen in Deutschland auch für die Theologie. Es ist nun undenkbar, dass man „dem Antisemitismus theologische Gründe leiht“ (Schmaus 1949, 187), man hat nun den „Blick in die Zukunft … mit dem jüdischen Volk gemeinsam“ (190). Im ersten Semester „nach dem Zusammenbruch“ (Schmaus 1945, zit. n. Ausgabe 1954, 9), hält Schmaus an der Universität München Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten über das Wesen des Christentums. Im Vorwort beschreibt er die neue Situation:
Die Vorlesungen fanden statt in einem der wenigen der Universität noch verbliebenen Hörsäle. Ihren Hintergrund bildete der Trümmerhaufen, in den die Universität München verwandelt worden war. Angesichts des Schuttfeldes in der Ludwigstraße in München, angesichts der Trümmerberge in Deutschland erhebt sich die Frage, was denn von all dem Bestehenden noch geblieben ist. Wir haben erlebt, daß es nichts auf der Welt gibt, das nicht der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt wäre. Was von der Erde stammt, ist von der Vergänglichkeit bedroht. In die stärksten Mauern sind Tod und Untergang eingebaut. Jeder irdische Boden wankt, und nichts Festes bleibt. Derjenige, der in einer solchen unheimlichen Wüste der Zerstörung steht, wird von der Frage gequält: Was bleibt? Bleibt etwas? Wo ist der Boden, auf dem wir fest stehen und ausharren können? (Schmaus 1954, 9)
Erschütterung bestimmt diese Bemerkungen, erwähnt werden aber allein die kriegsbedingten Zerstörungen in Deutschland; der Blick fallt nicht auf die Verwüstungen im übrigen Europa. Fast unmerklich setzt zugleich wieder die Schicksalsrhetorik ein, die schon Schmaus’ Plädoyer für die Selbstobjektivierung bestimmt hatte: Nicht die Scham über die Beteiligung am Zerstörungswerk ist das Thema, sondern die Vergänglichkeit. Die Zerstörungen sind über das Land gekommen, wie der Winter den Herbst ablöst: „Was von der Erde stammt, ist von der Vergänglichkeit bedroht.“ Die unkonkret-allgemeine Redeweise sucht Zuflucht in naturalistischen Bildern, die nichts von Verbrechen wissen.
Fragen danach, ob die Wirklichkeit Gottes noch geblieben sei, ob nicht das Christentum versagt habe (Schmaus 1954, 11), bleiben rhetorisch; ihnen wird nicht wirklich nachgegangen. Eher geht es darum, sie abzuschütteln und sich wieder aufs „Eigentliche“ zu konzentrieren. Das Eigentliche sei die Liebe, die Nazis stehen für den Hass. Deshalb gelte es, sich nicht den Blick für die Liebe verstellen zu lassen. Der Blick auf sie sei aber durch zweierlei gefährdet:
In der Geschichte selbst überschreit der pompöse Lärm des Hasses die in Christus laut gewordene, in der Kirche weitergesprochene Stimme der Liebe. Der Anblick der Erschlagenen, der Gequälten und Gefolterten verdeckt in der Geschichte immer wieder die von Christus ausgesteckten und von der Kirche festgehaltenen Liebeszeichen. (Schmaus 1954, 30)
Das ist bemerkenswert: Hass und Leiden, Täter und Opfer stören die Wahrnehmung der Liebe Christi, an die sich die Kirche die ganze Zeit über gehalten habe. Schmaus sieht sich selbst auf keiner der beiden Seiten, er positioniert sich hier – sozusagen als objektiver Beobachter – zwischen Tätern und Opfern. Den Anblick der Opfer meint Schmaus meiden zu müssen, um seinen objektivistischen Christus weiterhin bewahren zu können (im Angesicht der Opfer will er Christus offensichtlich nicht begegnen); der Auseinandersetzung mit dem Nazismus scheint Genüge getan, indem man ihn als „Lärm des Hasses“ qualifiziert.
Mit diesen Formulierungen findet Schmaus bereits erste Worte der moralischen Empörung über die Barbarei der NS-Zeit, Tropen, die – wie erwähnt – eine wesentliche Funktion im Gefüge des Un-/Schuldsdiskurses der Nachkriegszeit haben werden. Hierzu passend entwickelt er die Alternative, sich entweder „Gott zu unterwerfen“ (Schmaus 1954, 38) oder „sich von Gott freizumachen und dadurch … unter die Tyrannei widergöttlicher dämonischer Kräfte zu fallen.“ (39) Damit wird einerseits die Naziherrschaft retrospektiv als Werk des Unglaubens, als Abfall von Gott charakterisiert, andererseits kommt mit dem dämonologischen Gesichtspunkt ein weiterer Vorbote des entstehenden Un-/Schuldsdiskurses zum Vorschein: Wenn Dämonen die wahren Herrscher in der NS-Zeit waren, denen die Gottlosen Vorschub geleistet hatten, dann waren die gläubigen Christen hilflose Zuschauer jener Tyrannei.
Darüber hinausgehende Konturen seines Gottes zeichnet Schmaus wenige Jahre später in einem Aufsatz für die Zeitschrift Judaica, die „Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart“ veröffentlicht. Dort denkt er u.a. über die „Heilsbedeutung der jüdischen Glaubensverweigerung“ (Schmaus 1949, 188) nach. Die „Nichtanerkennung Christi“ durch die Mehrheit des jüdischen Volks gehöre zum Plan der göttlichen Vorsehung, denn sie habe schließlich zur Entstehung der Kirche geführt. Nachdem nun aber die Kirche als neue Trägerin des Gottesbundes das jüdische Volk abgelöst habe, stelle sich die Frage, ob das Judentum nicht doch „veraltet“ sei: „Hat es dann noch einen Lebenssinn? Oder haben nicht jene recht, welche ihm das Lebensrecht absprechen?“ (189) Diesem Problem nicht aus dem Wege zu gehen sei keineswegs antisemitisch, sondern vielmehr die einzige Möglichkeit, die Frage zu „entgiften“. Mit Rekurs auf Paulus geht Schmaus nun davon aus, „daß das auserwählte Volk dennoch das auserwählte bleibt“ (188), und zwar deshalb, weil Gott mit diesem Volk noch „große Pläne“ habe: nämlich die Bekehrung ganz Israels zu Christus als Einleitung der Vollendung der Welt.
Schmaus’ Theologie braucht offenbar die Perspektive auf ein Ende des Judentums – wenn auch nur durch Bekehrung. Das Weiterbestehen des jüdischen Neins zum Christentum auch in der Gegenwart wird von ihm nicht gedeutet, nicht als bedeutsam wahrgenommen; dieses Nein hat für ihn bloßen historischen Wert als Entstehungsbedingung der Kirche. In der Zeit danach sieht Schmaus die einzige Existenzberechtigung des Judentums in dessen noch ausstehender Konversion zu Christus. Darin – neben allen antijüdischen Konnotationen – zeigt sich das Fatale der objektivistischen Theologie in aller Konsequenz: Sie ist nicht in der Lage, unterschiedliche Glaubensauffassungen, hier die jüdische und die christliche, nebeneinander auszuhalten und eben für den eigenen Glauben einzutreten, indem sie ihn persönlich bezeugt. Sie braucht stattdessen die konstante Wiederholung der Behauptung, dass der eigene Glaube objektiv der Wirklichkeit entspreche. Genauer: Die objektivistische Theologie glaubt nicht, was sie vertritt, sondern geht von dessen gegenständlicher Tatsächlichkeit aus. Intersubjektiv bezeugte Wahrheit hält sie für schwächlich, sie akzeptiert nur die eigene Anschauung und wertet andere ab.
Schmaus bleibt an diesem Punkt nicht stehen. Weil er davon ausgeht, dass seine Auffassung der Pläne Gottes objektive Wahrheit sei, deutet er auch geschichtliche Vorgänge in diesem Sinne. Gottes Absicht, sein auserwähltes Volk zu retten, zu Christus zu bekehren, manifestiert sich in Schmaus’ Augen in geschichtlich erfahrbaren Akten des Gerichts:
Der widerstrebende Teil Israels soll durch den Sturz aus seiner einstigen Höhe und durch alle Heimsuchungen zur Besinnung gerufen werden. Nur weil Gott sein Volk nicht vergessen kann, nur weil er es nicht der Verlorenheit preisgeben will, züchtigt er es hart und oft. (Schmaus 1949, 189)
Dies wurde nicht irgendwann geschrieben. Dies wurde geschrieben kurz nach dem Holocaust. Es ist unmittelbar darauf bezogen, als eine frühe Neubestimmung des katholisch-jüdischen Verhältnisses. Diese Theologie sieht im Holocaust Gott am Werk, der sein Volk zu Christus bekehren will. Die Deutschen sind unschuldig, sie waren nur Gottes Vollstrecker. Der Täter ist Gott.